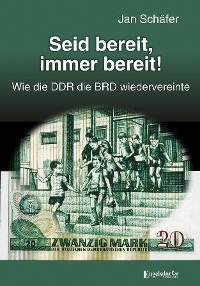Kitabı oku: «Seid bereit, immer bereit!», sayfa 3
In der Kirche des Ortes hatten sich nach einer Demonstration viele Menschen eingefunden. Man war durch das Zentrum gelaufen, am Marktplatz vorbei, unter den Rathausfenstern entlang die innerstädtischen Straßen entlanggezogen und schließlich in die Kirche eingekehrt. Im Schutze der Kanzel herrschte nun ein reges Durcheinander miteinander redender Menschen. Es herrschte Uneinigkeit darüber, wie die nationale Einheit gefestigt werden soll, weil die Anforderungen an das Land eine ganze Menge Probleme mit sich brachten. Für die altgedienten Funktionäre unter den Anwesenden war es keine Frage des Glaubens, sondern eine von Macht mit Revolutionscharakter. Dementsprechend forsch traten sie auf, nicht achtend die Schirmherrschaft der Kirche, die eingeladen hatte, um im Widerstreit zu vermitteln. Dort trafen sie auf Männer und Frauen aus der Bevölkerung, die politisch weniger engagiert waren, aber die Zeichen der Zeit erkannt hatten. Sie forderten noch mehr Mitspracherecht für die Bevölkerung der DDR, auch für die Brüder und Schwestern aus dem vermeintlichen Westen, der auf einmal so nahegerückt war. Ein Regierungsbeschluss besagte, dass die Entscheidungshoheit den zentralen Ämtern des Landes vorbehalten blieb, in etwa so wie ehemals in der BRD, wo so oft und gern das Grundgesetz bemüht wurde, um dem Verlangen des Volkes Nachdruck zu verschaffen. Die Volkskammer hatte bereits mit einem Beschluss reagiert, der den Menschen des Landes mehr Rechte sichern sollte, um an der Gestaltung des neuen Deutschland mitzuwirken. Die Parteistrategen vor Ort wollten das beachtet wissen, auch wenn sie sich im Angesicht des Kreuzes ein wenig hilflos fühlten und ihr Auftreten etwas an Sicherheit verlor. Sie wussten wohl, dass die Kirche vom Staat stiefmütterlich behandelt wurde, was längst nicht mehr so brutal geschah wie einst, bei weitem jedoch auch noch nicht so, wie es an der Zeit war. Populisten und Eiferer auf beiden Seiten unter dem Dach der Kirche zu vereinen, war gelinde gesagt fast unmöglich. Und nun trafen sie sich hier, in der kleinen Stadtkirche, scheinbar geläutert und befreit von all ihren Sünden, dass es Luther eine Freude sein würde. Der Pfarrer frohlockte selten zufriedener als in diesem Moment, wo alle im Kirchengestühl Platz genommen hatten, eine Kerze in den Händen hielten und miteinander so vertraut schienen, als hätte der liebe Gott höchstpersönlich eine Schar von Engeln ausgeschickt. Eine These Walther Ulbrichts, gerade noch von einem Funktionär eingestreut, verstummte ungehört. Als dann eine Stimme erklang die forderte, sich nicht dem Glauben, dem Opium des Volkes hinzugeben, schien Ärger unvermeidlich. Nun war man miteinander an jenem Punkt angelangt, der es möglich machte, Streitpunkte zu begraben. Man diskutierte ergebnisorientiert und es herrschte eine Nähe wie im Kindergarten vor, wenn die Knirpse zur Vesper beisammensaßen. Der Bericht nach Berlin, den der anwesende Bezirkssekretär noch schreiben musste, würde vielleicht länger als sonst werden und Passagen enthalten, für die vom Verfasser nachträglich eine Begründung gefordert wurde. Das wusste der Mann, der für die Arbeit der Partei im Ort und darüber hinaus zuständig war. Auf seiner Stirn, für den Bruchteil einer Sekunde im Schatten der Kreuzfigur des heiligen Georg zu sehen, gruben sich nicht ohne Grund tiefe Falten ein. Das war ein Ausdruck der anklingen ließ, welche Veränderungen bevorstanden. Im Parteikader auf Verständnis zu stoßen, sollte mit Hilfe einer gewissen Beredsamkeit durchaus möglich sein, denn auch im Zentrum der Macht hatte die Wende einen Wandel herbeigeführt, der verbissene Funktionäre als Zuhörer und Neugestalter sah. Eingedenk der Herausforderungen die noch warteten, war das ganz famos.
Die örtliche Volkspolizei bekam Besuch von Günther Liebig. Herr Liebig wollte eine Schmiererei, die sich Graffiti nannte, zur Anzeige bringen. An der Fassade der Wohnungsgenossenschaft ›Friedensglück‹ prangte eine solche und sah aus wie ein hingeschmierter Schandfleck. Nach Einschätzung von Günther Liebig hatte das mit Kunst rein Garnichts zu tun, sondern erinnerte eher an die Spätfolgen einer schlechten Erziehung und war Ausdruck einer Unlust am Leben, die im geistfreien Exzess kulminierte. Genau das widerstrebte ihm und er war wahrhaftig kein Banause ohne Kunstverstand. In dieser Hinsicht nannte er einen Sachverstand sein eigen, der ihn in die Lage versetzte, so tiefgründig und trefflich zu urteilen, dass der gemeine Kunstexperte bei ihm um Rat nachsuchen konnte. Der Abschnittsbevollmächtigte freilich orientierte sich an rein ermittlungstechnischen Aspekten der Angelegenheit, ohne auf Kunstsinnigkeit, Street Art oder dergleichen mehr zu achten, als es der Anzeigenaufnahme dienlich war. In dieser Hinsicht entsprach der ABV exakt jener Art von Verwaltungstätern, wie sie ein Staat brauchte, um die Administrative zu behaupten und Zweifel an der eigenen Arbeit im Keim zu ersticken. Herr Liebig wusste auch, wie unwahrscheinlich es war, die Urheber ausfindig zu machen. Das erwartete er auch gar nicht, wenngleich es wenigstens sein Wunsch war, dass die Schmierereien wieder von der Fassade verschwanden. Aus dem Protokoll ging hervor, wie fremd den Anwohnern die Schriftzüge und Bilder waren, wo die meisten von ihnen doch ohnehin keine Ahnung hatten, was das sollte. Der Polizeihauptmann nahm alles sorgfältig zu den Unterlagen und versah den Sachverhalt mit einer Nummer. Er zog ein Gesicht, welches nicht genau erkennen ließ, ob die Anzeige seine Zustimmung findet oder die Vielzahl neuer Fälle ihm eher eine Geste der Gleichgültigkeit entlockte. Jedenfalls fühlte sich Herr Liebig bestätigt, als er alles zu Protokoll gegeben hatte. Während seiner Laufbahn als Ingenieur und noch mit Gertrud an seiner Seite war das Leben auch nicht immer leicht gewesen, aber leichter zu ertragen. Er befand noch auf dem Revier, wie schwermütig und grüblerisch er sich manchmal fühlte und wie die Erinnerung an vergangene Zeiten ihm etwas wiederbrachte, dass er längst verloren glaubte. Unfähig, über Gefühle zu reden, schaffte er es hin und wieder, aus seinem Gefängnis auszubrechen, um sich ein kleines Stück Freiheit zu verschaffen. Im sozialistischen Realismus der Stalinzeit waren die Gelegenheiten für Extrawürste so zahlreich wie ein Volltreffer im Lotto, was nur heißen sollte, dass Günther Liebig als altgedienter Sozialist durchaus noch Träume hatte. Mit seiner Haltung zum Staat und seiner Loyalität in Fragen zum System demonstrierte er gewiss Rückgrat, doch als ein Unbeugsamer mit einer Tendenz zum Ungehorsam die ihn erschrak, war es auch nicht immer leicht. Das kam so plötzlich wie der Graffiti an der Hauswand und brachte etwas zum Ausdruck, dass er dem Polizisten verschwieg. Er hatte nun die Gewissheit, ein verantwortungsbewusster Bürger zu sein, der sich am Aufbau des Landes beteiligt und seinen Anteil dazu beigetragen hatte, Wunderwerke wie den Berliner Fernsehturm wachsen zu sehen und aus einem erfüllten Leben zu schöpfen, wie es nicht immer selbstverständlich war. Mit dieser Erkenntnis verließ Günther Liebig das Polizeirevier, wo sein Freund, der ABV, die Anzeige aktenkundig machte.
Tief im Westen, mitten im Ruhrpott, versuchte ein SED-Parteimitglied Anhänger und Sympathisanten zu werben. Seine Mission erinnerte ein wenig an die eines Wanderpredigers, der Werbung in eigener Sache macht und Menschen davon überzeugen möchte. Angefangen hatte der Genosse Martin Beyer als Mitglied der Jugendparteiorganisation FDJ. Nach wenigen Jahren intensiver Arbeit war er zum FDJ-Sekretär aufgestiegen und hatte sich in dieser Funktion bestens bewährt. Damit stand fest, dass er nicht mehr irgendjemand war, sondern ein Kandidat für die Zentrale der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Berlin. Mit Führungsarbeit kannte er sich bestens aus, mit Agitation nicht minder gut, was ihn zum idealen Botschafter der deutschen Wiedervereinigung machte, prädestiniert für praktische Überzeugungsarbeit und den Abbau von Vorurteilen. Mitten im Pott interessierte das niemanden. Die Menschen lebten weiter wie bisher, hatten ihre althergebrachte Vorstellung von Obrigkeit, ihre ganz persönliche Meinung von Parteiarbeit und vergleichsweise wenig am Hut mit der neuen Regierung aus dem Osten. Geriet die Kohleförderung einmal ins Stocken oder versiegte die Glut in einem Schmelzofen, war das weitaus schlimmer als irgendeine Politikgeschichte. Das war auch für den rührigen Genossen Beyer ein hartes Stück Arbeit. Da wo seit über einhundert Jahren der Zechengeist bestimmte was zwischen Duisburg und Essen passiert, war kein Platz für einen Politiker Made in Ostdeutschland, was Martin Beyer nicht verborgen blieb. Es kam ihm keinesfalls in den Sinn, wie eine Art Eroberer aufzutreten, um etwaige Grenzen auszuloten oder um herauszufinden, wie weit er gehen konnte, um Stimmen für seine Partei zu bekommen. Nein, das wollte er nicht. Glücklicherweise fiel die Zusammenarbeit mit den SPD-Genossen in der Gegend gleich viel konstruktiver aus. Das machte es um einiges einfacher, obwohl die Arbeiterpartei des Westens viel Vertrauen eingebüßt hatte, seit ihren Funktionären durch persönliche Eskapaden das Verständnis für gute Politik abhandengekommen war. Mit der Wende, was ein Begriff war der sich ins Gedächtnis eingebrannt hatte wie ein Ohrwurm aus dem Radio, sollte sich das ändern, doch nichts geschah. Die Seele der Region und ihrer Menschen probte gerade den Aufstand, nicht eben demonstrativ wie auf einer Politparty, eher unauffällig und aus Gründen der Zurückhaltung mehr im Verborgenen. Widerstand war auch nicht das richtige Wort, um den Zustand namhaft zu machen. Also agitierte Genosse Beyer auf verlorenem Posten und doch ließ der Mann kein Zeichen von Müdigkeit erkennen. Seines Zeichens hatte er ja schon als FDJ-Mann durch außergewöhnliche Zähigkeit geglänzt, meist dann, wenn die renitente Jugend andere Vorstellungen hatte und ein Kompromiss gefunden werden musste, der beide Seiten zufrieden sah. Dieses Prinzip brachte er auch jetzt zur Anwendung, wo es scheinbar nichts mehr gab, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Beyer selbst war es, der den Geist der Ikonen der Nachkriegszeit beschwor, die den Aktivisten hervorgebracht hatten, der in der DDR Heldenstatus genoss. Ein Mann wie Adolf Hennecke war besonders für die Kumpel und mithin den Kohleabbau eine Figur von herausragendem Interesse. Die Grundlage für seinen Vorstoß in die Vergangenheit sah Martin Beyer in der gemeinsamen Geschichte, die bis 1949 währte, auch wenn es da längst tiefe Risse gab. Er glaubte, dass er die Brücke bauen konnte, die es noch nicht gab.
Auf der Straße vor den Häusern der Genossenschaft ›Friedensglück‹ entfaltete sich die Demonstration zu Ehren des 1.Mai. Es war gerade 7 Uhr, als ein Fanfarenzug die Straße aufrollte und ins Zentrum strömte. Populäre Kampflieder, musikalisch vertont, wurden intoniert, dass es nach allen Seiten schmetterte. Im Anschluss an die Kapelle folgte ein Block FDJler nach, der Fahnen in die Höhe hielt, gelegentlich auch schwenkte. Die Stadt hatte alle Straßen im Umfeld gesperrt, kein Auto durfte sich über den Asphalt bewegen, der am Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse ausschließlich ihr vorbehalten blieb. Der Festumzug polterte ganz gewaltig herum, was nun auch nicht jedermanns Sache war. Hier und da erschöpfte das die Geduld genervter Schichtarbeiter, besserte sich aber unter dem Eindruck des stetig nachlassenden Lärms. Schon zu dieser frühen Stunde verfolgten viele Neugierige das Geschehen vom Fenster aus, insbesondere die Alten, die nicht mehr so gut zu Fuß waren. Fensterschmuck, Fahnen und Transparente schmückten die Kulisse des Feiertages und zogen sich die ganze Straße entlang. Vom Parteicharakter der Veranstaltung bemerkte man nicht viel oder erst dann etwas, wenn die Tribüne im Stadtzentrum passiert wurde. Das war der Punkt, wo sich die örtliche Parteiprominenz versammelt hatte, um die Parade abzunehmen. Der Bürgermeister stand neben dem Kreissekretär und mit ihnen ungefähr dreißig andere ausgewiesene Funktionäre in Jubelstimmung mit Festlaune. Annegret Lutze ließ es sehr viel ruhiger angehen. Sie hatte sich am Fenster ihres Wohnzimmers postiert, zunächst der Nachbarschaft zugewunken, was alljährlich zum Auftakt der Maifeierlichkeiten ein Ritual geworden war. Bis vor drei Jahren hatte sie sich noch in den Zug der Demonstranten eingereiht und sich vom Geschmetter der Pauken und Trompeten nicht abschrecken lassen. Das war nun vorbei. Sie hatte Hermann die Verantwortung übertragen, sie würdig zu vertreten, der darüber ein wenig verunsichert angenommen hatte und losgezogen war. Seine Arbeit als Postbote brachte es mit sich, dass er viele Gesichter im Menschenstrom erkannte und der Grußaustausch mit erhobener Hand an diesem Tag von einem Fähnchen begleitet wurde. Frau Lutze drängte sich, ihm ein Stück weit nachzusehen, bis er hinter der nächsten Kurve aus ihrem Sichtfeld verschwand. Das dauerte sie kein bisschen, fühlte sie sich doch gut vertreten. Die lebendige Untermalung durch das Fanfarenorchester ging nicht verloren, sondern unterhielt auch aus der Ferne noch langanhaltend und intensiv. Alles was sie brauchte war eine Zigarette, weil sie sich der Aufregung einfach nicht entziehen konnte. Man mochte es nicht für möglich halten, doch tief in ihr fielen dutzende Erinnerungen mit diesem Tag zusammen. Fürwahr als solcher schon besonders, für sie tatsächlich aber noch weitaus besonderer aufgrund so vieler Dinge. In ihren Augen stiegen stets Tränen auf und sie musste sich etwas aus dem Fenster zurückziehen, weil sie nicht wollte, dass es jemand sah. Ein Strauß roter Nelken hatte sie angestiftet, Hermann noch eine mit auf den Weg zu geben, damit er dem Anlass entsprechend aufwarten konnte. Die übrigen Nelken zierten ihren Couchtisch mit Köpfen so rot wie Arbeiterblut. Frau Lutze saß lange davor, hörte die Klänge von der Straße hinaufsteigen, bis ein Anflug von Müdigkeit ihre Glieder ergriff.
Der Abschnittsbevollmächtigte hatte alle Hebel in Gang gesetzt, um die Sprayer dingfest zu machen. In seinem Amtszimmer mit dem bekannten Portrait von Erich Honecker zeigte sich aber, dass bei den Ermittlungen keine Fortschritte gemacht wurden. Ein Umstand, der ihm schwer zu schaffen machte. In fünfundzwanzig Dienstjahren waren ihm nur zwei Fälle untergekommen, die er nicht aufklären konnte. Dieser nun, noch dazu von so einem stadtbekannten Einwohner zur Anzeige gebracht, schien der dritte zu werden. Das sorgte bei ihm für eine gehörige Anspannung. In den wöchentlichen Dienstberatungen interessierten sich alle nur noch für die Veränderungen im Land und diskutierten eifrig, wie es weitergehen mochte. Er in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter musste mit der Einsicht leben, vergleichsweise viel allein zu sein. Doch Jammern lag ihm fern. Für einen Hauptmann der Deutschen Volkspolizei stand Klagen hintenan und auch wenn er sich mit dem Rest der Welt anlegen musste war das immer noch besser, als aufzugeben. Die verdammten Sprayer waren einfach überall in der Stadt. Der ABV fürchtete verspottet zu werden und quälte sich durch das Einmaleins ermittlungstaktischer Ansätze, die eigentlich schon ins Ressort der Kripo gehörten. Die Kollegen da hatten allerdings selbst alle Hände voll zu tun. Für vermeintliche Bagatellen wie vollgeschmierte Wände hatten sie selten mehr als ein Achselzucken übrig. Der Streifendienst war angehalten, die Augen offen zu halten und sich unnachgiebig zu zeigen für den Fall, dass ein Straftäter gestellt wurde. Vandalismus und schwere Sachbeschädigung waren nach dem Gesetz der DDR keine Kleinigkeiten. Für alle Fragen, die sich aus den Ermittlungen ergaben und für seine Ehre als Polizeihauptmann war es unabdingbar, die getroffenen Maßnahmen auszuweiten und Vorsorge zu treffen, damit eine Ermittlungspanne vermieden wird. Wie das gehen sollte, wusste der ABV auch nicht. Er glaubte gerade so etwas wie eine Wendepsychose zu erleben und verstieg sich zu der Annahme, dass Polizeikräfte der Ex-BRD sein Selbstverständnis als guter Polizist torpedieren wollten. In dieser und anderen verdrießlichen Situationen hatte es sich immer bewährt, eine gute Flasche Schnaps im Schreibtisch zu haben, denn das war bekanntermaßen das bewährteste aller Hausmittel gegen Frustration und ergebnislosen Arbeitsaufwand. Der Staat, das Land und überhaupt alles, was in der DDR in die Zuständigkeit der Behörden fiel, musste mit unerschöpflicher Energie unterstützt werden wie die zielstrebige Arbeit, die zur Niederwerfung des Klassengegners geführt hatte. Für den Abschnittsbevollmächtigten bestand daran überhaupt kein Zweifel. Wenn man jugendliche Täter verfolgte, und davon ging er aus, bräuchten sie das Netz vielleicht nur noch ein wenig engmaschiger auslegen, um Erfolg zu haben. Alles andere wäre eine Schande und weil er es nicht besser wusste, spülte der Hauptmann einen Schnaps hinunter. Die kleine Stadt am Fuße des Erzgebirges, seine Stadt, würde ein Hort gesetzestreuer Bürger bleiben, auch wenn durch die Wiedervereinigung der Schmutz des Westens nach Osten drängte und es jemanden brauchte, der für Recht und Ordnung sorgte. Er war dieser Jemand, der unter dem Portrait des Alterspräsidenten der Volkskammer seine grauen Zellen malträtierte und nicht zulassen wollte, dass aus zwei ungelösten Fällen drei wurden. Nach dieser Maßgabe wollte er den Fall weiterverfolgen und am Ende triumphieren.
In der Berliner Parteizentrale trieb man den Prozess der Wiedervereinigung energisch voran. Im Regierungssitz herrschte hektische Aktivität vor, die bisweilen ein wenig übertrieben erschien, denn im Grunde war alles geregelt. Für eine Delegation aus Bonn standen alle Türen offen. Die Unterhändler aus der ehemaligen Hauptstadt der nicht mehr existenten BRD wurden mit respektvoller Hochachtung empfangen. Der Generalsekretär der SED sah es als seine Pflicht an, die Herrschaften gebührend zu empfangen, auch wenn der ehemalige Bundeskanzler nicht unter ihnen war. Mit seiner Abwesenheit sollte sichergestellt werden, dass sich keine neuen Hürden aufbauen und der ohnehin schwierige Einigungsvorgang unnötig Verzögerung erfährt. Als die schwarzen Limousinen vorfuhren, war der rote Teppich bereits ausgerollt, wenngleich es kein Protokoll gab, das Unterhändlern diese Ehre zugedachte. In diesem Fall machte man eine Ausnahme und wollte so der Bedeutung des Treffens gerecht werden. Nach einigen Formalitäten, die keiner weiteren Erwähnung bedürfen, saß man schließlich beisammen und fühlte förmlich, wie die Atmosphäre gefror. Erst als die DDR-Führung an die Bedeutung des Treffens erinnerte, kehrte Leben in die versteinerten Mienen der westdeutschen Unterhändler zurück, die nach der Einnahme ihrer Plätze stur geschwiegen hatten. Ein Lächeln des Generalsekretärs konnte sie zunächst auch nicht erweichen, doch dann erinnerten sie sich wieder an den Grund ihrer Anwesenheit. Der Einigungsvertrag war besiegelt und es ging nur noch um die Einhaltung von Verbindlichkeiten, die zur Disposition standen. Der Strukturwandel verbunden mit dem Umbau der Behörden war in vollem Gange. In den Ämtern der Ex-BRD hatten sich bereits DDR-Funktionäre eingearbeitet und erste Beschlüsse zur Neuordnung der Administrative veranlasst. Da wo Beflaggung zur Vorschrift gehörte, wehte nicht mehr Schwarz-Rot-Gold am Fahnenmast, sondern Hammer und Zirkel und Ährenkranz im Zeichen des Arbeiter- und Bauernstaates. Es war ein Erlebnis in Hamburg, Köln, Stuttgart oder München der Verabschiedung von der Kapitalgesellschaft beizuwohnen und emsigen Funktionären wie Martin Beyer bei der Arbeit zuzusehen, die das umsetzten, was für den Staatsumbau notwendig war. Im Berliner Regierungssitz aber krampfte es noch gehörig unter dem Eindruck von Vorbehalten seitens der Unterhändler eines Kanzlers ohne Amtsgewalt. Einen Moment schien die Atmosphäre vergiftet, im nächsten machte man Zugeständnisse und wieder fünf Minuten später schob ein Witz die zähen Verhandlungen erfolgreich an. Die Mauern des Staatsratsgebäudes hatten so etwas noch nicht erlebt. Auf Anfrage von Journalisten wurden keine Informationen weitergegeben, weil man die Verhandlungen so lange geheim halten wollte, bis eine Unterschrift die vorbereiteten Verträge rechtskräftig bestätigte. Die deutschen Bemühungen um die staatliche Einheit wurden auch weiterhin vom Ausland aufmerksam verfolgt. Russland und die USA hatten die DDR ermächtigt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Druck auszuüben und allen Bemühungen, die zu einer Verzögerung des Einigungsprozesses beitrugen, eine Abfuhr zu erteilen. Das sah die DDR-Regierung als Bestätigung ihrer Arbeit an. Während dessen schritt auch der Abriss der Berliner Mauer voran und bescherte der Stadt einen Zuwachs von Touristen aus aller Welt, die dem Ereignis beiwohnen wollten. Den Alterspräsidenten der Volkskammer, der den Urheber des Mauerbaus noch kannte, kostete es Überwindung und viele Stunden des Nachdenkens, um damit klarzukommen. Das war die neue Zeit, die Deutschland wiedervereint sah, diesseits aller Sorgen und Nöte.
Hermann Schreiner war von der Kundgebung zum 1. Mai heimgekehrt. Den Rest des Tages wollte er ohne Stress verbringen. Draußen herrschte wieder Ruhe vor, die Fanfaren und Trompeten waren verstummt. Gern hätte er sich eine Folge von ›Zu Besuch im Märchenland‹ angesehen oder eine Episode aus ›Barfuß ins Bett‹. Pittiplatsch, Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster hießen die Helden seiner Kindertage und er sah sie noch immer unglaublich gern. Leider lief nichts von alldem und der hochheilige Videorekorder war kaputt. Das lustige Geplapper von Schnattchen und Pitti musste er dennoch nicht vermissen, denn er hatte ihre Stimmen im Kopf. Natürlich auch die leicht kratzige von Herrn Fuchs und die hochtönende von Frau Elster, die sich immer anhörte, als spräche aus ihr die ganze Vornehmheit der Oberschicht des Märchenwaldes. Zwei ungemein unterhaltsame Paare, die Hermann alle Langeweile vergessen ließen, auch wenn er ihnen gerade nicht zusehen konnte. Der entspannende, gepflegte Nachmittag auf dem Sofa war wirklich eine durchaus angenehme Angelegenheit, die Steigerungsstufen bereithielt. Er konnte bequem seine Briefmarkenalben einsehen, dabei auf einem Auge fernsehen und sich gleichzeitig glücklich schätzen, so einen ungemein gut gefüllten Kühlschrank sein Eigen zu nennen. Diese Offerte war wahrhaftig verführerisch, besonders dann, wenn er frisch gekocht, vorgekocht oder etwas zum Aufwärmen in den Backofen gestellt hatte. Die Versorgung mit Lebensmitteln war gesichert, auch wenn es noch nicht lange her war, dass es nicht immer alles gab. Ohnehin war das kein Thema mehr, seit die großen Handelsketten dafür sorgten, dass die Regale gefüllt waren. Hermann hatte den schleichenden Übergang zur Konsumgesellschaft sehr wohl bemerkt und die Verwandlung der Geschäfte miterlebt wie alle anderen im Ort, die bei ihrem Einkauf neue Marken ausprobierten. Die Mark der DDR war landesweites Zahlungsmittel, was dem Aufschwung einen gehörigen Auftrieb verschaffte, zumal die ehemals belächelte Währung jetzt internationale Kaufkraft hatte. Das bewog Hermann zu der Annahme, einen weiteren Anstieg der Wirtschaftskraft zu beobachten, dass selbst der letzte Verfechter der D-Mark nasse Füße bekommen musste. Die politische Realität war eben kein Märchenland und oftmals so schwer verständlich, dass selbst der sozialistische Realismus viel Zeit aufwenden musste, um Erfolge greifbar zu machen. Doch der 1. Mai war heilig. Genau darin lag der Unterschied zweier Systeme, von denen ursprünglich nur das eine Ambitionen hegte, Deutschland wieder zu vereinen, während das andere im Schulterschluss mit der unbesiegbaren Sowjetunion an der Teilung festhalten wollte. Die Kraft der Arbeiterklasse war ungebrochen aus allen Kämpfen hervorgegangen und einem fähigen Geheimdienst war nicht entgangen, wie verwundbar der Westen im Stillstand verharrte. Hermann wusste auf einmal gar nichts mehr, außer dass er sich reichlich benommen vorkam und sich plötzlich schrecklich müde fühlte. Das große Stück Tradition, das die Nelke im Knopfloch an seiner Jacke beschwor, war in jeder Hinsicht lebendig. Anfangs tat er sich schwer damit, Frau Lutze danke zu sagen, wenn sie ihm etwas mit auf den Weg gab. Inzwischen machte er es beinah regelmäßig und wenn auch nicht immer, so doch meistens. Die in Ehren ergrauten Veteranen im Haus, dachte Hermann, waren schon eine Klasse für sich. Frau Lutze und Herr Liebig ganz besonders.
Im Städtischen Kaufhaus von Karl-Marx-Stadt drängten sich Gäste und Touristen aus den neuen Bundesländern. Manche kamen aus Bayern, andere aus Hessen und wieder andere aus Niedersachsen. Sie bestaunten den Reichtum in den Schaufenstern und Auslagen wie das achte Weltwunder. Gemessen an den ehemals dürftigen Konsumverhältnissen in der DDR packte sie fast der pure Neid auf das, was sie da sahen. Wiederum froh darüber in diesem Luxus zu schwelgen, waren sie es auch, die sich die Taschen vollstopften und mit glückseligem Lächeln von einer Etage auf die andere wechselten. Ihre Marotte, alles was sie interessierte auch einmal anzufassen, schuf eine Berührungsorgie von nie dagewesener Intensität. Viele von ihnen trugen eine gesunde Mallorca-Bräune, die sehr gut zu den teuren, meist goldfarbenen Brillengestellen passte, welche viele der Konsumenten auf der Nase trugen und bereitwillig zur Schau stellten. Das war insgesamt eine vollkommen neue Erfahrung für die Mitarbeiter des Kaufhauses. Seit in der ehemaligen Zone alles für Besuche offenstand und die Vorbehalte fielen, war die anfängliche Distanz gewichen und es gab sogar schon Stammkunden. Nicht alles lief reibungslos ab. Für Zwischenfälle stand Sicherheitspersonal bereit, das bei verschiedenen Gelegenheiten aktiv wurde, sobald es zu Wortgefechten kam oder darüber hinaus die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung bestand. Karl-Marx-Stadt verstand sich als Stadt sozialistischer Kultur und Lebensart und behandelte solche Vorgänge so, wie es das Gesetz der DDR vorsah. Trotzdem lobte man kein Kopfgeld auf notorische Kaufhausrowdys aus, nur um Stärke zu demonstrieren. Und es gehörte nicht zu den Gepflogenheiten, gleich Drohgebärden auszusenden. Im Mittel entfaltete sich ein Klima der wechselseitigen Akzeptanz und Rücksichtnahme. Dass Plus der dickeren Geldbeutel kursierte freilich schon beim gutbetuchten Publikum aus den alten Bundesländern, was nicht hieß, dass jeder von ihnen ein Wessi der übelsten Sorte war. Die zarte Pflanze der Menschlichkeit blühte hier und da schon verheißungsvoll, schuf grenzüberschreitende Nähe wo noch Minenfelder versteckt waren, setzte Gewehrmündungen rote Nelken auf und baute täglich ein Stück an der Brücke, die den Graben überwinden sollte, der sich zwischen West und Ost erstreckte und seine tiefe, alles verschlingende Abgründigkeit nicht so leicht aufgeben wollte. Nah an der Grenze zum Erzgebirge hatte sich da mit Karl-Marx-Stadt ein urbanes Zentrum profiliert, um der Wiedervereinigung wichtige Impulse zu geben. Es geschah im Beisein des ›Nischel‹, so als würde Karl Marx persönlich Regie führen und wie ein Dirigent den Taktstock schwingen. Im Städtischen Kaufhaus thematisierte das Publikum den überdimensionalen Steinschädel, machte ihn zum Gesprächsthema neben Bonn und Berlin und stellte voller Freude fest, dass Marx gar nicht so verkehrt war. Die Annalen des Marxismus-Leninismus hatten es aber glücklicherweise nicht bis ins kaufhauseigene Restaurant geschafft, wo der politische Diskurs zwar nicht verboten war, nach Ansicht des Chefs allerdings nichts zu suchen hatte. Das machte er unmissverständlich klar, sobald im Widerstreit der Meinungen der politische Korpsgeist erwachte und im Verbund mit Leidenschaft eine Politposse drohte. Für den gemütlichen Erzgebirgler, der, wenn er die Berge verließ, um in den Niederungen einkaufen zu gehen, oft Karl-Marx-Stadt zum Ziel erwählte, eröffnete sich eine ganz andere Sicht. Vielfach war dann die Rede vom Holzmichl. Darüber konnte man auch mit Menschen von drüben gut ins Gespräch kommen. Das war schon wieder ein Politikum jenseits der Politik und aller Verbindlichkeiten, die gerade aktuell waren.
Für den Tag und die Stunde gestaltete sich das Weltgeschehen aus deutscher Sicht absolut zufriedenstellend. Martin Beyer hatte das Ruhrgebiet verlassen und sich in Richtung Norden aufgemacht. Er wollte Hamburg einen Besuch abstatten. Die Hansestadt symbolisierte für ihn ein Tor zur Welt und so war es ja auch. Der Fischmarkt und die Landungsbrücken, die Elbwiesen, St. Pauli und das Hafenviertel gehörten dazu, andernorts Blankenese und Harvestehude und natürlich der HSV. Im Politikjargon wie allgemein wurden die Nordlichter als kühler, reservierter Menschenschlag beschrieben, den Genosse Beyer näher kennenlernen wollte. Seine Parteikarriere hätte niemals ohne Helmut Schmidt stattgefunden, der Anfang der achtziger Jahre zu einem Besuch in der DDR weilte. Es war ein Parteitreffen der inoffiziellen Art, kein Staatsbesuch, einem solchen aber nicht ganz unähnlich. Der Sozialdemokrat aus der BRD war ein politisches Schwergewicht und hatte als ehemaliger Kanzler unter harten Bedingungen regiert. Für Martin Beyer verkörperte der Mann mit der Schiffermütze den Inbegriff eines redegewandten und rhetorisch ungemein begabten Politikers. Er als Ostdeutscher auf der Suche nach einem politischen Vorbild war bei Schmidt hängen geblieben, den viele Menschen nur beim Vornamen nannten, weil er zumindest im Norden eine gewisse Nähe zum Volk genoss. Aber das war zweitrangig und verblasste neben seinen Fähigkeiten als Wirtschaftsfachmann, der genau wusste, mit welchen Schwierigkeiten die DDR in dieser Hinsicht zu kämpfen hatte. Im Zentralrat der SED, da wo Martin Beyer ein- und ausging, oblag es nicht ihm zu entscheiden, ob Politiker vom Schlage eines Schmidt positiv auf die DDR wirken. Für die Zyniker im Volk, die dort nur alte Männer vermuteten, die graue Bärte trugen und wie Merlin mit visionärer Energie das Orakel in der Glaskugel befragten, war klar, dass man es mit Versagern zu tun hatte. In Wirklichkeit operierte dort ein Stab gebildeter Männer, die zwar alt waren, aber nicht dumm, so wie es in der Westpresse gerne dargestellt wurde. Für Martin Beyer stand fest, dass Helmut Schmidt dort Teil einer Zielgruppe war, von der die DDR lernte ihre politischen Möglichkeiten weiter zu entwickeln, nicht versäumte sich zu profilieren, um auf dem internationalen Parkett zu überzeugen. Er wusste auch, dass zu viel Politik schlecht für die Volksnähe war und der größte Teil an Sympathien durch Tatkraft gewonnen wurde. Im Pott, da wo die Städte einen Herzschlag aus Stahl hatten und den Menschen ›Glück auf‹ mehr bedeutete als politischer Kauderwelsch, hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie das zutraf. Aber Schmidt konnte er nicht in den Ruhrpott kopieren, um seine Vorstellung von politischer Arbeit umzusetzen und für die Nordlichter war er ein Unbekannter aus dem Osten, der auf irgendeiner Mission sein Glück versuchte. Die Probleme waren also mannigfaltig, der Auftrag dagegen klar: Der neuen deutschen Wirklichkeit die Zukunft ebnen! Im Berliner Politikleben herrschten wieder ganz andere Gesetze vor, die auf der Reeperbahn so populär waren wie Freier ohne Bargeld. Im Strudel der Wiedervereinigung hatte Martin Beyer trotzdem nie den Durchblick verloren und das hatte ihn vor groben Fehleinschätzungen bewahrt. Dank seiner Verehrung für Schmidt musste er sich Gepolter gefallen lassen, weil man ihm die Nummer nicht abnehmen wollte. Hoch im Norden schienen die Zeichen eher auf Sturm zu stehen und das war für diese Region nicht ungewöhnlich. Doch Genosse Beyer war zäh wie ein Hamburger Hafenarbeiter und mit dem Mundwerk auch nicht hinterher. Das machte ihn in den Augen der Partei zur Idealbesetzung für die politische Agitation in den neuen, nunmehr zur DDR gehörenden Gebieten westwärts der ehemaligen Zonengrenze samt ihrer sechzig Millionen Einwohner, die den Niedergang Bonns aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erlebten. Niemand wusste, wie die BRD umgestaltet werden sollte, keiner kannte Honecker und ganz nebenbei gab es Martin Beyer, der ein bisschen wie Helmut Schmidt sein wollte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.