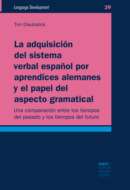Kitabı oku: «Satzinterpretationsstrategien mehr- und einsprachiger Kinder im Deutschen», sayfa 2
1.2 Aufbau
Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. In ersterem werden zunächst in Kapitel 2 die beiden im Fokus stehenden grammatischen Mittel Wortstellung und Kasusmarker in Hinblick auf ihr Vorkommen und ihre Funktion als Kodierungsformen für semantische Relationen in den drei relevanten Sprachen (Deutsch, Russisch und Niederländisch) erläutert. Eingebettet ist die Diskussion der grammatischen Formen in eine funktionalistische Sicht auf Sprachgebrauch und -entwicklung. Dieser grundlegenden Gegenstandsanalyse folgt in Kapitel 3 die Darstellung der cue strength von Wortstellung, Kasusmarkern und Belebtheit bei der Satzverarbeitung bei ein- und mehrsprachigen Sprechern. Im Zuge dieses Forschungsüberblicks wird auch das Competition Model erläutert und eingeordnet. Ergänzt ist der Überblick um Erkenntnisse zum Erwerb transitiver Satzschemata und Kasusmarker im Deutschen.
Die theoretische und methodische Beleuchtung sprachentwicklungsrelevanter Fragestellungen mündet schließlich in den zweiten Teil der Arbeit, der die Empirie umfasst. Dazu werden zunächst in Kapitel 4 die Fragestellungen, das experimentelle Testdesign sowie die der Arbeit zugrundeliegenden Hypothesen vorgestellt. Kapitel 5 enthält schließlich die Ergebnisdarstellung und -analyse. Die Arbeit schließt mit einer Ergebnisdiskussion (Kapitel 6) sowie einem Ausblick (Kapitel 7).
2 Kasusmarker, Wortstellung und semantische Relationen – eine kontrastive Perspektive
Sprachen bedienen sich unterschiedlicher Kodierungsmechanismen zum ‚Verpacken‘ (mapping) semantischer Relationen. Für mehr- und einsprachige Sprecher bedeutet dies, dass sie die einzelsprachlichen Kodes identifizieren und lernen müssen. Daran anknüpfend stellt sich die Frage, ob mehrsprachige Kinder L1-spezifische Kodes (oder cues, s. Kapitel 3) auf die Satzverarbeitung in der L2 Deutsch übertragen. Bevor also erläutert werden kann, welche cues für welche Lerner im Deutschen wann besonders wichtig sind und ob tatsächlich die Existenz eines mapping-Transfers plausibel ist, muss geklärt werden, über welche Kodierungsformen die für die vorliegende Untersuchung relevanten Sprachen überhaupt verfügen. Im Folgenden wird deshalb skizziert, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede das Deutsche, das Niederländische und das Russiche hinsichtlich der Kodierung semantischer Relationen aufweisen. Die Gegenstandsbeschreibung erfolgt hierbei im Sinne des funktionalen Prinzips. Zum besseren Verständnis geht der Gegenstandsbeschreibung zunächst die Erläuterung von Grundannahmen der funktionalen Linguistik voran.
2.1 Funktionalistische Ansätze: Theoretische Prämissen
Die Annahme, dass Formen und Funktionen in einer interdependenten Beziehung zueinander stehen und dass formale Strukturen funktional motiviert sind, bildet die Basis funktional-linguistischer Ansätze. Die funktionale Linguistik geht davon aus, dass „Sprache nicht isoliert, sondern nur in Beziehung zu ihrer Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation erforscht werden kann“ (Smirnova/Mortelmans 2010: 13, vgl. auch Bischoff/Jany 2013). Die Analyse sprachlicher Strukturen erfolgt dabei stets in Hinblick auf die Funktionen, die sprachliche Mittel und Formen kommunikativ und kognitiv erfüllen. Die Betrachtung sprachlicher Systematiken als Abbildung kommunikativer Absichten sowie semantischer Konzepte ist der Ausgangspunkt jeglicher funktional motivierter Beschreibungskonventionen.
Die Grundidee der funktionalen Linguistik geht auf die Prager Schule der 20er Jahre zurück. Das funktionalistische Credo – „functions are embodied in structures“ (Tomasello 1998: xvi) – impliziert, dass Sprecher in Kommunikationssituationen vor der Herausforderung stehen, komplexe kommunikative Einheiten in ein lineares sprachliches System zu ‚verpacken‘. Grammatische Strukturen dienen also dieser ‚Verpackung‘ (vgl. Daneš 1987) und strukturieren die verbale Interaktion zwischen Sprecher und Hörer. Langacker (1998: 1) fasst die Funktionen sprachlicher Systeme mit den Begriffen semiological function und interactive function zusammen. Einerseits können durch den Gebrauch sprachlicher Mittel Gedanken und Konzepte symbolisiert werden, andererseits stellen diese Mittel Kommunikation überhaupt erst sicher. Die daraus resultierende Abbildung von Form auf Inhalt und Inhalt auf Form wird im Rahmen funktionalistischer Ansätze und Modelle als mapping (auch direct mapping beziehungsweise form-function mapping) bezeichnet. Die Verknüpfung zwischen sprachlicher Form und außersprachlichem Inhalt ist dabei genuin symbolisch. Die konkrete äußere Form ist Bates/MacWhinney (1989: 18) zufolge zwar arbiträr, ihre funktionale Motivation ist von dieser rein formalen Arbitrarität jedoch nicht betroffen. Sprachgebrauch, -verarbeitung und -lernen muss deshalb als ein kontinuierliches Ent- und Verpacken beziehungsweise Denotieren und Konnotieren von Formen und Funktionen verstanden werden.
Problematisch bei einer funktionalistischen Betrachtung von Sprache ist zunächst die fehlende theoretische Basis. Es existiert keine einheitliche zugrunde liegende funktionalistische Theorie, vielmehr stehen unterschiedliche Ansätze mehr oder weniger lose nebeneinander, die funktionalistische Annahmen teilen. Ausgehend von einer grundlegenden funktionalen Perspektive auf Sprachgebrauch können unterschiedliche theoretische Positionen ausgemacht werden, die den Funktionsbegriff auf unterschiedliche sprachliche Ebenen anwenden. Eine dieser Positionen ist die Funktionale Grammatik von Dik (Dik 21997). Das primäre Ziel Diks ist es, grammatische Regularitäten auf semantischer, phonologischer, morphologischer und syntaktischer Ebene mit pragmatischen Regularitäten im Sprachgebrauch zu verknüpfen. Diks Grundannahme ist dabei, dass die Pragmatik die hierarchiehöchste Ebene sei: „the basic requirement of the functional paradigm is that linguistic expressions should be described and explained in terms of the general framework provided by the pragmatic system of verbal interaction“ (Dik 21997: 4). Das grammatische Regelsystem ist vor dem Hintergrund dieser Prämisse deshalb auch ein Resultat beziehungsweise eine Abbildung pragmatischer Faktoren. Bezogen auf die Struktur von Sätzen folgert Dik unter anderem, dass Konstituentenabfolgen ein Mittel für den Ausdruck spezifischer Relationen seien (vgl. ebd.: 392f.). Eine Veränderung der Konstituentenfolge ist deshalb auch Resultat eines kontextuell und pragmatisch gebundenen Relationsausdrucks. Wenn es also darum gehen soll, den Sprecher und sein Sprachverhalten zu untersuchen, müsse das primäre Ziel zunächst die Analyse pragmatischer Faktoren und erst danach die systematische Betrachtung der sprachlichen Oberfläche sein (vgl. auch Smirnova/Mortelmans 2010: 18). Während Diks Ansatz als umfassender Versuch betrachtet werden kann, alle sprachlichen Ebenen zu integrieren, beziehen sich andere Ansätze auf spezifische Sprachbereiche. Tyler (2010) differenziert dazu zwischen systemisch-funktionalen Ansätzen, zu denen vor allem Halliday/Matthiesen (32004) zu zählen sind, dem Diskursfunktionalismus (vor allem Givón 1995) und kognitiven Ansätzen, zu denen neben der Kognitiven Grammatik (Langacker 1987, 1991, 2008) vor allem die Konstruktionsgrammatik (Croft 2001, Fillmore/Kay/O’Connor 1988, Goldberg 1995) gehört. Trotz ihres gemeinsamen funktionalen Blicks auf Sprache, wenden die jeweiligen theoretischen Ansätze den Terminus der Funktion auf unterschiedliche Aspekte von Sprache an. So steht im von Halliday geprägten systemisch-funktionalen Ansatz die situationsbedingte Kommunikationsabsicht und auf analytischer Ebene die Systematisierung kontextspezifischer sprachlicher Mittel im Fokus. Bekannt geworden ist dieser Zugang durch die Register- und Stilforschung. Betrachtet werden dabei zum Beispiel situationsbedingte soziale Relationen zwischen Gesprächspartnern, deren Strukturen sich jeweils auch an der sprachlichen Oberfläche abbilden.
Tyler (2010) zufolge ist auch der von Givón geprägte diskursanalytische Funktionalismus eng an das Ziel angelehnt, Sprachgebrauch aus einer situationsspezifischen Perspektive auszuleuchten. Givóns Erweiterung im Vergleich zu Halliday bestehe jedoch darin, kognitive Prozesse und mental repräsentierte Konzepte in die Analyse sprachlicher Strukturen einzubeziehen (ebd.). Während beispielsweise der Halliday’sche Ansatz untersucht, an welchen Stellen im Diskurs welche syntaktischen Thema-Rhema-Strukturen vorkommen, versucht der Givón’sche Ansatz zu beantworten, wie spezifische syntaktische Strukturen anhand kognitiver Prinzipien erklärt werden können. Zentral ist in diesem Zusammenhang der von Givón gebrauchte Begriff der Ikonizität beziehungsweise Meta-Ikonizität (Givón 1995: 58f.). Gemeint ist damit, dass sich zum Beispiel spezifische Handlungsabläufe in einer entsprechenden syntaktischen Struktur abbilden. Givón nimmt eine natürliche, jedoch nicht zwingende Korrelation zwischen Inhalt und Ausdruck an und geht dabei von einer Isomorphie zwischen Form und Inhalt aus. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen transitive syntaktische Strukturen, die er als Abbildung eines kausal-linearen Handlungsverlaufs betrachtet (s. auch Kapitel 2.3). Im Blick steht ein kanonisches Handlungsmuster, in dem ein belebtes Individuum auf ein Gegenüber oder ein Objekt einwirkt. Die kausale Relation, die so entsteht, bildet sich schließlich syntaktisch so ab, dass der Handlungsträger in der linearen Satzstruktur zuerst und der von der Handlung Betroffene darauffolgend genannt wird. Eine kausale Handlungskette des Typs ‚Handlungsträger → von der Handlung Betroffener‘ mündet schließlich in einem Satz des Typs Nomen – Verb – Nomen (NVN) oder Nomen – Nomen – Verb (NNV). Die syntaktische Struktur ist somit die ikonische Abbildung abstrahierter Handlungsmuster, die wiederum kognitiv abstrakt repräsentiert sind.
Givóns Analysen zu syntaktischen Mustern sowie zu Thema-Rhema-Strukturen bilden unter anderem die Grundlage für kognitiv basierte funktionale Ansätze. Eine der zentralen Grammatiktheorien, die die Givón’schen Überlegungen systematisch weiterentwickelt, ist die Konstruktionsgrammatik (Fillmore 1988, Fillmore/Kay/O’Connor 1988, Goldberg 1995). Konstruktionen sind dabei Form-Inhalts-Paare, deren Gesamtdeutung nicht auf der Basis einzelner Komponenten abgeleitet werden kann (vgl. Goldberg 1995: 4). Die syntaktischen Muster, auf die sich die Analysen von Fillmore sowie Goldberg beziehen, zeichnen sich durch einzelsprachlich konventionalisierte interne und externe Eigenschaften (vgl. Fillmore 1988: 36) aus. Das erwähnte syntaktische Muster (NVN) wäre solch ein Form-Inhalts-Paar mit spezifischen externen und internen Merkmalen, das als transitive Konstruktion eingestuft wird. Diese transitive Konstruktion zeichnet sich im Deutschen durch eine kontextuell bedingte Konstituentenabfolge aus und kann dabei zwischen NVN, NNV oder VNN variieren. In kanonischen Bedingungen verweist die erste NP (N1) auf den Handlungsträger und die zweite (N2) auf einen von der Handlung betroffenen Aktanten. Die syntaktische Struktur kodiert damit unabhängig vom ‚Füllmaterial‘, das heißt von spezifischen Lexemen, einen spezifischen Handlungsrahmen. Die Konstruktionsgrammtik legt damit wie auch andere Ansätze den Fokus auf den Zusammenhang spezifischer semantischer Relationen und ihrer ‚Sichtbarkeit‘ in syntaktischen sowie morphologischen und phonologischen Mustern und betrachtet diese Muster als Kernbestandteil einzelsprachlicher Grammatiken.
Die Konstruktionsgrammatik orientiert sich insofern an Prinzipien der Kognitiven Grammatik, als sie annimmt, dass Sprecher über spezifische kognitive Fähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglichen, Sprache als System zu erlernen, zu gebrauchen und zu verändern. Insbesondere für den Spracherwerb gilt dabei, dass mithilfe dieser Fähigkeiten der sprachliche Input gewissermaßen nach wiederkehrenden bedeutungstragenden Mustern analysiert wird. Das Finden und Verwenden dieser Muster bildet dann auch die Basis für die sprachliche Entwicklung. Zu diesen Fähigkeiten gehören vor allem die Kategorienbildung, Klassifikation, Analogiebildung und Abstraktion (vgl. Langacker 2000a), die domänenübergreifend arbeiten und in jedem Bereich des Wissenserwerbs und damit auch – jedoch nicht nur – beim Sprachlernen und Sprachverwenden zum Einsatz kommen. Regularitäten (und damit auch Konstruktionen) im grammatischen System wären im Sinne der Kognitiven Grammatik das Resultat von Kategorisierungs- und Analogisierungsverfahren. Die kognitive Kategorienbildung bildet sich entsprechend an der sprachlichen Oberfläche und damit im Sprachgebrauch ab. Das Vorhandensein abstrakter Einheiten wie der oben beschriebenen Konstruktionen ist Resultat dieser Kategorien- und Analogiebildung und mündet in abstrakte Muster, die nicht nur Sprachverarbeitung und -produktion, sondern sprachliche Entwicklungsprozesse steuern. Linguistische Analysen verfolgen im Kontext der Kognitiven Grammatik damit das Ziel, Muster aufzufinden und davon ausgehend Rückschlüsse auf kognitive Strukturen und Mechanismen zu ziehen.
Funktionalistische Ansätze teilen weiterhin die Annahme, dass grammatische Charakteristika von Sprache auf Interaktion, also dem Sprachgebrauch, fußen und rücken somit den Sprecher und seinen Umgang mit sprachlichen Strukturen ins Zentrum ihrer Analyse. Die empirisch basierte Hinwendung zum Sprecher mündet schließlich in die sogenannten usage-based models (vgl. Barlow/Kemmer 2000, Bybee/Hopper 2001), die auf der Basis einer sprachgebrauchsbasierten Analyse Aussagen zu unterschiedlichen Untersuchungsfeldern der Linguistik (zum Beispiel Spracherwerb oder Sprachwandel) machen wollen. Die gebrauchsbasierte Komponente ist im Kontext der funktionalen Linguistik essentiell, wobei die zum Einsatz kommende Methode zur Identifikation gebrauchsspezifischer Effekte auf das sprachliche System und auf sprachliches Wissen vom konkreten funktionalistischen Ansatz abhängig sein kann. So liegt es zum Beispiel nahe, Registervarianz und im Register verwendete sprachliche Mittel auf der Basis natürlicher Interaktion zu analysieren. Geht es hingegen um die Frage, wie spezifische grammatische Muster kognitiv repräsentiert sind, eignen sich Elizitationsverfahren oder experimentelle Methoden, die zum Beispiel Aufschluss darüber geben, mit welchen Inhalten einzelne grammatische Formen verknüpft werden. Funktionalistische Ansätze bringen folglich drei primäre Komponenten mit sich. Sie verbinden formalsprachliche Charakteristika mit kommunikativen und kognitiven Funktionen, sie sind sprecher- und damit gebrauchsorientiert und sie haben den Anspruch, ihre Erkenntnisse empirisch zu fundieren.
Der Begriff Funktion ist insgesamt relativ ambig und nicht klar definiert. Daneš (1987: 4) führt diesen Umstand auf das Versäumnis zurück, im Laufe der Begründung des funktionalistischen Prinzips Funktion als Terminus klar abzugrenzen. Dies führte schließlich dazu, dass unterschiedliche sprachliche Ebenen funktional motiviert sein können. So kann der Gebrauch bestimmter Lexeme oder syntaktischer Muster funktional in einer spezifischen Interaktionssituation sein. Ein Sprecher würde zum Beispiel in einer informellen Interaktionssituation mit Freunden andere sprachliche Mittel gebrauchen als in einem öffentlich-formellen oder institutionellen Gespräch (zum Beispiel bei einem Vortrag vor einem Fachpublikum). Gleichzeitig haben die Hinweise zu konstruktionsgrammatischen Ansätzen gezeigt, dass sprachliche Einheiten für sich, das heißt losgelöst von jeglicher situations- und interaktionsbedingter Kontextgebundenheit, funktional sein können. Hierbei ist also nicht eine vermeintliche kommunikative Absicht, sondern die Funktion der grammatischen Struktur als Indikator für einen spezifischen Inhalt ausschlaggebend. Mehrgan (2012: 39) differenziert deshalb zwischen einer strukturellen und einer pragmatischen Funktion. Nichols (1984: 98) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass allen funktionalistischen Ansätzen die Prämisse zugrunde liegt, eine Brücke zwischen formalen Beschreibungsebenen und der Kommunikation zu schlagen: „It aims at closing the gap between the study of language and the study of communication, […]. It tries to give grammar a direct material grounding in the communicative situation.“ Da diese Verknüpfung wiederum unterschiedlichen Zugängen unterliegt, findet man divergierende Auffassungen zum Funktionsbegriff.
Generell wird angenommen, dass kommunikative Funktionen und Absichten universal sein können, die konkrete formale Realisierung sich jedoch von Sprache zu Sprache unterscheidet. In Bezug auf die Gegenstände dieser Arbeit bedeutet das, dass semantische Relationen für jede Sprache relevant sind. Wenn Handlungen verbalisiert werden, enthalten sie unabhängig von der Einzelsprache Rollen wie Agens, Patiens, Thema, Rezipiens oder Instrument. Die einzelsprachliche Kodierung der Funktion kann jedoch divergieren. Die formalen Realisierungsoptionen schöpfen dabei aus dem der Einzelsprache zugrunde liegenden Formeninventar, wodurch einzelsprachlich konventionalisierte Form-Funktions-Paare entstehen. Charakteristisch ist dabei in den meisten Fällen das mapping problem. Nur in wenigen Sprachen kann einer Form genau eine Funktion zugeordnet werden. So ist zum Beispiel die Verfügbarkeit von genau einer Kasusform zur Markierung von exakt einer semantischen Rolle in agglutinierenden Sprachen wie dem Türkischen zu finden (zum Beispiel -a/-e im Dativ, -da/-de im Lokativ).1 Ein ähnlich striktes Muster findet sich in flexionsfreien und damit isolierenden Sprachen, die semantische Relationen im Satz ausschließlich durch die Abfolge der Konstituenten kennzeichnen. Liegt solch eine Eins-zu-Eins-Relation vor, spricht man vom one-to-one mapping. In den meisten flektierenden Sprachen wird hingegen eine Form zur Markierung mehrerer Funktionen gebraucht. So ist im Deutschen der Artikel die nicht nur Genus- und Kasusmarker im Femininum, sondern wird sowohl im Nominativ als auch im Akkusativ gebraucht (Dienom Frau sieht den Mann vs. Den Mann sieht dieakk Frau). Hinzu kommt, dass die in allen Genera im Nominativ und Akkusativ Plural verwendet wird (Dienom Männer/Kinder/Frauen sehen den Mann vs. Der Mann sieht dieakk Männer/Frauen/Kinder). Aus funktionaler Perspektive heißt das, dass die Artikelform die multifunktional ist, da sie sowohl Singularität als auch Pluralität anzeigt und darüber hinaus verschiedene Kasus und damit semantische Rollen kennzeichnen kann. Da der Idealfall des one-to-one mappings sehr selten oder sprachenspezifisch auftritt, sind one-to-many mappings (das heißt eine Form erfüllt mehrere Funktionen) oder many-to-one mappings (unterschiedliche nebeneinander stehende Formen können jeweils dieselbe Funktion erfüllen) in vielen Sprachen gängig.2 Bates/MacWhinney erklären dieses mapping problem mit der Tatsache, dass es eine Vielzahl außersprachlicher pragmatischer und semantischer Funktionen gibt, diesen aber nur ein begrenzter Pool sprachlicher Formen gegenübersteht. Sie folgern deshalb: „[W]e can view the mapping problem as a competition for channel access among these diverse pragmatic and semantic functions” (1987a: 215). Der Terminus channel access entspricht in diesem Zusammenhang der Annahme, dass Sprecher komplexe und multidimensionale Inhalte in ein relativ striktes lineares sprachliches System bringen müssen. Der Sprecher hat somit die Aufgabe, die Funktionsvarianz zu erkennen und zu entscheiden, welche Funktion die Form im spezifischen Gebrauchsmoment erfüllt. Kommunikationsprozesse zwingen den Sprecher dabei stets dazu, Funktionen in ‚geeignete‘ Formen zu verpacken („mapping of function onto form“), während Hörer diese Formen wiederum dekodieren müssen, um den Inhalt herauszufiltern („mapping of form onto function“; Bates/MacWhinney 1989: 51).
Sprachliche Entwicklung (insbesondere die kindliche) wird im Sinne eines funktionalistischen Ansatzes als Erwerb von form-function mappings betrachtet. Funktionalistische Ansätze nehmen an – basierend auf einer gebrauchsorientierten Grundhypothese –, dass die von Sprechern (oder allgemeiner: von Interaktionspartnern) verwendeten Kodierungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle im kindlichen Erwerbsprozess spielen (vgl. Tomlin 1990: 160f.). Spracherwerb ist in diesem Sinne dann erfolgreich, wenn Lerner die einzelsprachlichen Form-Funktions-Paare mühelos en- und dekodieren können. Lerner stehen vor der Aufgabe, passende Formen zum Ausdruck konkreter Inhalte und Konzepte aus dem Input zu filtern und sie in angemessener Weise, das heißt für den Kommunikationspartner verständlich zu gebrauchen. Kommunikative Funktionen und semantische Konzepte bestimmen dabei in Abhängigkeit von der kognitiven Entwicklung des Lerners den Erwerbsprozess und die Erwerbsverläufe, sodass Erwerbsprozesse zunächst „meaning-driven“ sind:
[C]ommunicative functions can drive the learner in a rather special way, by directing attention to regularities in the linguistic environment. The child is scanning the input for ways to convey interests and needs, trying to extract information that will help in predicting the behavior and attitudes of other people. (Bates/MacWhinney 1989: 31)
Kindliche Lerner mit einer uneingeschränkten physiologischen Entwicklung sind nicht nur in der Lage, sprachliche Laute als Möglichkeit der Kommunikation zu erkennen. Sie können (baiserend auf dem Ausbau semantischer Konzepte und kommunikativer Funktionen) in einem nächsten Schritt mittels konkreter kognitiver Fertigkeiten (Kategorisierung, Klassifizierung, Analogiebildung, Abstraktion) den sprachlichen Input analysieren und systematisieren. Lerner können in einer bestimmten Erwerbsphase spezifische Lexeme einzelnen Objekten zuordnen und im weiteren Erwerbsverlauf auch grammatische Strukturen als Ausdrucksmöglichkeiten für komplexere Konzepte nutzen. Funktionalistische Ansätze nehmen dabei an, dass das Suchen nach Formen eng mit der kognitiven Ausbildung dieser Konzepte verknüpft ist, was als zentrale Vorläuferfertigkeit betrachtet werden muss. Erst wenn ein Kind beispielsweise verstanden hat, dass belebte, meist menschliche Wesen in der Lage sind, unbelebte Objekte zu bewegen und ihren Zustand zu verändern, entsteht ein Konzept von Transitivität. Wenn dieses Grundverständnis kognitiv verankert ist, kann der Lerner den sprachlichen Input nach passenden Verpackungsmöglichkeiten durchsuchen und das Konzept verbalisieren (vgl. Mandler 1992, 2012). Im Rahmen des funktionalen Spracherwerbs wird diese Voraussetzung als functional readiness bezeichnet (vgl. Bates/MacWhinney 1987b, MacWhinney 1987b, 1988). Das Konzept der functional readiness ist stark angelehnt an die Annahme, dass Funktionen sprachungebunden und damit quasi funktional-semantische Universalien seien. Tomlin zufolge (1990: 165) ist es deshalb notwendig, diese zunächst systematisch zu erfassen, bevor untersucht werden könne, wie sie den Erwerb passender sprachlicher Kodierungsmöglichkeiten steuern.
Der Zugang über die functional readiness fragt danach, welche Konzepte ausgebildet sein müssen, damit sprachliche Mittel zur Realisierung dieser Konzepte überhaupt erst gebraucht werden können. Der Zugang über die Form fragt hingegen danach, mit welchen semantischen Konzepten spezifische sprachliche Formen verknüpft werden. Eine Fragestellung wäre in diesem Zusammenhang zum Beispiel, ob Kinder eine NVN-Konstruktion mit einer kausalen semantischen Relation zwischen zwei Aktanten verbinden. Ebenso kann danach gefragt werden, mit welchen semantischen Rollen Sprecher eine morphologische Artikelform wie die oder dem verknüpfen. Beide Zugänge gehen von der kognitiven Repräsentation von Form-Funktions-Relationen aus. Die Zielrichtung ist im ersten Fall das mapping von Form auf semantische Konzepte, im zweiten hingegen das mapping von semantischen Konzepten auf Form(en). Letzteres steht im Fokus dieser Arbeit.
Dass Lerner nicht nur über funktionales Wissen verfügen müssen, um sprachliche Mittel zu entdecken und zu gebrauchen, sondern dass die sprachliche Form an sich, das heißt losgelöst von kommunikativen Absichten und semantischen Konzepten, den Erwerbsprozess beeinflussen kann, ist wahrscheinlich. So kann davon ausgegangen werden, dass Lerner Strukturen und Konstruktionen wahrnehmen und abspeichern, ohne diese in Hinblick auf ihre Funktion zu analysieren. Denkbar wäre dazu folgendes Szenario: Ein Lerner könnte im Input ein Lexem wie Mann in unterschiedlichen syntaktischen Kontexten in NPs wie der Mann, aber auch dem Mann oder den Mann antreffen. Je häufiger das Item Mann also in unterschiedlichen Rollen und damit mit unterschiedlichen Kasusmarkern gebraucht wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass ein Lerner ein Flexionsparadigma für dieses spezifische Lexem ausbildet. In diesem Paradigma würden die Artikelformen der, den und dem als potentiell zugehörige Bestandteile des Lexems Mann gespeichert, ohne dass dem Lerner klar sein muss, dass die jeweiligen Artikelformen als Indikatoren für divergierende Rollen verwendet werden. Das mapping zwischen den identifizierten Formen und ihrer Funktion als Marker für semantische Rollen könnte dann in einem nächsten Schritt erfolgen. Wenn Lerner also versuchen, Sprache in Hinblick auf ihren funktionalen Gehalt zu analysieren, so müssten auch identifizierte formale Regelmäßigkeiten und paradigmatische Charakteristika hinsichtlich ihrer Funktion ‚abgeklopft‘ werden, ohne dass das zugehörige Konzept vollständig ausgebildet sein muss. Bates/MacWhinney (1989: 31) fassen die Interdependenz zwischen funktionalen Voraussetzungen und formal-grammatischem Wissen so zusammen, dass beide Ebenen das Erlernen von mappings steuern: „[T]he important issue is not whether learning is driven by form or by function. The answer to this question is that it is driven in both ways“. Genau diese Interdependenz formaler und funktionaler Prinzipien ist in der These, Spracherwerb sei Erwerb von form-function mappings repräsentiert.
Das Nebeneinander funktionaler und formaler Prinzipien ist sowohl für ein- als auch für mehrsprachige Erwerbsbedingungen relevant. In beiden Kontexten ist das primäre Ziel die Beherrschung eines grammatischen Systems als Notwendigkeit für eine erfolgreiche Kommunikation. Dieser grundsätzliche Ansatz ermöglicht es, auch im L2-Erwerb ermergente Lernerstrukturen vor dem Hintergrund einer kommunikativen Notwendigkeit zu erklären. Tomlin (1990: 172) folgert, dass „the interplay between functional linguistic codings and more general communicative principles“ unabhängig von der Erwerbsbedingung systematisch erfasst werden könne. Auch Mehrgan (2012: 39) stellt heraus, dass funktionalistisch ausgerichtete Erwerbsforschung im Bereich des L2-Erwerbs daran interessiert sei herauszuarbeiten, inwiefern „meaning-making efforts on the part of learners are a driving force in an ongoing second language development, which interact with the development of formal grammatical systems“. Auch im L2-Erwerb ist deshalb die Frage essentiell, wie form-function mappings entstehen. L2-Studien müssen sich deshalb damit befassen, welche Funktionen Lerner mit welchen Formen verknüpfen und wie sie formal realisiert werden (vgl. Mehrgan 2012). Letzteres bezeichnet Bardovi-Harlig (22015: 55) als „concept-oriented approach“, was heißt, dass das zu versprachlichende Konzept (zum Beispiel semantische Relationen) als Anstoß zum Erwerb formalsprachlicher Formen dient. Ein entscheidender Unterschied zwischen L1- und L2-Erwerbsprozessen ist hierbei die Rolle der functional readiness. Während Kinder im L1-Erwerb zunächst basale funktionale Kategorien ausbilden müssen, sind diese im später einsetzenden L2-Erwerb bereits vorhanden. Die Erwerbsaufgabe besteht dann ‚nur‘ noch darin, neue Kodierungsmöglichkeiten zum Ausdruck bereits ausgebildeter semantischer Konzepte zu finden. Während im L1-Erwerb überhaupt erst Form-Funktions-Paare ausgebildet werden müssen, gilt es im L2-Erwerb neue Paare zu etablieren (vgl. dazu auch Bardovi-Harlig 22015, Mehrgan 2012, Saville-Troike/McClure/Fritz 1984).
Funktional ausgerichtete erwerbstheoretische Fragestellungen orientieren sich nicht nur an den Prinzipien des form-function mappings, sondern greifen auch die aus der funktionalen Linguistik hervorgegangenen gebrauchsbasierten Ansätze und kognitiven Prinzipien auf. Beides findet sich im Konzept der emergent language. Der Terminus der emergent grammar geht auf Hopper (1987:142) zurück, der das Emergenzprinzip folgendermaßen definiert:
[S]tructure, or regularity, comes out of discourse and is shaped by discourse as much as it shapes discourse in an on-going process. Grammar is hence not to be understood as a pre-requisite for discourse, a prior possession attributable in identical form to both speaker and hearer. Its forms are not fixed templates but are negotiable in face-to-face interaction in ways that reflect the individual speaker’s past experience of these forms, and their assessment of the present context, including especially their interlocutors, whose experiences and assessments may be quite different.
Aus der Definition geht vor allem hervor, dass Regularitäten im grammatischen System nicht ‚voreingestellt‘ sind, sondern regelrecht verhandelt werden können. Die Nutzung spezifischer Muster ist entsprechend davon abhängig, in welchem Kontext diese gebraucht werden und welches Wissen der Sprachbenutzer mit ihnen verknüpft. Hoppers zunächst vage erscheinende Definition fasst grundlegende funktionalistische Vorannahmen zusammen. So ist die Emergenzthese keinesfalls so zu verstehen, dass Sprecher in spezifischen Interaktionssituationen die lineare grammatische Struktur immer wieder neu aushandeln müssten. Vielmehr geht aus dem Zitat hervor, dass die Verwendung einzelner Strukturen kontextgebunden sein muss und die an der Interaktion Beteiligten spezifisches Wissen über die Funktionen der gebrauchten Strukturen mitbringen müssen, um Inhalte kommunizierbar und verstehbar zu machen. Grammatik entsteht also in und durch Interaktion und ist damit quasi doppelt gebrauchsbasiert.