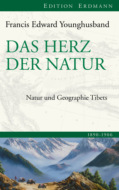Kitabı oku: «Zu den Klippen von Vanikoro», sayfa 5
FÜNFTES KAPITEL
Nachdem ich die Cook Bay auf der Osterinsel am 10. April gegen Abend verlassen hatte, richtete ich meinen Kurs gen Norden, doch so, dass ich immer längs der Küste der Insel hinsteuerte, die wir die ganze Nacht hindurch bei hellem Mondschein ungefähr eine Meile weit von uns liegen sahen. Wir verloren sie erst am anderen Nachmittag gegen zwei Uhr, nachdem wir uns zwanzig Meilen weit von ihr entfernt hatten, aus den Augen. Bis zum 17. wehte der Wind anhaltend aus Südosten. Während dieser Zeit war fast kein Wölkchen am Himmel zu sehen, auch trübte er sich erst, als der Wind nordostwärts drehte. Wir fingen zahlreiche Bonitos, die unseren Fregatten bis zu den Sandwich-Inseln10 unaufhörlich nachschwammen und uns während eines Zeitraums von eineinhalb Monaten täglich eine vollständige und köstliche Mahlzeit boten. Die Fischkost trug nicht wenig dazu bei, dass wir allesamt in bester körperlicher Verfassung waren. Auf einer nun schon zehn Monate dauernden Fahrt mit nicht mehr als fünfundzwanzig Rasttagen war nur ein einziger Mann krank geworden. Dieser Umstand ist umso bemerkenswerter, als wir unbekannte Gewässer durchsegelten. Unser Weg verlief nahezu parallel zu dem, den Kapitän Cook im Jahr 1777 einschlug, als er von den Gesellschaftsinseln aus die Nordwestküste Amerikas ansteuerte, nur hielten wir uns annähernd achthundert Meilen weiter gegen Ost. Ich hoffte, dass es mir auf einer Strecke von beinahe zweitausend Meilen gelingen würde, einige Entdeckungen zu machen. Unsere Mastkörbe waren rund um die Uhr besetzt, und ich hatte für den Matrosen, der als Erster Land sichten würde, eine Belohnung ausgesetzt.
[Es folgen einige Bemerkungen über die von Herrn Dagelet täglich vorgenommenen Standortmessungen und die auf alten spanischen Seekarten verzeichneten Insel La Mesa, Los Majos und La Disgraciada, die von dem französischen Geschwader an der Stelle, an der sie liegen sollen, nicht aufgefunden werden.]
Am 7. Mai, als wir unter dem 8. Grad nördlicher Breite segelten, sahen wir eine große Anzahl von Vögeln, hauptsächlich Sturm-, aber auch Fregatt- und Tropikvögel. Die beiden letzteren Gattungen sollen sich, sagt man, nie weit vom Land entfernen. Auch schwammen sehr viele Schildkröten um und neben unseren Schiffen. Zwei derselben wurden von den Matrosen der Astrolabe gefangen. Die Vögel und die Schildkröten zeigten sich noch, als wir schon 14 Grad zurückgelegt hatten. Ich war daher ganz sicher, dass irgendeine unbewohnte Insel ganz in der Nähe lag, denn diese Tiere suchen sich lieber eine Klippe mitten im Meer zum Aufenthalt aus als eine Gegend, wo Menschen wohnen. Am 18. Mai befand ich mich unter dem 20. Grad nördlicher Breite und unter dem 139. Grad westlicher Länge gerade an der Stelle, an der, den Spaniern zufolge, die Insel La Disgraciada liegen sollte, ohne dass wir sie sahen. Am 20. hatte ich das ganze Gebiet von Los Majos durchschnitten, ohne dass uns auch nur die Spur von einer Insel zu Gesicht gekommen wäre. Ich fuhr fort, auf diesem Parallelkreis gen Westen zu steuern. Im Morgengrauen des 28. erblickte ich die schneebedeckten Berge der Insel Owyhee11 und bald darauf die weniger hohen der Insel Mowée12. Ich ließ noch weitere Segel setzen, um schneller an Land zu kommen, war aber dennoch bei Einbruch der Nacht noch sieben bis acht Meilen von der Küste entfernt. Ich brachte die Nacht mit Lavieren zu und wartete, bis der Tag anbrechen würde, weil ich mir vorgenommen hatte, in den zwischen den beiden Inseln liegenden Kanal einzulaufen, um bei der Insel Morokinne13 zu ankern. Unsere Längenmessungen stimmten ganz mit denen des Kapitäns Cook überein. Die sorgfältigsten Vergleiche ergaben nur eine Differenz von 10 Minuten, die wir uns weiter gegen Osten befanden.
Um neun Uhr des Morgens umsegelte ich die Westspitze von Mowée, und zwar 15 Grad nördlich. Im Westen, 22 Grad nördlich, nahm ich ein kleines Eiland wahr, das von den Engländern nicht bemerkt wurde und auf ihrer Karte nicht zu finden ist. Der Anblick von Mowée war zum Entzücken schön. Wir segelten in einer Entfernung von einer Meile die Küste entlang. Da sahen wir denn, wie das Wasser in Kaskaden von den Gipfeln der Berge herabschoss, sich zwischen den Niederlassungen der Indianer hindurchschlängelte und dann dem Meer zuströmte. Die Dörfer lagen so nahe beieinander, dass man sie für eine einzige Ansiedlung von drei oder vier Meilen Länge halten konnte. Alle diese Hütten stehen dicht am Ufer, und die hinter ihnen liegenden Berge sind so nahe, dass der Umfang der bewohnten Uferzone eine halbe Meile nicht übersteigen dürfte. Nur ein Seemann, der sich an einem glühendheißen Tag mit einer einzigen Flasche Wasser begnügen muss, um seinen Durst zu stillen, ermisst, was wir beim Anblick der Küste von Mowée empfanden. Die Baumgruppen auf den vor uns liegenden Bergen, das frische Grün, die Bananenbäume, die die Indianer um ihre Hütten gepflanzt hatten, dies alles wirkte mit unbeschreiblichem Zauber auf unsere Sinne. Leider brandete das Meer an der Küste so heftig, dass wir, neue Tantalusse, zunächst nur das, was sich uns entzog, mit gierigen Blicken verschlangen.
Mittlerweile nahm der Wind zu, und wir legten in einer Stunde zwei Meilen zurück. Ich bestand darauf, noch vor Einbruch der Dunkelheit die ganze Küste bis hin zur Insel Morokinne abzufahren; vor Morokinne hoffte ich einen Ankerplatz zu finden, der unsere Schiffe vor den Landwinden schützte. Diesem Plan zufolge war es mir nicht möglich, einige Segel zu reffen und auf die ungefähr hundertfünfzig Pirogen zu warten, die sich uns von Mowée aus näherten. Sie waren sämtlich mit Obst und Schweinen beladen. Die Indianer führten uns die Waren zu, um sie gegen Eisen einzutauschen.
Fast alle Pirogen kamen uns so nahe, dass sie an eine der beiden Fregatten anlegten. Da wir aber auf der Suche nach einem sicheren Ankerplatz rasch davonsegelten, gerieten sie in hohen Wellenschlag und füllten sich mit Wasser. Die paddelnden Indianer sahen sich genötigt, das Schiffsseil, das wir ihnen zugeworfen hatten, wieder fahren zu lassen. Sie schwammen ans Ufer zurück, liefen ihren jungen Schweinen nach, brachten sie zurück, drehten mit den Schultern die gekenterten Pirogen wieder um, schöpften das Wasser aus den Booten, sprangen vergnügt und munter wieder hinein und paddelten aus Leibeskräften auf uns zu, um den Platz wieder einzunehmen, an dem anderen Händlern just das gleiche Schicksal widerfuhr. Auf diese Art sahen wir hintereinander mehr als vierzig Pirogen umschlagen. Wiewohl nun der Handel mit diesen gutmütigen Indianern sie und uns ganz ausnehmend zufriedenstellte, kam dabei doch nicht allzu viel heraus; es gelang uns nicht, mehr als fünfzehn Schweine und einige Früchte einzutauschen.
Die soeben erwähnten Pirogen besitzen einen Ausleger und fassen dabei bis fünf Mann. Die von mittlerer Größe sind zwar vierundzwanzig Fuß lang, aber nur einen Fuß breit und tief. Wir wogen eine Piroge, die diese Maße hatte, und fanden, dass sie nicht über fünfzig Pfund schwer war. Dessen ungeachtet wagen sich die Bewohner dieser Inseln mit so schwachen Fahrzeugen bis zu sechzig Meilen in die offene See und setzen damit über Wasserstraßen, die, wie der Kanal zwischen Atooi und Wohaoo14, zwanzig Meilen breit sind und wo es überdies noch heftig stürmt. Sie sind allerdings so gute Schwimmer, dass sie es in dieser Hinsicht mit Robben und Meerwölfen aufnehmen.
Je weiter wir vorankamen, desto mehr hatten wir den Eindruck, dass sich die Berge immer tiefer ins Innere der Insel zurückzögen, die nun in der Gestalt eines ziemlich ausgedehnten, gelbgrün schimmernden Halbrunds vor uns lag. Die Wasserfälle verschwanden; die Bäume in der Ebene schienen nicht mehr so dicht beieinanderzustehen wie bisher; die Dörfer bestanden nur noch aus zehn bis zwölf elenden Hütten, die ziemlich weit auseinanderlagen. Nachdem ich Kurs gegen Südwest genommen hatte und bis zur Südwestspitze von Mowée gekommen war, wendete ich mich nach West, dann allmählich nach Nordwest und kam an den Ort, wo die Astrolabe in dreiundzwanzig Klaftern Tiefe, ungefähr eine Drittelmeile vom Land, vor Anker lag. Hier waren wir gegen die Winde, die von der offenen See kamen, durch eine himmelhohe, von Wolken umgebene Felswand gedeckt, aus der von Zeit zu Zeit heftige Windstöße herabfuhren. Mit jedem Augenblick nahm der Wind eine andere Richtung an, sodass wir unaufhörlich an unseren Ankern hin und her trieben. Wir waren an dieser Stelle übel dran, weil wir uns, der heftigen Strömung wegen, nicht eher gegen den Wind legen konnten, als bis uns die oben erwähnten Windstöße dazu Gelegenheit boten. Sie wühlten das Meer dermaßen auf, dass man es mit unseren Booten fast nicht befahren konnte. Dem ungeachtet ließ ich eins derselben sofort aussetzen und in der Bucht das Senkblei auswerfen. Der Offizier, dem ich dies aufgetragen hatte, berichtete mir, dass der Ankergrund bis nahe ans Ufer überall von gleicher Beschaffenheit sei, dass er zwar allmählich seichter werde, jedoch zwei Kabeltaue vom Gestade noch immer eine Tiefe von sieben Klaftern habe. Als ich die Anker lichten ließ, sah ich, dass die Ankertaue stark zerscheuert und zerrieben waren. Folglich gab es um uns herum viele verborgene Klippen, die nur mit einer ganz dünnen Schicht Sand bedeckt waren.
Mittlerweile gaben sich die Bewohner der zunächst liegenden Dörfer alle Mühe, um an Bord zu gelangen. Sie führten uns auf ihren Pirogen allerlei Tauschwaren zu: einige Schweine, Süßkartoffeln, Bananen, Aronwurzeln, die sie Taro nennen, selbstgewebte Stoffe und allerlei Krimskrams, der zu ihrer Tracht gehört. Ich wollte nicht, dass sie an Bord kamen, bevor die Fregatte vor Anker gegangen war und ihre Segel gerefft hatte, und erklärte ihnen daher, das Schiff sei für sie tabu. Das Wort, dessen Bedeutung ich von den Berichten englischer Seefahrer her kannte, tat wie erwartet seine Wirkung; Herr de Langle, der nicht zur gleichen Vorsichtsmaßnahme gegriffen hatte, sah das Deck seines Schiffs in wenigen Augenblick von einer solchen Menge Indianer überschwemmt, dass er in arge Verlegenheit geriet. Sie waren jedoch so folgsam und hatten so große Furcht, uns zur Last zu fallen, dass es nicht der geringsten Anstrengung bedurfte, sie zur Rückkehr auf die Pirogen zu bewegen. Niemals hätte ich mir vorgestellt, dass diese Leute so sanft und artig wären. Auch als ihnen gestattet worden war, auf meine Fregatte zu kommen, setzten sie ohne Erlaubnis keinen Fuß von der Stelle. Man sah es ihnen an, dass sie beständig die Furcht hatten, unser Missfallen zu erregen. Ihre Tauschgeschäfte betrieben sie mit der größten Redlichkeit. Die eisernen Spitzen unserer alten Zirkel weckten ihr ganzes Verlangen, aber anstatt sie zu entwenden, boten sie ihre ganze Geschicklichkeit auf, um sie uns abzukaufen. Keiner von diesen Händlern war bereit, uns einen größeren Posten Stoff oder mehrere Schweine auf einmal zu verkaufen. Sie wussten sehr genau, dass sie mehr dabei gewannen, wenn wir ihnen jedes Stück einzeln abhandelten.
Ihre Gewandtheit im Feilschen und ihre Kenntnis des Eisens, die sie nach eigenem Bekunden nicht dem Umgang mit Engländern verdankten, bestärkten mich in der Annahme, dass die Sandwich-Inseln in älterer Zeit schon von spanischen Schiffen angelaufen worden waren. Die spanische Nation hatte triftige Gründe, die Existenz dieser Inselgruppe ihren Nachbarn zu verheimlichen. Es strotzte in den Gewässern westlich von Amerika nur so von Seeräubern. Hätten sie von diesen Inseln Kenntnis gehabt, so hätten sie sich auf ihnen auch mit Lebensmitteln versorgt. Da dies aber nicht der Fall war, mussten sie, wenn es ihnen an Proviant, Holz und Wasser gebrach, entweder gen Westen bis in das Indische Meer segeln oder aber über Kap Hoorn in den Atlantik zurückkehren. Als dann die Schifffahrt der Spanier so sehr in Verfall geriet, dass nur noch einmal im Jahr ein einziges Galionsschiff nach Manila fuhr, dieses Galionsschiff aber stets eine so wertvolle Ladung an Bord hatte, dass seine Eigentümer sich um seine Erhaltung die größten Sorgen machten, da schrieb man ihm sehr wahrscheinlich ganz genau seinen Weg vor – einen Weg, der vergleichsweise ungefährlich war und von dem es unter keinen Umständen abweichen durfte. So gerieten dann jene Inseln, die Cook zum Verhängnis wurden, bei den Spaniern immer mehr in Vergessenheit.


Ankerplatz der Franzosen vor der Insel Mowée
Einige Windstöße abgerechnet, die aber nicht länger dauerten als zwei Minuten, war die Nacht ruhig und still. Als es tagte, ließ ich sogleich das große Boot der Astrolabe aussetzen, das die Herren de Vaujuas, Boutin und Bernizet an Bord nahm. Sie hatten den Auftrag, eine sehr geräumige Bucht nordwestlich von uns zu untersuchen. Ich hoffte, hier einen besseren Ankerplatz zu finden. Die Offiziere meldeten, der in Aussicht genommene Ankerplatz sei leicht zu erreichen, aber nicht besser als die Stelle, an der wir uns befänden. Dieser Teil der Insel Mowée, so lautete ihr Bericht, werde zu Recht von den Seefahrern gemieden. Es fehle hier sowohl an Holz wie auch an Wasser, und die Reeden seien schlecht.
Um acht Uhr morgens waren vier zu unseren Fregatten gehörende Boote zur Abfahrt bereit. In den ersten befanden sich zwanzig bewaffnete Soldaten unter dem Kommando von Schiffsleutnant de Pierrevert. In die beiden anderen setzten sich Herr de Langle und ich mit allen Passagieren und Offizieren außer denjenigen, die Dienstgeschäfte halber an Bord blieben. Am Ufer erwarteten uns ungefähr hundertzwanzig Personen, teils Männer, teils Frauen. Die Seesoldaten und ihre Offiziere landeten als Erste und bestimmten den Bezirk, den wir uns vorbehielten. Die Soldaten hatten ihre Bajonette aufgepflanzt und marschierten so akkurat, als ob sie vor dem Feind stünden. Das militärische Schauspiel machte auf die Inselbewohner keinerlei Eindruck; ihre Weiber gaben uns durch die ausdrucksvollsten Gebärden zu verstehen, dass sie uns in aller und jeder Hinsicht zur Verfügung ständen; die Männer aber suchten in ehrerbietiger Haltung die eigentlichen Beweggründe unseres Besuchs zu erforschen, um unsere Wünsche auf den ersten Blick erfüllen zu können. Zwei Indianer, die einige Autorität über ihre Landsleute zu besitzen schienen, kamen gerade auf mich zu und hielten mit viel Würde eine ziemlich lange Ansprache, von der ich kein einziges Wort verstand; am Ende derselben machte jeder von ihnen mir ein Schwein zum Geschenk. Ich nahm die Gaben an und verehrte ihnen meinerseits Medaillen mit dem Bild des Königs, Beile und andere Gegenstände aus Eisen, die für sie von unschätzbarem Wert waren.
Meine Freigebigkeit machte auf alle den lebhaftesten Eindruck. Die Frauen waren doppelt so liebenswürdig zu uns. Sehr verführerisch waren diese Insulanerinnen nicht; sie hatten grobe Gesichtszüge, und unter den Tüchern, die sie um sich geschlungen hatten, zeigten sich die deutlichsten Spuren jener Verheerungen, die von der Lustseuche herrühren. Da in den Pirogen keine einzige Weibsperson zu uns an Bord gekommen war, war zu vermuten, dass sie in den Europäern die Urheber der Krankheit sahen, deren Merkmale sie an sich trugen; bald aber stellte ich fest, dass diese Erinnerung in ihrem Gemüt kein Ressentiment zurückgelassen hatte.
Es sei mir erlaubt, der Frage nachzugehen, ob die Syphilis von den Seefahrern unserer Zeit in der Südsee eingeschleppt wurde. Bekanntlich erheben die Verfasser mehrerer zeitgenössischer Reiseberichte diesen Vorwurf. Geschwaderarzt Dr. Rollin untersuchte auf Mowée mehrere Kranke. Er stellte an ihnen Symptome fest, die sich in Europa bei Geschlechtskranken erst nach zwölf bis fünfzehn Jahren zeigen. Er sah auch Kinder von sieben bis acht Jahren, die an der Lustseuche litten, die sie sich wohl schon im Schoß der Mütter zugezogen hatten. Die Mannschaft Kapitän Cooks kann somit nicht für die weitere Verbreitung dieser Krankheit auf Mowée verantwortlich gemacht werden; Kapitän Cook selbst notierte, fast alle Bewohner dieser Insel, die zu ihm an Bord kamen, seien geschlechtskrank gewesen. Diese Geißel der Menschheit sucht Hawaii schon seit längerer Zeit heim. Die Krankheit ist ein zusätzlicher Beweis, dass schon vor Cook Europäer auf der Insel gewesen sind.
Nachdem ich das nächstliegende Dorf in Augenschein genommen hatte, befahl ich sechs Soldaten und einem Unteroffizier, uns auf einem Ausflug ins Landesinnere zu begleiten. Die anderen blieben unter dem Befehl des Herrn de Pierrevert am Ufer zurück, um unsere Boote zu behüten.
Obwohl die Franzosen in jüngster Zeit als Erste auf der Insel Mowée an Land gingen, sah ich doch davon ab, sie im Namen des Königs in Besitz zu nehmen. Die Gepflogenheiten der Europäer sind in dieser Hinsicht mehr als abgeschmackt. Unsere Intellektuellen stöhnen, wenn sie hören, dass Landsleute von ihnen, deren einziger Vorzug darin besteht, dass sie über Kanonen und Bajonette verfügen, sechzigtausend Indianern ihren Willen aufzwingen und sich um deren heiligste Rechte keinen Deut scheren. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man unter dem Deckmantel der Religion Gewalt und Raublust freien Lauf ließ. Die modernen Seefahrer verfolgen, wenn sie die Sitten neu entdeckter Völker beschreiben, nur die eine Absicht: die Kenntnis der Menschheit und ihrer Geschichte zu vervollständigen. Ihre Weltreisen dienen dem Zweck, den Erdball vollends zu erforschen, und die Kenntnisse, die sie verbreiten, zielen einzig und allein darauf ab, die Bewohner der von ihnen besuchten Inseln glücklicher zu machen und ihnen ihren Lebensunterhalt zu erleichtern.
Nach diesem Grundsatz schaffen sie Stiere, Kühe, Ziegen, Schafe und Widder nach jenen Inseln, pflanzen sie Bäume, säen sie Samen aus aller Herren Länder und verschenken sie die Werkzeuge, mit denen sich die wirtschaftliche Fortentwicklung beschleunigen lässt. Was uns betrifft, so wären wir für die unsäglichen Strapazen, die wir auf unserer Entdeckungsreise auf uns nahmen, vollauf entschädigt, wenn es uns gelänge, dem in der Südsee offenbar weitverbreiteten Brauch der Menschenopfer Einhalt zu gebieten. Im Gegensatz zu Herrn Anderson und Kapitän Cook teile ich die Ansicht des Kapitäns King über die Bewohner der Sandwich-Inseln: Er nennt dieses Volk zu gutmütig, zu sanft und zu gastfrei, als dass es sich der Menschenfresserei ergeben könnte. Milde Sitten vertragen sich nicht mit düsteren religiösen Kulten. In seinem Reisebericht bezeichnet Kapitän King die Priester von Owyhee als seine besten Freunde; ich ziehe daraus die Folgerung, dass sich in der Kaste, der die Menschenopfer obliegen, allmählich Sanftmut und Gesittung verbreiten. Sind die Priester einer Insel nicht mehr auf Menschenopfer wild, dann sind es die übrigen Bewohner noch weniger. Hieraus erhellt, dass die Owyheer von Kannibalismus abgekommen sind; sehr wahrscheinlich liegt dies aber noch nicht lange zurück.
Der Boden der Insel Mowée besteht aus verwitterter Lava und anderen vulkanischen Stoffen. Die Einwohner haben nichts anderes zu trinken als Brackwasser; ihre Brunnen sind so wenig tief und so unergiebig, dass jeder Insulaner mit einer halben Barrique Wasser im Tag auskommen muss. Wir bekamen auf unserem Streifzug vier Dörfer zu sehen, deren jedes aus zehn bis zwölf Hütten bestand. Diese Hütten waren aus Stroh geflochten und auch mit Stroh bedeckt. Im Aussehen gleichen sie denen unserer ärmsten Bauern. Die Dächer fallen nach zwei Seiten ab, die Türen sind am Giebel angebracht und nur dreieinhalb Fuß hoch, sodass man sich bücken muss, wenn man eintreten will. Als Türen dienen Hürden, die jeder beiseiteschieben kann. Das ganze Hausgerät der Inselbewohner umfasst bloß Bastmatten, die, wie unsere Teppiche, ein äußerst sauberer Bodenbelag sind und auf denen sie schlafen. Ihr Küchengeschirr besteht aus großen Kürbissen, denen sie, wenn sie noch grün sind, die von ihnen gewünschte Form geben. Sie lackieren sie und malen mit schwarzer Farbe allerlei Dinge darauf. Mir kamen auch Kalebassen vor Augen, die aus mehreren Kürbissen zusammengeleimt waren und wie sehr große Vasen aussahen. Der von ihnen verwendete Leim widersteht der Feuchtigkeit; ich hätte gern seine Zusammensetzung erfahren. Ihre Stoffe, von denen sie eine beträchtliche Menge besitzen, verfertigen sie, wie andere Südseeinsulaner, aus dem Papiermaulbeerbaum. Diese Stoffe haben eine Vielzahl von Dessins, scheinen mir aber nicht die Qualität der Stoffe auf anderen Inseln zu haben. Bei der Rückkehr von dem Ausflug ins Landesinnere hielten mich Frauen an, die sich unter einigen Bäumen versammelt und auf mich gewartet hatten. Sie schenkten mir mehrere Stücke Stoff, wofür ich mich mit Beilen und Nägeln bedankte.
Der Leser erwarte nicht, dass ich hier eine ausführliche Beschreibung der Bewohner von Mowée gebe, die uns ja dank den Schilderungen der englischen Seefahrer hinlänglich bekannt sind. Diese brachten auf der Insel vier Monate zu, während wir nur wenige Stunden dort verweilten. Überdies hatten die Engländer den Vorteil, dass sie die Landessprache verstanden. Wir beschränken uns aus diesem Grund darauf, nur zu erzählen, was uns dort persönlich widerfahren ist.
Um elf Uhr schifften wir uns wieder ein, in bester Ordnung, ohne Hast und Verwirrung und ohne dass wir Veranlassung hatten, uns über irgendjemanden zu beschweren. Um zwölf Uhr waren wir allesamt wieder an Bord. Herr de Clonard hatte von einem Indianerhäuptling auf dem Tauschweg einen Mantel und einen mit roten Federn geschmückten Kopfputz erworben. Auch hatte er mehr als hundert Schweine gekauft, Bananen, Süßkartoffeln, Taro, eine Menge Stoffe und Matten, ein Auslegerboot und allerlei Gegenstände aus Federn und Muscheln.
Abends um fünf Uhr gelang es uns endlich, den Anker zu lichten. Es war zu spät, als dass ich mein Vorhaben hätte ausführen können, zur Insel Ranai und zur Westseite von Mowée zu steuern. Gern hätte ich die dortige Wasserstraße untersucht, aber es wäre unvorsichtig gewesen, so etwas zur Nachtzeit zu wagen. Als es tagte, lief ich an der Südwestspitze der Insel Morotoi vorbei, hielt mich immer in der Entfernung von einer Dreiviertelmeile an die Küste und kam sodann, wie die Engländer, durch den Kanal, der die Inseln Oahu und Morotoi voneinander trennt, wieder in die offene See. Die letztgenannte Insel scheint mir auf der Seite, die wir umschifften, nicht bewohnt zu werden, während sie, wie die Engländer versichern, auf der entgegengesetzten stark bevölkert ist. Bemerkenswert ist, dass die fruchtbarsten, gesündesten und folglich am dichtesten besiedelten tropischen Inselregionen stets unter dem Wind liegen. Das gilt für die Sandwich-Inseln ebenso wie für unsere Besitzungen Guadeloupe, Martinique und andere. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Inselgruppen ist übrigens so frappierend, dass mir hier, mindestens in Bezug auf die Schifffahrt, alles absolut gleich vorkam.
Am ersten Juni um sechs Uhr abends waren wir über alle Inseln hinaus. Wir hatten nicht mehr als vierundzwanzig Stunden darauf verwendet, sie zu erforschen. Knapp fünfzehn Tage hatte uns die Aufgabe gekostet herauszufinden, ob die auf den alten spanischen Seekarten verzeichneten Inseln La Mesa, Los Majos, La Disgraciada usw. überhaupt existieren. Dank unserer Nachforschungen kann man sie nun von den Karten streichen.
Sonderbar genug war, dass ein und derselbe Schwarm Fische unseren Fregatten eineinhalbtausend Meilen weit folgte. Mehrere Bonitos trugen auf ihren Rücken Wunden, die wir ihnen mit unseren dreizackigen Wurfspießen zugefügt hatten, und sie waren daran immer wiederzuerkennen. Ich zweifle nicht daran, dass diese Fische, hätten wir uns nicht bei den Sandwich-Inseln aufgehalten, uns noch weitere zwei- oder dreihundert Meilen nachgeschwommen wären, bis wir Gewässer erreicht hätten, die für sie zu kalt sind.
10Die Hawaii-Inseln.
11Die Hauptinsel Hawaii.
12Heute Maui.
13Heute Molokai.
14Heute Straße von Oahu.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.