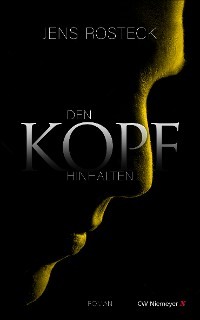Kitabı oku: «Den Kopf hinhalten», sayfa 4
Totenstille herrschte im Trakt. Von der Straße drangen schrille Gesänge zur stummen Schar herauf; eine Handvoll aufgebrachter Hinrichtungsgegner standen dort unten vorm Tor, die ihre Friedenslieder und Protesthymnen angestimmt hatten und damit das ganze feierliche Ritual diskreditieren, stören und verhindern wollten. In die Vergeblichkeit ihres schaurigen Gesangs mischten sich Hartnäckigkeit und Stolz.
Nun war es so weit. Nun nahte Rupert Beaufort, dicht gefolgt von Howard Phelps, und betrat die Bühne mit schnellem Schritt. Ohne auch nur einen kostbaren Moment zu verlieren, nickte er den Umstehenden kurz zu, riss die Zellentür auf und näherte sich dem Verlorenen, der bereits stehend auf ihn wartete.
Hatte Rupert eine Frau vor sich, berührte er sie ganz sacht am Arm. Das genügte. Einem Mann legte er kurz freundschaftlich die Hand auf die rechte Schulter und drehte ihn damit bereits mit dem Gesicht zur Tür. Das wirkte. „Follow me!“ war das Einzige, was er zu ihm, was er zu ihr sagen würde, mit klarer Stimme, mit der gebotenen Festigkeit. Ohne Befehlston.
Erst dann, wenn die anderen keinen Widerstand leisteten und sich zum Gehen anschickten, würde er sie für den Bruchteil einer Sekunde frontal anschauen. Würde sie mit seiner Mission konfrontieren. Ihnen den Auftrag der Allgemeinheit, sie zu beseitigen verdeutlichen, den er stellvertretend für die Richter und Geschworenen, für die Ankläger und Verteidiger, für die grundlos Hingemeuchelten und Bestohlenen, für die Erschlagenen und Betrogenen verkörperte. Ihnen zeigen, dass es eine Moral gab, der niemand entrinnen konnte. Damit der oder die andere noch einmal einem Menschen aus Fleisch und Blut begegnete, einem Menschen wie Du und Ich, auch wenn dieser Mensch, den man Henker nannte, ihm oder ihr gleich das Liebste wegnehmen würde. Rupert würde alle Zuneigung, derer er fähig war, bei diesem Anschauen zum Ausdruck bringen. Und zu erkennen geben, dass er den Leib des anderen nicht anrühren und seine Seele unversehrt lassen würde. Dass er lediglich dazu da sei, um den Übergang vom Leben zum Tod herzustellen und den Schmerz zu lindern. Dem anderen sein Vertrauen schenken. Ihn bitten, sein Schicksal doch gefälligst in seine kundigen Hände zu legen. Ihn um sein Einverständnis ersuchen, ihn nebenan aus der Welt schaffen zu dürfen.
Nahezu immer erhielt Rupert dieses Einverständnis auch. Und heute? Er schaute den Italiener, der genau so ruhig dastand, wie er gestern an seinem Tisch mit den Partituren gesessen hatte, direkt in die Augen.
Was er darin las und sah, war das Erwartete: Der Pianist erteilte ihm die Erlaubnis.
Bat ihn um Erlösung.
Gab sich ihm hin.
Als sich ihre Blicke begegneten, durchfuhr ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. Er hatte diesen Magazzano schon einmal gesehen.
Und da wusste er, so wie man einfach weiß, dass es Sommer und Winter gibt, er wusste mit unumstößlicher Bestimmtheit:
Dieser Mann war kein Verbrecher.
2
Zwei Blicke – und die Liebe
bricht aus

Immer wenn ich an diesen so besonderen Frühling denke, befällt es mich von Neuem: das überwältigende Bewusstsein der Befreiung. Diese Erleichterung, einem goldenen Käfig entkommen zu sein. Immer wenn ich mir diese Märztage in Erinnerung rufe, als ich allein in Paris sein durfte, als die Stadt mir und ich ihr gehörte und niemandem sonst, steigt es wieder in mir auf: dieses Gefühl, neugeboren zu sein.
Neugeboren – das sagt sich so leicht dahin, das verwendet man oft, ohne es wirklich zu meinen. Aber auf mich traf es in vollem Umfang zu: Endlich, das erste Mal seit meiner Kindheit in Ligurien, das erste Mal seit meiner geraubten Jugend, das erste Mal seit meinen Studienjahren in Mailand und das erste Mal seit meiner Knechtschaft als Musiker und Künstler, war ich ganz allein. Wochenlang. Die reinste Wonne.
Ja, allein. Nicht etwa einsam, verlassen oder verloren, sondern für mich. Nur für mich. Aus den Fängen eines besitzergreifenden, herrschsüchtigen Menschen befreit, der alles darangesetzt hatte, mich zu verunsichern, mich ans Klavier zu ketten und mir Unselbständigkeit einzureden. Aus den Klauen einer hartherzigen, ehrgeizigen Frau, die mich zuerst aufgebaut und zum Virtuosen gemacht, mir dann den eigenen Willen ausgetrieben, mich mit Disziplin traktiert und später nach Lust und Laune beeinflusst hatte.
Bis zu diesem unvorhersehbaren Moment, in dem Brenda in unserem Pariser Hotel eine äußerst wichtige Nachricht erhielt und, ohne mich, überstürzt nach London zurückreisen musste, hatte ich es zugelassen, eine Existenz als ihr wohlhabender Sklave zu fristen. Als Vorzeigekünstler mit perfektem Anschlag und ohne echte Persönlichkeit. Auch als ihr Gatte: teilnahmslos und blass. Ein Gatte, der das in ihn investierte Geld wiedereinspielte und auch noch Gewinn machte, der sich nach Herzenslust auspressen ließ und ansonsten artig den Schnabel hielt. Von Luxus umgeben und unglücklich. Identitätslos. Von ihr, meiner Impresaria, eingeengt, voller Hemmungen.
Auf einmal, es bedurfte lediglich einer Ausgangssituation, mit der vorher nicht zu rechnen war, auf einmal ging es eben doch. Es funktionierte: Ich erwachte, wie man aus einer Narkose erwacht. Ich erwachte und war sogleich voller Tatendurst. Ich erwachte, und ich kam zurecht. Ich gestaltete meinen Tagesablauf. Ich traf eigene Entscheidungen. Es war wie ein Aufbäumen. Ich entdeckte mich selbst. Ich war in der Lage, das Podium zu verlassen und wie ein erwachsener Mann zu handeln. Ich war fähig, Glück zu empfinden, ohne gelotst zu werden. Ich wurde zu einem neuen, mir selbst unbekannten Sandro. Erlöst war ich, auf Zeit wenigstens. Auf mich selbst gestellt, unabhängig.
Paris hatte mich wachgeküsst.
Ich, der Wahl-Londoner Magazzano, der sich aus einem Leben in London nichts machte, auch wenn es ein Leben im Schlaraffenland war, konnte nicht genug bekommen von diesen zarten Küssen à la française. Ich, der Italiener im Exil, der den südlichen Teint und die braun gebrannte Haut meiner Kinderjahre gegen die vornehme Blässe Britanniens und die versnobte Farblosigkeit von Westminster und Covent Garden eingetauscht hatte, spürte, wie das Blut wieder in meine Adern schoss, sobald die Lippen von Paris meine Wange streiften.
Ich stand, überglücklich, im Zentrum Frankreichs: Stand auf dem Pont des Arts inmitten von anderen Flaneuren, die wie ich mehrmals täglich über die Brücke spazierten, um auf das andere Flussufer zu gelangen, sah unter mir die Lastkähne auf der Seine vorbeiziehen, erblickte die beiden dicht besiedelten Inseln, den Strom der Passanten, historische Gebäude und Museen, gewahrte die Turmspitze der Sainte-Chapelle, die ausladenden Seitenflügel des Louvre sowie die Fassade der altehrwürdigen Kathedrale Notre-Dame – und war frei.
Mir stand die Welt offen. Und was für eine Welt! Eine milde Märzsonne wärmte mir das Herz. Ich wurde von Aufbruchstimmung erfasst. Ich vermochte es, mich selbst zu überraschen. Und es war eine wunderbare Fügung, dass mir die Freiheit genau hier, in der schönsten Stadt, die ich je gesehen hatte, zuteil wurde.
I Love Paris pfiffen 1953 die Spatzen von den Dächern, Cole Porters neuen Sehnsuchtssong, und ich summte mit. Stellte mir dieselbe Frage wie der Sänger des Liedes: „Why do I love Paris? Because my love is near.“
Die Antwort war schlicht, naheliegend, wundervoll. Die Antwort kam einem Versprechen gleich, einem Orakel. An dem vielleicht etwas dran war.
Paris half mir auf die Sprünge: Das Schicksal hatte es so gewollt.
Ich hatte schon in Sydney gastiert und in Budapest, in Chicago, Moskau und in Madrid. Ich war in Berlin aufgetreten und in Stockholm, in Marseille, in Tokio und in Warschau. In London, unserem ständigen Wohnsitz, wenn wir einmal nicht um den Planeten jetteten, besaß ich meine eigene Konzertreihe. Beim Edinburgh Festival leitete ich seit mehreren Sommern eine Masterclass für angehende Tastenlöwen. Selbst hier in Paris hatte ich in den vergangenen Jahren bereits unzählige Recitals bestritten und dabei doch nie mehr zu sehen bekommen als Theater und Festsäle, Proberäume und Schnürbörden, Garderoben und Hotelzimmer, die Büros von Veranstaltern, die Werkstätten von Klavierbauern und das Interieur teurer Restaurants. Dabei zählte ich zu den internationalen Spezialisten für französische Klaviermusik.
Vom wirklichen Leben in der Metropole hatte ich nur kurze Blicke aus dem Taxifenster erhaschen können, auf dem Weg zum Flughafen oder nach der Ankunft am Bahnhof. Flüchtige Eindrücke, nichts von Dauer. Keine Freunde, keine spontanen Bekanntschaften. Einem echten Franzosen, einer waschechten Pariserin war ich nie begegnet. Eine einheimische Geliebte hatte ich nie besessen. Jetzt endlich bekam ich meine Chance. Jetzt konnte ich, ohne kontrolliert zu werden, die großen Boulevards entlangbummeln, zum Montmartre hinaufsteigen, eine schöne Unbekannte ansprechen, den Chansonpoeten Boris Vian Jazztrompete spielen hören, ein Spielzeugschiffchen auf dem Wasserbecken des Jardin du Luxembourg auf die Reise schicken oder mich auf der Terrasse der „Rhumerie Martiniquaise“ in Saint-Germain niederlassen und mir einen raffiniert gemixten Antillen-Cocktail bestellen.
Drei Soloabende in der Salle Pleyel – wo Debussy, Fauré und Satie auf dem Programm standen, wo das Publikum mir Ovationen darbrachte – lagen hinter mir, die Kritiken waren hymnisch ausgefallen. Ich war mit meiner Leistung hochzufrieden gewesen. Nun sollte ich im Studio Suiten und geistreiche musikalische Aphorismen von Poulenc für eine französische Plattenfirma einspielen. Und danach die Solowerke von Saint-Saëns. Möglichst beseelt, möglichst fehlerfrei. Jeden Morgen von neun bis halb zwölf. Und, am Nachmittag, von drei bis fünf dafür üben, im stillen Kämmerlein. Das war mein einziges Pflichtprogramm. Für ein Arbeitstier wie mich war das Entspannung pur. Wie Urlaub.
Brendas Anrufe und Telegramme ließ ich unbeantwortet. Und ich rief sie auch nicht zurück. Kabelte ihr nicht. Ich hatte unbändige Lust, mich abzunabeln. Ihre Stimme am Telefon zu hören, ihre weinerliche und manipulierende Stimme, die sonst so energisch und schneidend, kalt und verletzend sein konnte, hätte ich jetzt nicht ertragen. Sie war fuchsteufelswild gewesen, mich in der französischen Hauptstadt zurücklassen zu müssen. Einem Wutanfall nahe, als sie ihren Koffer packte und keine Handhabe mehr hatte, mich wie gewohnt an die Leine zu nehmen. Aber was konnte sie schon groß tun? Die Plattenaufnahmen gingen vor, die Sessions waren seit Langem geplant, und gegen die Wechselfälle des Lebens war kein Kraut gewachsen.
Es war unhöflich und grausam von mir, ich wusste es nur zu genau, mich nicht regelmäßig zu erkundigen, wie es ihrem verwitweten Vater in der Zwischenzeit erging, dem von ihr angebeteten Mr Finnegan. Den vor wenigen Tagen in London ein schwerer Schlaganfall ereilt hatte. An dessen Krankenbett im noblen Belgravia Brenda jetzt stand und sich die Augen aus dem Kopf heulte. Seine Brenda, meine Brenda, die meinen Beistand bitter nötig gehabt hätte. Aber diesen Gefallen tat ich ihr nicht – ich verweigerte ihr und meinem Schwiegervater mein Mitgefühl. Sollten sie ruhig ohne mich leiden! Sollte seine Genesung ruhig den Vorrang haben! Meine Bedürfnisse hatten sie bislang auch nur einen feuchten Dreck geschert. In diesen Wochen, die einzig mir und meiner Affäre mit Paris vorbehalten waren, würde ich mich nicht gängeln lassen.
Einen Stadtplan brauchte ich nicht. Ich wollte gern vom rechten Weg abkommen, mich im städtischen Dschungel verirren. In meinem kleinen Hotelzimmer in der Rue du Faubourg Saint-Honoré verlor ich nur wenig Zeit. Früh stand ich auf, schlüpfte in meine Kleider, machte nur kurze Toilette und sagte dem jungen Tag Bonjour.
Schnell noch ein schwarzer Kaffee, ein Croissant, ein flüchtiger Blick in die International Herald Tribune, und dann hielt mich nichts mehr in Innenräumen: Ich vertraute mich der Lichterstadt an, der Ville Lumière. Ich fuhr Métro und aß einen Croque Monsieur in einem Bistro nahe der Opéra-Comique, ich erkundete zu Fuß den Père-Lachaise und die Buttes-Chaumont, ich pilgerte zu den Gräbern von Chopin, Berlioz und Oscar Wilde, ich durchstreifte die gigantischen Flohmärkte an der Peripherie, ich begab mich auf Entdeckungsreise.
Und dann geschah, was geschehen musste: Ich verliebte mich in Paris. Ich hatte einen Tick zu lange hingeschaut, ich hatte mich einwickeln lassen, und jetzt war mir nicht mehr zu helfen: Ich betete Paris an. Jeden Tag ein wenig mehr. „Because my love is near.“
Was genau hier meine tiefen Gefühle auslöste, was genau an diesem Ort dafür verantwortlich war, dass meine Schwärmerei in Leidenschaft umschlug – ich konnte es nicht festmachen oder mit zwei, drei dürren Worten sagen. Womöglich die so besondere Luft von Paris. Die fabelhafte Architektur. Die ungeheure Vielzahl der Perspektiven. Schneisen, Säulen, Obelisken, Mahnmale, Statuen. Der Atem der Geschichte. Die Anmut der Frauen aus den feinen Arrondissements und die grobe Erotik der Mädchen aus den Arbeitervierteln und Vorstädten. Die sympathische Arroganz der frechen, smarten Sorbonne-Studenten, die überall am linken Ufer in Grüppchen zusammenstanden, rauchten und die Welt neu erfanden. Die unnahbare Aura der ganz in Schwarz gekleideten, unentwegt rauchenden Existentialisten – die Gurus hielten in Cafés Hof, die nur Intellektuellen vorbehalten zu sein schienen, und ihre Jünger trugen enge Rollkragenpullover und Hornbrillen, diskutierten nonstop und gingen keiner geregelten Tätigkeit nach. Der hiesige Mix aus fremdartigen und dennoch anheimelnden Gerüchen. Das Aroma der Austern, Hummer und Miesmuscheln, die sich, auf gestoßenen Eisstücken lagernd, zu Dutzenden vor den Auslagen der Meeresfrüchterestaurants türmten. Die Anwesenheit der Menschen aus aller Herren Länder, darunter viele Laoten und Vietnamesen, Orientalen, Schwarze und Nordafrikaner. Das ständige Gewusel. Die faszinierenden Lichtverhältnisse während der Blauen Stunde – schon nicht mehr Dämmerung, noch nicht ganz Nacht. Der raue, kehlige Gesang der Straßenmusiker. Das Quietschen der Métrozüge. Die bunten Werbetafeln aus der Vorkriegszeit. Die Streikenden mit ihren Transparenten. Die blasierten Kellner in ihren schwarz-weißen Schürzen, die immer geflissentlich an einem vorbeischauten. Der Geschmack eines Pastis, den man um vier Uhr nachmittags am Panthéon zu sich nahm. Der Qualm der filterlosen Gitanes, der einem an vielen Straßenecken in die Nase stieg. Die Heerscharen von Tauben, die bei jedem Schritt durch die Tuilerien aufflatterten und sich, wie mattes Herbstlaub, woanders wieder niederließen. Der Anblick vieler kaputter Gestalten, Krüppel und Clochards, die aussahen, als würden sie ihr jämmerliches Leben jeden Moment aushauchen: in der Gosse gelandet durch zügellosen Absinthgenuss oder durch Mangel an Mitleid. Die Armut von Paris stank zum Himmel, doch es war ein Gestank, der meine Liebe zu dieser Stadt nicht schmälern konnte. „Because my love is near.“
Daran gewöhnt, von Brenda kurzgehalten zu werden – „eine gute Managerin ist strenger als eine Gouvernante“, pflegte sie zu sagen, „und du weißt, dass ich nur dein Bestes will“ –, kam ich mit wenigen Francs pro Tag aus. Ihr Pech, dass sie bei der Unterredung mit dem Direktor der Salle Pleyel in der Vorwoche darauf bestanden hatte, uns meine letzten Gagen in bar auszahlen zu lassen. Tant mieux – umso besser! Auf diese Weise war meine Brieftasche jetzt prallvoll, und sie konnte nichts dagegen unternehmen. Außerdem war Paris kein teures Pflaster. Aus üppigen Mahlzeiten machte ich mir nichts, die Zigaretten hatte meine Gebieterin mir schon vor Jahren abgewöhnt – „ein erstklassiger Pianist wie du kann nicht mit gelben Fingern herumlaufen“ –, und selbst die Huren in den Elendsvierteln rund um die Rue Saint-Denis verlangten für ihre Dienste kaum mehr, als ein Mittagessen in einer Brasserie kostete.
Schnell hatte ich heraus, wo die käuflichen Mädchen tagsüber herumlungerten, les putes, le puttane, und ebenso schnell waren meine Besuche bei ihnen auch wieder vorbei. Sie erregten mich nur für wenige Minuten und interessierten mich auch nicht wirklich, ich liebte sie mit der Glut des Südländers, heftig, stürmisch, rücksichtslos, und stieß sie gleich wieder von mir, gewährte ihnen keinen Kuss, keine Zärtlichkeiten, kein freundliches Wort, aber ich hatte es satt, dass Brenda mich seit Monaten am langen Arm verhungern ließ und ich, dank ihrer perfekten Nonstop-Beaufsichtigung, auch anderweitig nicht zum Zuge kam. Und ließ daher an den jungen Dingern, die gar nichts dafür konnten und selbst nichts zu lachen hatten, meine Frustration aus.
Die leichten Mädchen hier nahmen meine Indifferenz und meine Brutalität nicht schwer. Den Typ Mann kannten sie: geil und emotionslos. Es war ein ehrlicher Deal: Ich brauchte ihre Umarmungen, ihre vorgetäuschte Hingabe, ihr einstudiertes Seufzen und Stöhnen, so wie sie nach dem Akt ihr hart verdientes Geld, eine Fluppe und einen „petit rouge“ benötigten.
Eines der Flittchen – eine falsche Brünette mit spärlichem roten Schamhaar – entlarvte meine Herkunft, sprach Italienisch und erzählte mir, dass sie aus Taormina sei. Und Flavia heiße. Mir war das herzlich egal. Nie würde sie erfahren, dass sie ihren Körper soeben an Sandro Magazzano verkauft hatte. Für ein unromantisches, hitziges Viertelstündchen.
„Was für ein hübscher Bursche!“, sagte sie anerkennend, als ich mir die Hose zuknöpfte und die Krawatte wieder umband, „che bel ragazzo che sei ... Was treibst du nur hier?“
Sie runzelte die Stirn und wies auf meinen Ehering: „Lässt Madame dich nicht ran?“
Sie angelte sich den großen, zerknitterten Franc-Schein, den ich auf dem Nachttisch deponiert hatte, und tätschelte mir den Rücken. Ich knurrte eine unverständliche Antwort, blaffte zurück und suchte das Weite.
Es war schon gut so, dass ich mich mit Flavias Konkurrentinnen, den ordinären Französinnen, nicht unterhalten konnte: Ich sprach und verstand kein einziges Wort. Dabei sollte Französisch doch die Sprache der Liebe sein!
Charmant und romantisch fand ich aber vor allem diese Stadt, die Stadt der Städte, deren vielfältigen Geheimnissen ich jetzt auf den Grund gehen konnte. Ich hoffte, Colette oder wenigstens Cocteau in den Gärten des Palais-Royal zu begegnen. Ich wappnete mich, um für das Aufeinanderprallen mit Theater-Erneuerern wie Beckett und Ionesco oder mit großen Denkern wie Sartre und Malraux gerüstet zu sein. In einem Café, im Dôme oder in La Rotonde. Ich hielt Ausschau nach den Surrealisten. Irgendwo in Montparnasse mussten sie doch herumspuken – nicht nur in Ateliers oder auf Vernissagen. Ich musste damit rechnen, all diesen tonangebenden Künstlern und Philosophen früher oder später über den Weg zu laufen … Ich ließ auf der Place du Tertre eine Karikatur von mir anfertigen, die obligatorischen Windmühlenflügel des Moulin Rouge bildeten den Hintergrund der ziemlich misslungenen Zeichnung. Ein Toulouse-Lautrec hätte das besser hingekriegt! Und ich vermied es tunlichst, mich mit Kollegen zu treffen. Aufs Fachsimpeln mit anderen Musikern oder gar mit dem eitlen Lyoner Dirigenten, der mich erst kürzlich auf einer England-Tournee begleitet hatte, konnte ich getrost verzichten.
Nur auf einem Treffen mit dem großen Organisten und Komponisten Olivier Messiaen würde ich bestehen. Er improvisierte, Brenda selbst hatte es mir verraten, jeden Sonntagmorgen während der Messe in der Trinité-Kirche beim Bahnhof Saint-Lazare. Und manchmal auch nachmittags, ohne dass ihn ein Betender oder Andächtiger bei der Ausübung seines Metiers störte.
Wuchtig und schwer verdaulich waren seine Improvisationen, dann wieder rätselhaft und verästelt, und jedes Mal so kompliziert und verwirrend, dass sie den Rahmen jedes Gottesdienstes sprengten. Messiaen vergrub sich tief in den Klangspektren exotischer Kulturen, baute zahllose Vogelrufe in seine Werke ein, brachte seine Orgel zum Strömen und zum Stöhnen, zum Explodieren und zum Abstürzen, förderte Unerhörtes zutage, blickte, mit den Fingern auf den Tasten, in Abgründe, tauchte seine Zuhörer in ein Wechselbad der Gefühle. Fügte ihnen Schmerzen zu, verwöhnte sie, ließ ihnen Wohltaten widerfahren.
Es musste, da waren sich alle einig, die ihn erlebt hatten, eine Offenbarung sein. Auch ich würde für Messiaen untertauchen und mich treiben lassen. In einem Meer der Sinnlichkeit. In einem Ozean der Orientierungslosigkeit. Mit etwas Glück würde ich ihn sogar allein antreffen und ihm minutenlang zuhören können. Etwas über Klangfarben lernen und musikalische Meditation. Ansprechen würde ich ihn und ihn bitten, auch mir bald zu lauschen.
Das war ein echtes Genie. Das war ein Wilder. Das war ein Musiker, den nur Paris hervorbringen konnte. Rebellisch, unbequem. Ein Mann mit Spleen, so schien es mir, in einer Stadt mit Flair.
Allein schon wegen dieses Messiaen, der Gott und Satan, Glückseligkeit und heillose Untiefen auf seinem Instrument heraufbeschwören konnte, genau wie ich allein kraft seiner Fingerfertigkeit und seines Tastenzaubers, lohnte es sich fremdzugehen, mit Paris Liebe zu machen. Allein seinetwegen lohnte es sich, Paris zu streicheln und sich von Paris streicheln zu lassen. Und London ganz bewusst ein wenig zu vernachlässigen.
Je länger ich vor meiner Frau und meinem gewohnten Leben davonlief, desto alberner wurde mein Verhalten: Es war schlicht unmöglich, mir vorzumachen, dass ich Brenda Finnegan nicht zu Dank verpflichtet war: Ich verdankte ihr sehr wohl sehr viel. Eigentlich fast alles.
Brenda, mit ihrer unfehlbaren Spürnase und ihrer immensen Kultiviertheit, hatte mich bei einem Vorspiel in Turin entdeckt und unter ihre Fittiche genommen. Als ich vierzehn war. Brenda hatte meine armen, hinterwäldlerischen Eltern dazu gebracht, dass sie mich ziehen ließen, ohne auch nur in Ansätzen zu verstehen, wie aus ihrem Sandro, dem kleinen, ungeschickten Jungen aus ihrem Bergdorf, jemals eine internationale Berühmtheit werden konnte. Oder warum ihr sonderbares Kind, ihr Traumtänzer Sandro, auf einmal unbedingt eine exklusive Ausbildung benötigte und bald überall auf der Welt Kompositionen großer Meister interpretieren würde, deren Namen sie nicht einmal buchstabieren konnten. Als ich fünfzehn war. Brenda war eigens nach Apricale gereist und in unsere kümmerliche, baufällige Hütte gekommen, wo sie sich den Mund fusselig geredet hatte, bis Gennarino, mein Papa, und Serafina, meine Mama, ihr endlich vertrauten. Irgendwann war es ihr gelungen, mich ihnen für immer abzuluchsen. Sie von meiner außergewöhnlichen Begabung zu überzeugen. Ihnen einen Vertrag vorzulegen und mit ein paar Kreuzen unterzeichnen zu lassen, der für sie ein Buch mit sieben Siegeln blieb. Alle rechtlichen Fragen – Volljährigkeit, Zuständigkeit, Fürsorgepflicht – hatte Brenda dabei bravourös umschifft. Als ich siebzehn war. So als benötigte ich eine klügere, weltläufigere Adoptivmutter und nicht nur eine Managerin.
Sie hatte, als sie mich erst einmal eingesackt hatte, dann auch Wort gehalten und mich jahrelang unterstützt, mir in Wien und Zürich Schliff beigebracht und die teuersten, einflussreichsten Klavierlehrer Europas auf mich angesetzt. Auf Sendro.
Immer sprach sie meinen Namen Seeennndro aus, mit langem, hartem e und ebenso langem n, nie nahm sie das weiche, sanfte und mediterrane a in den Mund, und so wurde ich in ihrer Darstellungsweise, noch bevor wir uns in London überhaupt häuslich niederließen, zu jemand anderem. Zu ihrer Kunstfigur. Sie bevormundete mich im Wortsinn. Ich wiederum hatte mich nicht lumpen lassen und mich ihres Vertrauens würdig erwiesen. Ich war bereit gewesen zu dieser Dressur, hatte alle Torturen über mich ergehen lassen und war seit einigen Jahren über mich hinausgewachsen. Ein weit besserer Konzertpianist geworden, als sie es sich je erträumen konnte. Ein weit selbstbewussterer Mann, als es ihr recht sein konnte. Ein Ehemann, der mittlerweile nicht mehr automatisch mit ihr schlief und wie ein Schoßhund sofort angesprungen kam, sobald sie mit den Fingern schnippte.
Brenda betrachtete mich seit einiger Zeit mit großem Argwohn. Und bald darauf kam es so weit, dass nichts mehr zwischen uns lief. Zwischen meinem achtzehnten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr waren wir – jedenfalls für Außenstehende – ein Liebespaar gewesen, ohne dass die Liebe Einzug in unsere Herzen gehalten hätte. Ohne dass wir einander wirklich begehrt hätten.
Wir hatten uns in unserem lustlosen Londoner Dasein häuslich eingerichtet und kaum noch mit Veränderungen gerechnet. Einander skeptisch beäugend und wohl auch ein wenig angewidert saßen wir in derselben Falle.
Nun, noch bevor mein Pariser Abenteuer auf mich wartete, war der Ofen endgültig aus. Wir hielten, schon um auf ihren Ruf und auf meine Reputation zu achten, seit einiger Zeit nur noch die Fassade aufrecht. Bestanden aber auf getrennten Betten. Getrennten Hotelzimmern. Brachten den Gutenachtkuss bereits vor den Türen unserer Suiten hinter uns. Damit unsere Entourage uns Glauben schenkte. Rührten einander jedoch nicht mehr an.
Es hieß, dass sie mich seit Neuestem mit unserem Chauffeur betrog. Oder mit dem Pressemann unserer Konzertagentur. Oder eigentlich schon immer lesbisch gewesen sei. Ich glaubte weder das eine noch das andere und traute ihr doch beides zu. Es war mir vollkommen gleichgültig.
Nur Paris zählte jetzt. Nur meine eigenen Gefühle waren noch von Belang. In diesem unwirklich schönen Frühling, in dem ich meinen Hemdkragen öffnete und mich, so oft es nur ging, schwüler Montmartre-Luft, lindem Tabakduft, mit Rauschgift angereicherten Montparnasse-Aromen und kühlen Seine-Brisen aussetzte.
Ich hatte keine Hemmungen mehr, zur Abwechslung mal richtig egoistisch zu sein. „Because my love is near.“
Das Tonstudio lag versteckt im Innenhof einer alten Manufaktur am Ende einer kleinen, baumlosen und ruhigen Straße abseits der Champs-Élysées. Über den Häuserdächern lugten zuweilen die Dachetage des Triumphbogens oder die mächtige Stahlkonstruktion des Eiffelturms hervor. Wie überall in dieser märchenhaft verwirrenden Stadt, dieser Metropole der Kontraste, standen auch in diesem kunterbunten und unorganisierten Arrondissement zwischen herrschaftlichen Häusern und wahren Wohnpalästen noch kaputte kleine Unterkünfte und vom Krieg gezeichnete Mietskasernen, die Ruinen glichen, wechselten Weinläden, Bäckereien und Obststände mit verstaubten Buchhandlungen und Kaschemmen, in die seit der Jahrhundertwende kein Lichtstrahl gefallen zu sein schien.
Dörfliches Ambiente, uralte Mülltonnen mit Einschusslöchern, Abfallberge und wild wuchernde Blumen im rissigen Asphalt, verwahrloste Hunde und streunende Katzen, Witwen in Morgenmänteln, die im Türrahmen lehnten, dickbäuchige Männer mit Baskenmützen, die ihre Baguettes in der Hand balancierten und nonchalant über die Straße trugen: Postkartenmotive allerorten, Paris-Klischees noch und nöcher.
Aber irgendwie stimmte die Mischung einfach. Weil es eine wilde Mischung war.
Genau wie die Klangkulisse – alle paar Meter spitzte ich die Ohren, um ein paar Takte Piaf, eine Strophe Gréco, einen Drehorgel-Refrain, den Beginn eines amerikanischen Jazzstandards oder die schunkelnden Akkordeon-Rhythmen einer Valse-Musette aufzusaugen.
Nichts passte zusammen, und doch war all das zusammengenommen Paris. Vielleicht zog mich genau dieses Sammelsurium, dieses Flickwerk aus scheinbar unvereinbaren optischen und akustischen Eindrücken in seinen Bann – und dann über den Tisch. Das Nebeneinander von Chic und Misere, von Mondänität und himmelschreiender Ungerechtigkeit. Die Parallelwelten: La Vie en rose hier, Les Feuilles mortes dort. Zuckerrosen und welkes Laub. Koseworte und kruder Umgangston, Feinsinniges und Grobschlächtiges.
War es da überhaupt noch notwendig, den vielgestaltigen Soundtrack der Großstadt mit meinen abgehobenen Klassikaufnahmen im Studio, die sich, nach der Pressung, bald auf den Plattentellern der Bürgerhaushalte drehen würden, zu vervollständigen und zu bereichern? Auf dem Weg dorthin, wo der Techniker schon auf mich wartete, begegnete mir jedenfalls auf Schritt und Tritt mein eigener Name – noch nicht abgenommene Plakate aus den Vorwochen, für die Konzertabende mit Sandro Magazzano in der Salle Pleyel, zierten zwischen Concorde, Place Vendôme und Élysée-Palast zahllose Häuserwände.
Offenbar gehörte ich hier schon dazu, offenbar war mein Name bereits Teil des Paris-Mosaiks. Nur ich selbst musste das noch begreifen und akzeptieren.
Es war, als hätte man mir eine Augenbinde abgenommen. Und mich, nach Jahren vollständiger Blindheit oder vergeblichen Herumtastens in stockdunklen, fensterlosen Räumen, wieder ins Helle geführt und neu sehen gelehrt. Paris empfing mich mit gleißendem, blendendem Licht. Es tat ein wenig weh, aber es war prachtvoll. Alles, was ich hier erblicken durfte, war eine Augenweide.
Als ich noch ein kleiner Junge und nie über die Dorfgrenzen von Apricale hinausgekommen war, hatten mir meine Eltern an einem Sonntagmorgen mit einem Stück Stoff die Augen verbunden. Um mich zu überraschen, um mir – damals vielleicht fünf oder sechs Jahre alt – eine Freude zu machen. Ganz vorsichtig verknoteten sie es hinten an meinem Kopf. Mehrere Stunden lang sollte ich, wie sie mir freundlich befahlen, still sitzen, artig sein und ja nicht versuchen, es herunterzureißen. Natürlich gehorchte ich.
Was ich nicht wissen konnte, war, dass Gennarino und Serafina an diesem Junitag in den frühen Dreißigerjahren eine Reise mit mir vorhatten. Heute würde man sagen: einen kurzen Ausflug. Denn Bordighera, wohin die Fahrt gehen sollte, lag höchstens zwanzig Kilometer von uns entfernt im Süden. Aber an der Küste. Und wir Magazzani fuhren sonst nirgendwo hin. Wie alle Leute aus den Bergen.
Einmal war ich, angestiftet von zwei Rotzlöffeln, die im Nachbarhaus in der Via Fiume wohnten, heimlich immerhin bis an das am tiefsten gelegene Ende von Apricale gelaufen, unten im Tal, zur kleinen Wallfahrtskapelle Santa Maria degli Angeli. Wo Pilger, die an den Wochenenden von nah und fern anreisten, vor den bunten Bildern und Skulpturen Kerzen anzündeten und Münzen auf den Boden warfen. Mehrere Hundert Lire wollte ich für mich und meine Kameraden erbeuten. Doch dann, als ich Dreikäsehoch bergabgerannt und mir fast die Puste ausgegangen war, hatte ich mich vor den überlebensgroßen Figuren der Dämonen mit ihren dunklen Augen und Drohgebärden und vor den blutüberströmten Heiligen gegruselt und mich gleich wieder getrollt. Ohne das Geld aufzuheben, ohne irgendetwas zu klauen. Die Nachbarskinder hatten mich daraufhin verspottet, Serafina hatte mich ausgeschimpft.