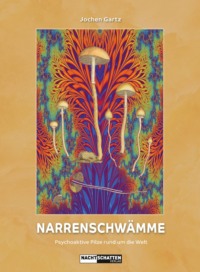Kitabı oku: «Narrenschwämme», sayfa 2
Liebestränke aus bolond gomba
So fand der große Arzt und Botaniker Clusius (1525–1609) in Ungarn den „bolond gomba“ einen Pilz mit dem deutschen Namen „Narrenschwamm“. Dieser wurde in ländlichen Gebieten gebraucht und vom weisen Mann (javas asszony) zu Liebestränken verarbeitet. Der Narrenschwamm wird in dieser Zeit auch aus der Slowakei erwähnt. In den Versen des polnischen Dichters Waclav Potocki (1625–1699) kommt dieser Pilz ebenfalls vor; es wird von seiner Eigenschaft gesprochen, „töricht zu machen wie Opium“.
John Parkinson spricht in seinem Theatricum Botanicum (1640) vom analogen „foolish mushroom“, den er aus England näher beschreibt. Über geistige Verwirrung gibt es in Österreich die volkstümliche Bezeichnung „Er hat verrückte Schwammerln gegessen“.
Diese verstreuten geschichtlichen Zeugnisse lassen keine eindeutige Bestimmung der verwendeten Pilzarten zu. Als Spezies kämen entsprechend ihres Vorkommens vor allem Psilocybe semilanceata und Psilocybe bohemica (S. 20 ff.) in Betracht. Auffällig ist, dass diese Bezeichnungen nur einen Aspekt der Eigenschaften der Pilze herausgreifen, die schizophrenartige Wirkung, die manchmal ausgeprägt sein kann. Niemals kommt in den Berichten eine besondere Wertschätzung im Sinne der mexikanischen Indianer („Teonanacatl“ = Fleisch der Götter) zum Ausdruck.
Zwischen Bewunderung und Furcht
Stets wurden die Pilzwirkungen mit den Symptomen von Geisteskrankheiten verglichen. Wahrscheinlich lässt sich die unterschiedliche Einschätzung erklären, wenn man die von R. G. Wasson und seiner Frau erstmalig definierten Begriffe Mykophilie und Mykophobie verwendet. Danach teilte er das traditionelle Verhältnis der Völker zu Pilzen in zwei Gruppen ein, wobei einer ausgesprochenen englischen Pilzabneigung (Mykophobie) die Pilzliebe (Mykophilie) z. B. in den slawischen Ländern gegenübersteht. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung liegen im Dunkel der Geschichte.
Es könnte eine frühe Tabuisierung psychotroper Pilze als Auslöser für ein späteres mykophobes Verhalten gedient haben. Andererseits könnte bei der Erschließung der Pilze als Nahrungsquelle vor Tausenden von Jahren eine auffällige Häufung tödlicher Vergiftungsfälle in mehreren Landstrichen aufgetreten sein, die eine starke und dauerhafte Abneigung der Bevölkerung gegen die gesamte Mykoflora hervorgerufen hat.
Die Mykophilie im alten Mexiko war jedenfalls verbunden mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz der Wirkung der Psilocybe-Arten, ihrer festen Einbindung in Riten, ohne dass eine Beziehung zu den ebenfalls dort vorkommenden echten Geisteskrankheiten gezogen wurde. Die Indianer dieses Landes sind interessanterweise auch die einzigen Amerikas, die traditionell Speisepilze in großem Umfang verwenden.
Leider werden die halluzinogenen Substanzen auch heute noch sofort nach ihrer Entdeckung mit stark wertenden Attributen belegt, die einen vorurteilsfreien, wissenschaftlich sachlichen Blickwinkel erschweren. Der Narrenschwamm tauchte in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts als mexikanischer „Irrsinnspilz“ auf. Die Entdecker des mittelamerikanischen Kultes nannten die Pilze in den fünfziger Jahren unter Anerkennung ihrer Wirkung und der frühen gesellschaftlichen Integration und Bedeutung „mexikanische Zauberpilze“. Später wurden sie in der Literatur mit dem relativ wertfreien Begriff „halluzinogene Pilze“ bezeichnet. Im Zuge der Zeit kamen dann die abwertende Bezeichnung „Rauschpilze“ und sogar der fachlich unmögliche Begriff „Drogenpilze“ in Mode.
Als T. Leary nach seinem mexikanischen Experiment mit den Pilzen im Sommer 1960 begann, in Harvard das Psilocybin anfänglich in psychologischen Testreihen zu verwenden und die Versuche bald danach auf breitere Kreise ausgeweitet wurden, brachte die amerikanische Presse Wertungen über die Pilze, die die Bezeichnung „Narrenschwämme“ noch übertrafen. Die Pilze induzierten angeblich einen „todähnlichen Zustand“. Den Protagonisten des Psilocybins wurde vorgeworfen, dass sie leugneten, dass das Alkaloid „halbpermanente Gehirnschäden“ hervorrufen könnte. Dieser wissenschaftlich unsinnige Wortsalat war ein Zeichen der sich immer mehr verschärfenden Kontroverse um die Halluzinogene, wobei das Psilocybin sehr schnell völlig in den Hintergrund rückte und dem ungeheuer potenten LSD mit dessen bald gewaltiger Publizität Platz machte. Dabei geriet der Pilzwirkstoff in den gesetzlichen Strudel dieser mächtigsten halluzinogenen Substanz, und seine Anwendung für wissenschaftliche Zwecke wurde zunehmend eingeschränkt. Die Halluzinogene differenzierte man nicht mehr untereinander. Bald erfolgte nicht einmal mehr eine Abgrenzung dieser pharmakologischen Gruppe von den echten Suchtmitteln des Typs Heroin. Dabei hatte die Basler Sandoz AG vor dieser Zeit kompetenten Forschern ausreichend Substanz für experimentelle und psychotherapeutische Zwecke zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden nach dem Verfahren von A. Hofmann 2 kg Psilocybin synthetisiert.
Schnell erschien als Resultat der pharmakologischen Untersuchungen klar, dass die Anwendung des Alkaloides in kontrollierten Experimenten kein Risiko für den Probanden darstellt. Trotzdem macht der dann Mitte der sechziger Jahre geschaffene gesetzliche Rahmen im Sinne einer „offiziellen Mykophobie“ es bis heute so schwierig, mögliche Anwendungsgebiete des Psilocybins wissenschaftlich abzuklären. Als Resultat der naturstoffchemischen Untersuchung weiß man jedoch heute, dass Pilze, die diesen Wirkstoff enthalten, auf allen Kontinenten wachsen und dadurch wissenschaftlich genau wie die andere Mykoflora untersucht werden müssen.
Neben der Einstellung einzelner Völker hat jeder von uns eine spezifische Sichtweise auf die Pilze im allgemeinen. Die Wurzeln für ein individuelles Verhältnis zu den Pilzen werden schon in der Kindheit gelegt. Oft bleibt jedoch im Dunkeln, warum man dann später ein bestimmtes Wertsystem in dieser Richtung entwickelt.
Ich erinnere mich an eine Situation, als ich im Alter von etwa fünf Jahren im Gras spielte und mir ein Mädchen einen braunen Pilz zeigte und mit bedeutungsvoller Stimme sagte, dass er giftig sei und man ihn daher nicht essen dürfe. Trotzdem bin ich zum Pilzliebhaber geworden, obwohl mir diese Episode im Gedächtnis haften blieb. Andererseits blieb mir aus meiner frühen Jugendzeit die Bewunderung über ein sehr üppiges Vorkommen von bläulichen Blätterpilzen auf einem Müllplatz ebenso gut in Erinnerung wie die vorherige Szene. Allgemein kann man wohl sagen, dass durch ihre bizarren Eigenschaften (Toxizität, Aussehen) diese Organismen viele frühe Eindrücke hervorrufen können, die sich später in verschiedener Hinsicht manifestieren.
Erfolgt dann noch eine zusätzliche Beschäftigung mit den psychotropen Arten, so wird die individuell vorherrschende Mykophobie oder -philie verstärkt oder abgeschwächt, da jetzt die Bewusstseinsveränderung zusätzlich in einer bestimmten, wertenden Sichtweise eingeschätzt wird.
Aus den Schilderungen der folgenden Kapitel werden die verschiedenen Blickwinkel auf die psychotropen Pilze deutlich. Die unfreiwilligen und gezielten Experimente mit den einzelnen Arten dokumentieren eindrücklich, dass sehr viele Interpretationen der Pilzwirkungen möglich sind.
2. Kenntnis der europäischen Arten

Abb. 8 Psilocybe cyanescens in Europa und Nordafrika (nach Krieglsteiner).

Abb. 9 Faksimile des Berichtes in einem englischen Journal über Vergiftungen mit Psilocybe semilanceata im Jahre 1799.
2.1. Psilocybe semilanceata
Der Klassiker unter den psychoaktiven Europäern
1799 berichtete E. Brande über eindrucksvolle Intoxikationen mit Pilzen aus London, die am 3. Oktober des gleichen Jahres im St. James Green Park von einer armen Familie gesammelt, danach zubereitet und verspeist wurden (Abb. 9, S. 19).
Nach dem Essen begannen die Symptome beim Vater und seinen vier Kindern sehr schnell, wobei unbegründetes Lachen, Delirien und ausgeprägte Pupillenerweiterungen bei wellenförmig auftretendem Verlauf beschrieben wurden. Der Vater sah zusätzlich noch alle umgebenden Gegenstände in schwarzer Farbe und befürchtete seinen baldigen Tod.
Schon geringe Pilzmengen erzeugten bei zwei Personen (12 und 18 Jahre alt) die gleichen Symptome wie die großen Portionen der andern Familienmitglieder. Nach wenigen Stunden gingen die Psychosen folgenlos vorüber, dazwischen lagen Therapieversuche mit Brech- und Stärkungsmitteln, denen dann ein Behandlungserfolg zugeschrieben wurde. Es ist für heutige Betrachtungen ein Glücksumstand, dass neben der Beschreibung dieses typischen Psilocybinsyndroms J. Sowerby die Pilze in sein Buch Coloured Figures of English Fungi or Mushrooms (London 1803) aufnahm (Abb. 3, S. 12).
Dabei fungierte nur die Pilzvarietät mit den kegeligen Hüten als Verursacher der Intoxikationen. Die Darstellung stellt sehr typisch die Psilocybe semilanceata dar, den Spitzkegeligen Kahlkopf, der in der zeitgenössischen Beschreibung als „Agaricus glutinosus Curtis“ auch völlig mit heutiger Kenntnis übereinstimmend erscheint (Abb. 4, S. 12).
1818 erwähnte dann der berühmte schwedische Mykologe E. Fries den „Agaricus semilanceatus“ in Observationes Mycologicae. Der gleiche Pilz wird später auch Lanzenförmiger Düngerling, Coprinarius semilanceatus FR. oder Panaeolus semilanceatus (FR.) LGE. genannt bis schließlich um 1870 die Art von Kummer bzw. von Quelet in die Gattung Psilocybe eingeordnet wurde. So findet man beide gültigen Bezeichnungen in der Literatur: Psilocybe semilanceata (FR.) KUMM. oder (FR.) QUEL.
Um 1900 nennt M. C. Cooke dann zwei oder drei Gelegenheiten, bei denen Kinder sich in England erneut versehentlich mit der Pilzart intoxierten und wies interessanterweise darauf hin, dass es sich nur um die blauverfärbende Varietät (var. caerulescens) gehandelt hatte. Er fragte sich als erster Mykologe, ob nur diese Varietät giftig wäre bzw. ob diese Verfärbung aus externen Faktoren herrühre, welche die chemische Zusammensetzung in Richtung Gift modifizieren könnten.
Frühe Beschreibungen
In seiner Fragestellung kommt Cooke der Wahrheit schon recht nahe (siehe Kap. 4). Psilocybe semilanceata ist mit den mexikanischen psychotropen Arten sehr eng verwandt. Im Erscheinungsbild steht der Pilz Psilocybe semperviva HEIM & CAILLEUX und Psilocybe mexicana HEIM nahe und kommt wie diese bevorzugt auf Weiden vor. Diese Ähnlichkeit und die ebenfalls nur diskret auftretende Blauung der Pilze regte die Untersuchung von Fruchtkörpern schweizerischer und französischer Herkunft durch die Gruppe um A. Hofmann und R. Heim in Zusammenarbeit mit dem Pilzfreund Furrer an. 1963 wurde dann über den papierchromatographischen Nachweis von 0,25% Psilocybin in den Trockenpilzen erstmalig berichtet. Die Befunde stellten eine Sensation dar, weil bisher in europäischen Arten das Alkaloid noch nie nachgewiesen werden konnte. Bis zu dieser Zeit lagen nur positive Nachweise der Substanz in Psilocybe-Arten aus Mexiko, aus Asien und Nordamerika vor.
Vor 1963 wurden die Pilze jedoch auch schon regelmäßig in verschiedenen deutschsprachigen Standardwerken der Mykologie beschrieben. Dazu noch einige Beispiele: In Abb. 6/7 (S. 13) stehen sich zwei Beschreibungen im Abstand von etwas mehr als sechzig Jahren gegenüber. Interessant, dass die zweite Beschreibung aus dem Jahre 1962 die Anmerkung „wertlos“ trägt – aus heutiger Sicht eher amüsant! Aber das Wissen um die englischen Intoxikationen drang dennoch nicht dauerhaft ins deutsche Schrifttum ein. Die vorzüglichen Beschreibungen von Michael/Schulz (1927) und von A. Ricken (1915) bilden eher die Ausnahme (siehe nebenstehende Abb. 10 und 11). Interessanterweise ist aber in der hier vorgestellten ältesten Quelle vor 1900 das Buch von Sowerby aus dem Jahre 1803 noch als Referenz zitiert. Die Beschreibung der Pilzart im Jahre 1977 zeigt, dass bis auf zusätzlich erwähnte mikroskopische Details die Pilzart heute eher wieder flüchtiger differenziert wird (Abb. 12 auf S. 23).

Abb. 10 Die vorzügliche Psilocybe-semilanceata-Beschreibung von Michael/Schulz (1927).

Abb. 11 Rickens Definition der Psilocybe-Art (1915).
Auch die farbige Zeichnung der Pilze aus dem Jahre 1927 kommt dem tatsächlichen Habitus der Fruchtkörper sehr nahe (siehe Umschlagrückseite).
1967 und 1969 konnte das Psilocybin auch in Pilzproben aus Schottland und England nachgewiesen werden. Michaelis berichtete 1977 dann über die Detektion des Alkaloides in Extrakten aus deutschen Aufsammlungen (Abb. 13, S. 24).
Ab 1979 wurden in verschiedenen Ländern quantitative Untersuchungen des Alkaloidgehaltes der Pilzarten unter Anwendung modernster Methoden (HPLC) durchgeführt, auf die an anderer Stelle noch eingegangen wird.
Man kann heute sagen, dass die Psilocybe semilanceata der psychoaktive Pilz Europas hinsichtlich Verbreitung, Erforschung und Anwendung ist. Guzman schätzt in seiner Monographie 1983 ein, dass die Art die weltgrößte Verbreitung unter allen psychoaktiven Psilocyben hat. Der Pilz kommt in Amerika, Europa, Australien und Asien vor. In vielen Ländern ist die Pilzflora so mangelhaft erforscht, dass über die Verbreitung solcher kleiner Arten erst recht nichts ausgesagt werden kann.
Es werden Funde aus folgenden europäischen Ländern beschrieben: Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich, Russland, Polen, Ungarn, Rumänien, Schottland, England, Wales, Italien, Spanien, Irland und die frühere Tschechoslowakei.
Hier muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass für solche kleinen europäischen Arten, die neben vielen ähnlichen Pilzen wachsen, keine umfassenden Verbreitungskarten existieren. Der sarkastische Satz „Die Pilze kommen häufig vor, wo auch die Mykologen häufig sind“ trifft besonders auf die Psilocybe-Arten zu. Die Gattung fristete vor der Entdeckung des Psilocybins eher ein Schattendasein in der Literatur, und heute beschäftigen sich auch nur wenige Mykologen mit ihr. Daran ändert auch nichts, dass Psilocybe semilanceata wahrscheinlich die häufigste und auffälligste Sippe unter den Arten darstellt. Pilzfreunde mit anderer Intention (Kapitel 6.4.) lassen ihr Wissen gewöhnlich nicht in Verbreitungskarten verewigen.
Jedoch existiert aus dem Jahre 1986 auch eine Verbreitungskarte über das Vorkommen der Pilzart in Deutschland (S. 18).
Aus Ostdeutschland sind kaum Fundorte der Psilocybe-Art publiziert worden. Ich fand den Pilz in den verschiedensten Gebieten, so im Vorharz bei meiner Heimat Mansfeld, in der Dübener Heide, in weiteren Heidelandschaften sowie in Thüringen. Funde aus den anderen Landesteilen sind mir von befreundeten Mykologen bekannt. Schon Buch berichtete 1952 detailliert über Funde aus Sachsen (Abb. 15, S. 25).
Das üppigste Wachstum der Psilocybe-Art lässt sich auf im Wald gelegenen feuchten Weideflächen feststellen. Nach meinen Erfahrungen findet man die Art von Ende September bis Oktober in den meisten größeren Waldgebieten auf sauren Böden im Gras, an Wald- und Wegrändern, meist zu wenigen Exemplaren oder in kleinen Trupps bis zu 30 Pilzen. An solchen Stellen lässt sich dann regelmäßig auch Tierkot wie z. B. von Rehen nachweisen. Die Pilze wachsen nie direkt auf frischem Dung. Ausgesprochene Kümmerformen können an Chausseerändern im Gebirge gefunden werden.
Die Myzelien können alte Kuhweiden im Wald ausgedehnt durchziehen, wie sich an der Größe der Areale der Fruchtkörper dann ablesen lässt. Bei entsprechender Feuchtigkeit ist mit einer maximalen Fruktifikation der Art zu rechnen, wenn wenige Wochen zuvor die Grasflächen noch einmal mit Kühen beweidet werden.
Jedoch wachsen die Pilze auch auf entsprechend gelegenen Pferde- oder Schafweiden. Sehr häufig sind auch diese im Wald gelegenen Grasflächen ebenfalls Weideplatz von Rehen, die den Boden noch zusätzlich düngen. Jedoch kommen die Pilze nicht an Standorten vor, wo Kunstdünger zum Einsatz gelangte. Solche Weiden sind oft von Bächen oder Mooren begrenzt, die den Boden stark durchnässen. Im Sommer bewirkt das gleichzeitig hohe Wärmeangebot in diesen feuchten Schneisen ein optimales Wachstum der Myzelien. Die Pilze kommen von den Meeresküsten bis ins Hochgebirge vor, eine Angabe aus 1720 m NN stammt auch aus Deutschland (Messtischblatt-MTB-8443, 1985). Die Fundhöhen streuen in der früheren Tschechoslowakei von 330–1000 m Höhe, einmal 1400 m, ohne dass eine bestimmte Höhenlage bevorzugt erscheint. Hier sind 54 Aufsammlungen aus 44 Orten bekannt (letzter Stand 1986). Im Gegensatz zu anderen Pilzarten wie dem Zuchtchampignon hat die Psilocybe-Art offensichtlich einen größeren Temperaturbereich, in dem sie fruktifizieren kann.
Man kann davon ausgehen, dass die Pilze in allen deutschen Bundesländern ziemlich verbreitet sind, wenn auch nirgends wirklich sehr häufig und dicht. Eine Grenze für das Wachstum der Art ist offensichtlich das limitierte Vorkommen von Dung in den für die Verbreitung sonst optimalen Lokalitäten. Wahrscheinlich hat sie sich auch in den letzten Jahrzehnten dadurch nicht bei uns ausgebreitet, die Häufigkeitsbeschreibungen in der älteren Literatur entsprechen den heutigen Beobachtungen. In der Schweiz kommt die Art überall vor. Da diese Weiden hauptsächlich im Jura zu finden sind, herrscht oft die irrtümliche Meinung vor, dass die Pilze nur in etwa 1000 m Höhe vorkommen.
Trotzdem kann die Psilocybe semilanceata vereinzelt an Standorten mit optimalen Bedingungen sehr stark fruktifizieren.
Ich möchte hier auf zwei solcher Heidestandorte eingehen, die wir mehrjährig feldmykologisch untersucht haben.
An der ersten Lokalität fruktifizierte die Pilzart im sehr hohen Gras auf saurem Boden in einer Senke. Die Grasfläche lag als Schneise im Wald zwischen einem Bach und einem Moorteich. Auch noch im Herbst konnte bei Sonneneinstrahlung eine erheblich höhere Temperatur festgestellt werden als im Umland. Rehdung trug regelmäßig zur Düngung bei. Die Fruchtkörper der Erstfunde hatten durch das Wachstum im sehr hohen Gras Stiele bis zu 21 cm Länge (!), die Hüte waren so winzig, dass bei den Pilzen erst die Blauung und dann die chromatographische Untersuchung Hinweise auf die Identität der Psilocybe semilanceata lieferte. Spätere Funde ließen sich dann morphologisch eindeutig der Pilzart zuordnen. Während drei Jahren konnten jeweils zur Herbstzeit 30 bis 60 Pilze gefunden werden, dann erfolgte leider eine Vernichtung des Standortes durch Umgestaltung der Moorabstichstelle zum Moorlagerplatz mit Zufahrtsstraße.

Abb. 12 Pilzbeschreibung nach Michaelis (1977)
Der zweite Standort wurde nur einen Kilometer entfernt im gleichen Jahr entdeckt und anschließend während 15 Jahren untersucht. Früher weideten regelmäßig Kühe auf der sehr großen Wiese im Wald neben einem Bach, der den Boden stark durchfeuchtet. Heute weiden gelegentlich Schafherden dort, und im Gras findet man regelmäßig Rehdung. An dieser Lokalität fruktifiziert die Pilzart sehr üppig. Hunderte von Fruchtkörpern wachsen jeden Herbst auf dieser Wiese (Farbbild 1.2).
In drei Jahren konnten etwa 2800 Pilze (ca. 140 g) bei je drei Begehungen pro Jahr von Ende September bis Mitte Oktober gefunden werden. Einige Fruchtkörper stehen zwar frei auf dem Boden (Abb. 16, S. 27), der größte Teil wächst jedoch direkt in den Grasbüscheln (Abb. 17, S. 27; Farbbild 1.3.) und war so leicht zu übersehen.

Abb. 13 Erste Publikation über den Psilocybingehalt deutscher Pilzproben.
Bei trockenem Wetter sind die Pilze verhältnismäßig gut zu erkennen. Durch die ausgeprägte Hygrophanität verändert sich die Hutfarbe bei Nässe in dunkeloliv-schwarzbraun. Nur durch genaue Betrachtung der Blätter und der elastischen, gekrümmten Stiele können die Pilze dann von Düngerlingsarten (Kapitel 2.4) differenziert werden. Ein besonderes Merkmal ist, wie bei vielen andern Pilzarten, die psychoaktiv wirken, eine allerdings verhältnismäßig gering auftretende Blaufärbung des unteren Stielteiles und teilweise des Hutes, besonders bei Nässe (Kapitel 4). Bei alten, nassen Fruchtkörpern können durchscheinend blaue Flecke spontan auf den Hüten auftreten, während die Stielverfärbungen meist erst durch das Abtrennen der Fruchtkörper von den Myzelien nach 30 bis 60 Minuten sichtbar werden. Ich fand auch bei Massenvorkommen immer blaugrün verfärbte Pilze gemeinsam mit solchen, die dieses Merkmal nicht aufwiesen. Die Blaufärbung bleibt beim Trocknen der Pilze unter teilweiser Ausblassung erhalten.
Die hier zitierten Pilzbeschreibungen aus früherer Zeit sind so detailliert, dass ich keine bessere hinzufügen könnte. Im Gegensatz zu mancher Literaturmeinung verströmen die feuchten Fruchtkörper beim Öffnen des Behältnisses sehr wohl einen Geruch, der ähnlich, aber schwächer als bei Psilocybe bohemica (Kapitel 2.3) als rettich- bis mohnartig beschrieben werden könnte und nicht unangenehm wirkt.
Auch zeigen die Pilze noch eine Besonderheit, die bei andern Arten kaum untersucht wurde. Unter dem Licht einer Quarzlampe fluoresziert die Psilocybe-Art – der verursachende Stoff konnte aber bis heute nicht identifiziert werden.
Wahrscheinlich ist Psilocybe semilanceata der psychoaktivste Pilz unter den europäischen Arten. Die eindrucksvolle und rapid einsetzende Wirkung kommt nicht nur in den zitierten Intoxikationen aus England, sondern auch in der folgenden Schilderung des ersten Selbstversuches eines Mykologen zum Ausdruck:
Nach der Aufnahme von nur 1,3 g der getrockneten und gepulverten Pilze (30 Exemplare) in Wasser setzte nach 20 Minuten bei nüchternem Magen sehr plötzlich und unerwartet unter starkem Tränenfluss die Psychose ein. Die Erscheinungen kann man am besten als eine Verknüpfung von Visionen und Gedanken bezeichnen – später fand ich den Begriff der „Imagination“ in der Literatur. Äußerst unangenehm wurde von mir nach der Art eines Tagtraumes ein Flug erlebt, bei dem mich an jedem Arm eine Hexe gepackt hatte… Wir flogen zu dritt irgendwann und irgendwo. Danach sahen alle umliegenden Gegenstände wie ausgebleicht aus. Bei Augenschluss wurden abstrakte Ornamente ohne besondere Leuchtkraft oder emotionale Wirkung gesehen. Während dieser Zeit trat weitere Dysphorie verknüpft mit schuldbewusstem Grübeln auf. Nach fünf Stunden war die Wirkung plötzlich vorüber, allmählich stellte sich leichter Kopfschmerz ein, weitere Folgen wurden nicht festgestellt.
Ein zweiter Versuch mit der halben Dosierung beeindruckte dagegen durch das Aufsteigen von Erinnerungen bei gleichzeitigem Wiedererleben von Kindheitsgefühlen und eigenartigen Verschmelzungsgefühlen:

Abb. 14 Psilocybe semilanceata von einem Heidestandort im Jahre 1989 (491 Pilze).
An einem Spätsommertag nahm ich 0,6 g des Pilzpulvers in der Natur ein. Das Wetter war sonnig und sehr warm, ich wanderte durch meine Heimatlandschaft, in der ich schon oft als Kind gespielt hatte. Plötzlich verspürte ich einen emotionalen Zustand, der am ehesten als eine kindliche Anschauungs- und Gefühlswelt zu dem mich umgebenden Wald beschrieben werden könnte. Die Umgebung wirkte besonders scharf konturiert, mein Blick erschien mir frisch und unverbraucht. Ich erinnerte mich plötzlich sehr detailliert, wie klein die Bäume vor Jahrzehnten gewesen waren, wie vor Dunkelheit dort kaum anderes Wachstum zu beobachten war, was mich teilweise geängstigt hatte. Gleichzeitig kamen mir meine Bewegungen viel kindlicher und elastischer vor. Der beglückende Zustand als Wiedererleben der Kindheit hielt etwa zwei Stunden an. Auf dem Heimweg sah ich ein Kälbchen auf der Weide. Es erweckte bei mir großes Mitleid, als ich sah, wie es unter den lästigen Fliegen litt. Dieses Mitempfinden steigerte sich kurzzeitig zu einer Art Verschmelzungsgefühlen mit dem Kalb, die ich als sehr sonderbar und nicht besonders angenehm empfand. Nach vier Stunden war die Wirkung ohne Folgen abgeklungen.

Abb. 15 Gute Beschreibung der Psilocybe semilanceata aus Sachsen durch R. Buch.
Ein drittes Pilzexperiment mit Psilocybe semilanceata in Oregon führte schließlich zu einer vollständigen Identifikation mit einer Person des 19. Jahrhunderts:
Wir sammelten eine große Menge „liberty caps“ auf einer Weide nahe Astoria. Später, im Haus, aß ich nicht mehr als 6 frische Pilze. Der Schlüsselreiz für das spätere Erleben kam von der Betrachtung eines Bildes, das als Aquarell eine elegante Lady im vorigen Jahrhundert zeigte. Dieses induzierte die plötzliche Erkenntnis, eine frühere Inkarnation im vorigen Jahrhundert gelebt zu haben. Ich wusste, dass ich 1813 in Deutschland als Alexander Schmitt geboren wurde und 1871 in Kentucky, USA, starb. Als Kind wanderte ich mit den Eltern und weiteren Emigranten per Schiff aus und änderte in den USA meinen Namen in Smith. Ich lebte dann als Holzfäller in einem kleinen Ort namens Sharpville, vielleicht auch geschrieben Shopville. Das Leben war hart und voller Entbehrungen, ich trank eine Menge Alkohol. Diese Umstände prägten meinen Lebensstil, der auch Schläge und andere Tyranneien gegenüber meiner Ehefrau einschloss. Als sich das Erleben vertiefte, erfolgte eine komplette Identifikation mit A. Smith. Während dieser Zeit erfolgte ein Wiedererleben in so vollendeter Form, dass ich nur noch englisch denken konnte, die ursprüngliche deutsche Sprache existierte nicht mehr. Schließlich wurden die letzten Stunden von A. Smith erlebt. Ich lag (er!) in weiße Bettlaken gehüllt und war sehr krank. Plötzlich wusste ich, dass meine Frau sich für die jahrelange Tyrannei gerächt und mich vergiftet hatte. Glücklicherweise war das Erleben dann zu Ende und ich erlebte den Tod selbst nicht mehr. Nach drei Jahren steht dieses Experiment als gültig in jedem Detail vor meinem geistigen Auge und hat meine Einstellung zum Tod nachhaltig verändert und vor allem relativiert.
Solche Erfahrungen können innerhalb des existierenden Weltbildes, das von den Naturwissenschaften determiniert wird, nicht erklärt werden. In jedem Fall sollten aber Versuche unternommen werden, entsprechende historische Personen und Plätze zu eruieren. Die betreffende Person hatte zu dem Staat Kentucky überhaupt keine Beziehung und war auch noch nie dort. Die historischen Orte konnten nicht aufgespürt werden, können durchaus aber im vorigen Jahrhundert existiert haben, denn immerhin fielen ihm einige Orte mit „ville“ als typisch auf, auch das war ihm vorher nicht geläufig. S. Grof beschreibt in seinen bekannten Büchern über das wissenschaftliche Studium der Wirkung von LSD ähnliche frühere Inkarnationen, deren Auftreten, meist im Laufe einer Applikationsserie, er als nicht selten erwähnt. Er regte die vorurteilsfreie Erforschung des Phänomens an. Erschwerend kommt bei solchen psychologischen Versuchen aber hinzu, dass diese Erlebnisse nicht gezielt induzierbar sind, sie ergeben sich scheinbar zufällig.
Abschließend noch ein kurzer Erlebnisbericht, der ebenfalls zeigt, dass je nach Persönlichkeit und Umgebung die Wirkung immer anders nuanciert ist:
Nach der Aufnahme von 0,6 g Pilzpulver in Orangensaft begann die Wirkung nach 30 Minuten: Eine endlose Folge von Bildern vor geschlossenen Augen. Dabei wurden weder auffällige euphorische noch dysphorische Stimmungslagen beobachtet; am ehesten kann mein Verhältnis zu diesen Erscheinungen „zeitweises Staunen“ genannt werden. Die anfänglich verschlungenen Ornamente wandelten sich im Laufe der Zeit in Pflanzen um, von denen aber einige unwirkliche, auf der Erde nicht bekannte Merkmale aufwiesen. Ich denke, die Bilder waren eine Wiederspiegelung meiner langjährigen Beschäftigung mit der Pflanzenwelt. Als mir dann ein Spiegel vorgehalten wurde, sah mich „ein finster aussehender, starr schauender Bursche“ an. Dann stellte ich etwas widerwillig fest, dass ich im Alltag auch so wirke und mich bemühe, dass man bei mir „nicht so dahintersieht“. Der Versuchsleiter bestätigte mir meinen eigenen Eindruck. Vorher hatten wir nie darüber gesprochen.

Abb. 16Psilocybe semilanceata auf grasigem Boden.

Abb. 17Wachstum der Pilze in Grasbüscheln.