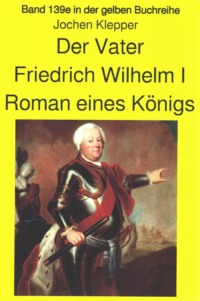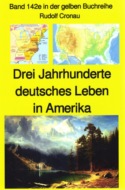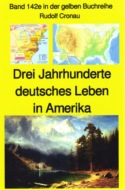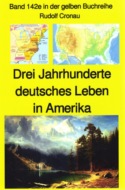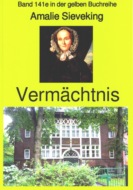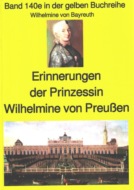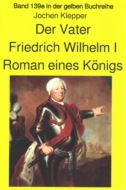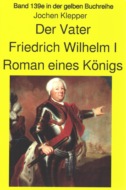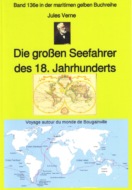Kitabı oku: «Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs», sayfa 6
Der königliche Bräutigam selbst war von nun an viel bedrückter, dass niemand etwas von der Schwangerschaft der Schwiegertochter gemerkt haben sollte; dass man ihn in die neue Ehe gehetzt hatte; dass so entgegengesetzte Männer wie der Fürst von Anhalt-Dessau und Herr von Grumbkow – die beiden fähigsten und unbequemsten – plötzlich zueinander fanden, dies alles machte ihn betroffen. Er fühlte sich verraten und verkauft, ohne zu wissen, an wen, von wem und für welchen Preis. Immer wieder wurde ihm der Kronprinz als der Stein des Anstoßes und Grund allen Ärgernisses genannt. Hass setzte sich in ihm fest. Weil er sich nicht mehr hindurchfand durch die Wirren, Lügen und Gefahren, hielt er sich an die einzige Erklärung, die man ihm gab: Der Sohn war schuld, der Sohn, der Sohn, der Sohn.
Der Kronprinz begann sich bei den neuen Gefährten bitter zu beklagen: „Ich habe es nicht verdient, wie um der Ungnade des Königs willen alle diese Canailles hier mit mir verfahren. Sie müssen wissen, dass ich wenig und bald gar nichts mehr zu sagen haben werde. Der König glaubt, ich wäre ein Verräter. Meine Freunde dürfen nicht von mir sprechen, wenn sie sich nicht beim König in Verdacht bringen wollen. Wenn ich nur nicht hier wäre und müsste alle die Schelmereien mit ansehen, wie sie unseren guten König betrügen, so wäre ich zufrieden. Hier kann nur Gott noch alles gutmachen!“
Aber der König und die Seinen taten übel.
Und dennoch ließ der König den Kronprinzen seinen Unwillen noch nicht in den letzten Folgerungen auskosten. Wenn nun sein drittes Kind, auch noch so unerwünscht, geboren werden würde und gar ein Knabe wäre, so sollte ihm alle gebührende Ehre erwiesen werden. Denn Preußens erster König ehrte ja sich selbst und sein Werk, wenn er dem Thronfolger und des Thronfolgers Sohn huldigen ließ. Ach, Glanz und Unsterblichkeit über seinem jungen, noch von aller Welt verachteten Königshaus! Friedrich I. atmete tief. Er söhnte sich aus mit dem Gedanken, es möchte nun doch wieder ein Knabe sein.
* * *
Es war ein Knabe.
Am Abend seines eigenen Geburtstages war der Kronprinz allein zurückgeblieben. Eine lange Sommernacht hatte er auf den Schrei des neuen Menschen und das Licht des neuen Tages geharrt. Als es hell war, sank er in Schlaf – unentkleidet, ungewaschen sogar gegen seine selbstverständliche Gewohnheit.
Und nun beglückwünschten sie ihn, wie sie ihn gestern kaum mit Gratulationen bedacht hatten.
Ein Sohn sei es, ein schöner Sohn.
Natürlich, das mussten sie sagen. Friedrich Wilhelm lachte.
Aber beim Anblick des Kindes verlor sich das Lächeln; kaum dass er auf die junge Mutter achtete. Dort lag noch einmal sein erster Sohn. Es strömte ihm glühend über das Herz: Gott konnte alles wiedergeben, was er nahm. Der Sohn war wiedergekommen! Er blieb tief über ihn gebeugt. Nein, es war doch ein anderer, ein ganz anderer – die Augen waren noch dunkler zwischen Schwarz und Blau und waren klarer, der Mund schien kräftiger geschwungen, Stirn- und Backenknochen waren stärker ausgeprägt; und runder war er; und lauter im Schrei; und lebenskräftiger – oh, es war ein ganz anderes Kind! Sein Sohn! Sein Geburtstagsgeschenk! Sein Friedrich Wilhelm! Man konnte ihn schon recht fest anpacken. Er ließ sich schon streicheln und ein ganz klein wenig drücken. Er brummte dem Kleinen ins Ohr, ob er es sich merken würde – Friedrich Wilhelm! Friedrich Wilhelm! Und was für ein pünktlicher kleiner Soldat – genau am ersten Tage im neuen Lebensjahr des Vaters angetreten! Solche Dinge schwatzte der Kronprinz überglücklich und töricht.
Die Kronprinzessin, vierundzwanzigjährig, lächelte milde und weise. Sie kam sich so viel reifer vor als der dreiundzwanzigjährige Vater. Übersah er denn ganz die großen Aspekte dieser Stunde? Die regierende Königin war zum Eindringling im jungen preußischen Königshause gestempelt! Auch die Kronprinzessin, auf ihre Weise, war sehr glücklich.
Aber das Größte an dieser Stunde des frühen Augustmorgens ging ihr verloren. Sie nahm es nicht wahr, dass Friedrich Wilhelm sie von diesem Tage an unauslöschlich zu lieben begann, sie und den Sohn.
Im Vorzimmer nahm er die kleine Wilhelmine auf den Arm und küsste sie, bis sie zu weinen und von ihm wegzustreben anfing.
* * *
Nichts drang in das Glück seines Herzens, auch das nicht, dass heute aus Ansbach und Hannover Kavaliere eingetroffen waren, zur ansbachisch-hannöverischen Hochzeit einzuladen.
Gott kann wiedergeben, was er nahm. Der Kronprinz dachte es auch hier von den Frauen wie zuvor von seinen Söhnen.
„Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen; der Name des Herrn sei gelobt“, prägte sein Herz in heißen, raschen Schlägen den Taufspruch für den zweiten Sohn, und dem jungen Vater kam nicht der Gedanke, dass dieses Wort an den Gräbern und nicht am Taufbecken gesprochen wird. Aber endlich musste eine Abordnung des Konsistoriums die Hoheit auf den peinlichen Irrtum aufmerksam machen. Da schlug der Kronprinz einen anderen Text, aus dem Evangelium des Johannes, vor: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.“
Nun war das Entsetzen noch größer. Die Locken der Amtsperücken wehten, die schwarzen Roben der geistlichen Räte rauschten.
Das Wort stand bei des toten Lazarus Erweckung. Wer wagte es dem jungen Herrn zu sagen?!
Aber er war ganz still. Es war ihm selber eingefallen. Er kannte die Schrift.
* * *
Preußen schritt von Fest zu Fest. Die neue Taufe sollte ein Höhepunkt werden. Friedrich Wilhelm aber wollte über dem Taufbecken des Sohnes die Hand des Vaters gereicht bekommen. Er aß nicht mehr; er trank nicht mehr; er magerte zusehends ab. Die Feiern wurden ihm zur Qual und zum Gericht. Im Festgeläute hörte er das Wimmern der Armesünderglocke von Küstrin. Statt des goldenen Kirchenschmuckes sah er nur den Galgen im Rauschgold, und der Purpur um die Schultern des Täuflings wurde ihm zum Flittermantel des Goldmachers, in dem man ihn zur Richtstätte führte.
Wieder trug ein Sohn den Reichsapfel, das Ordensband, die Krone und das Zepter. Das kleine Antlitz war wächsern; das schwankende Köpfchen wurde gestützt. Aber Predigt und Einsegnung, Namensgebung und Gesang, heroische und sakrale Musik nahmen gerade erst den Anfang.
Friedrich Wilhelm suchte sich aus dem Kreise der Paten und Gäste zu lösen; Schritt für Schritt, dass keiner es bemerkte, wollte er seinem Kinde näherkommen bis an die Stufen des Taufsteins.
Als sie den Knaben über das silberne Becken mit dem geweihten Jordanwasser hielten und die Krone emporhoben, das Haupt des hohen Kindes mit den Tropfen der heiligen Flut zu netzen, sah er den blutenden Riss. Dort, wo der Rand der Krone sich in den bleichen Schläfen breit und dunkel abgezeichnet hatte, war das Wundmal eingegraben. Sie senkten die Krone auf das ungestillte Blut.
Noch schrie der Vater nicht, noch gebot er nicht Einhalt. Aber die um ihn wussten es sofort, dass etwas Furchtbares geschehen würde. Gewaltig, aufgereckt und totenblass stieß der Kronprinz sie zur Seite, mit beiden Armen griff er nach den Pfeilern zur Rechten und Linken, wie Simson einst die Säulen packte.
Aber kein Dachgewölbe, keine Wände stürzten, und die Pfeiler sanken nicht. Die Hände des jungen Vaters waren an den Stein gepresst, sein Mund war stumm geöffnet.
Dann klirrte die Krone auf die Stufen des Altars. Reichsapfel und Zepter rollten auf den Samt der Gänge, in Blumen und seidene Schleppen. Alle, die um den Taufstein standen, umringten entsetzt den Prinzen; die in den Kirchgestühlen neigten sich vor und steckten die Köpfe zueinander. Der Kronprinz schlug den Purpurmantel um sein Kind. Keiner mehr sollte es anrühren, keiner mehr es sehen. Er gab es nicht mehr her. Und aller Sohnesgehorsam war in ihm nun abgetan. Er blickte den Vater und König nicht an, er fragte nach niemand, der ihn halten oder ihm das Kind vom Arme nehmen wollte. Er durcheilte den Dom zum Portal. Am Tor war er allein, denn alle wandten sich voll Sorge nach dem König um. Dem bedeckte kalter Schweiß die Stirn und die Wangen. Zitternd lehnte er in seinem hohen Stuhl. Der Dombischof sprach milde auf ihn ein. Als er das Taufbecken umgestoßen und das Jordanwasser über die Stufen des Altars rinnen sah, erstarben ihm die Worte auf den Lippen.
* * *
Erst als die Ärzte kamen, überließ Friedrich Wilhelm seinen Sohn den Kinderfrauen. Er gab ihn den Ärzten angstvoll und schweigend. Die Ärzte hatten Furcht vor ihm. Was sie nicht verordneten! Was sie nicht erfanden! Welche Krankheiten sie nicht entdeckten!
Das Dreifache Weh hatte gute, gute Tage. Kein Kronprinz störte seine Machenschaften.
Der Kronprinz hielt zwischen seinen Räumen und den Zimmern der Gattin und des Kindes fürchterlichen Umgang, die halbe Nacht hindurch.
Ehe er frühzeitig wiederkam, hatten sie den toten Knaben schon entfernt, den Leichnam zu waschen, zu balsamieren, aufzubahren. Der Vater fand nur noch die leere Wiege. Den Kopf auf den noch nicht erkalteten Kissen seines Kindes, schlief er ein nach einer schlummerlosen Nacht.
Am Abend konnte man wie sonst mit ihm reden; nur der König hielt sich fern. Der Kronprinz stand Rede und Antwort, aber man spürte, wie ihm die Zeit zu langsam verrann, bis sie ihn endlich allein lassen würden. In der zwölften Stunde ging er mit dem Leuchter, ohne Diener, durch das Schloss. Er schritt so rasch, dass alle Kerzen flackerten und wirre Schatten warfen in dem langen, hohen Gang. Vor der Treppe zur Kapelle stellte er den Leuchter ab. Mit beiden Fäusten klopfte er an die Tür, die den Gang zu den Gesindekammern von der Galerie abschloss. Der Kronprinz wollte die Schlüssel zur Kapelle.
Kein Diener ist ihm gern gefolgt. Mitternacht, Leichnam und Kapelle – der Dreiklang ließ auch Männer schaudern. Aber dem Vater war, was die anderen entsetzte, der süße Körper seines Kindes. Er suchte ihn, er leuchtete das Gewölbe ab.
Am Särglein von rohem Holze lehnten zwei wächserne Engel, seinen toten Söhnen nachgebildet, die Arme lieblich gehoben, die Lippen lächelnd geöffnet, die dunklen Augen sinnend aufgeschlagen. Ganz nackt waren sie, umschlungen nur vom Band des Schwarzen Adlerordens. Hochgeschlagene Hüte mit gewaltigen, weißen Straußenfedern hatten sie wie im Spiel auf ihre kleinen Häupter gedrückt.
„Nehmt sie weg!“ schrie der Kronprinz fassungslos die furchtsamen Diener an. Gleich danach gab er ruhige Erklärungen. Sie sollten sich nicht so töricht anstellen; dies seien die vom König dem Hofwachsbossierer für das Trauerlager in Auftrag gegebenen Figuren der verstorbenen Prinzen. Dort liege noch das Gerät des Wachsbildners, den der Abend überraschte, als er das Konterfei des kleinen Leichnams überprüfte.
Die Diener waren befreit und belebt. Neugierig leuchteten sie in den Winkel mit dem Zeichentisch, auf dem die Skizzen für das Trauerprunkbett aufgeheftet waren: auf hohem Katafalk der Sarg mit Totenkopf und Krone, Gebeinen und geflügelten Saturnsköpfen als Zier seiner Wandungen. Die wächsernen Knaben umschwebten ihn als Engel.
Der Kronprinz trat unter die Diener. Er riss die Skizzen vom Tische, warf sie in einen Winkel. Die Wachsfiguren rührte er nicht an; es war überflüssig, dass sich gleich die Diener schützend vor sie stellten. Doch den Sarg hob er auf und trug sein Kind hinweg ins Dunkel. Sie geleiteten ihn mit den Kerzen. Keiner wagte eine Frage. Keiner nahm ihm den Sarg ab. Er trug ihn in sein Schlafgemach; er stellte ihn auf den Tisch. Die Diener wies er an der Schwelle ab. Nur ein Licht ließ er sich noch reichen. Das nahm er auf den Tisch zu dem Sarge. Er rückte sich den Sessel heran. Er zog den Sarg ganz dicht an sich. Nun konnte er den Arm um ihn legen, ganz eng, ganz nahe um das harte, rohe Holz. Er trauerte um das Geschlecht, um seinen Vater, seine Söhne. Das Land brach zusammen. Seine Söhne starben.
Morgen sollte der Knabe in goldenem Sarge ruhen, auf hohem Katafalk, bei Fackeln und Engeln. Ach, dass solche Feier nicht mehr wäre! Er wollte kein Fest des Goldes und des Todes mehr. Ach, dass er sein Kind noch diese Nacht im Garten vergraben dürfte! Niemand sollte es finden.
Schon erhob er sich. Aber als er aufstehen wollte, standen die Frauen in der Tür. Viele Leuchter wurden über sie gehalten. Er sank zusammen. Er war wie ohne alle Kraft. Nur der Arm um das Särglein blieb stark. Seine Blicke, weil sie vor den Frauen flohen, blieben auf dem toten Kinde haften. Es war im Sarge vom Tragen und vom Niederstellen zur Seite gefallen; nun schien es lebend, schlafend. Nichts, nur dies sah der Vater.
Die Kronprinzessin schluchzte auf. Die Ansbacherin stand schweigend, beide Arme um die Schwägerin geschlossen, so dass die eigenen Hände wieder ineinandergriffen. Noch spät in der Nacht hatte sie bei der Trauernden geweilt. Da hatten die Frauen die Diener gehört und das grausige und seltsame Tun des Kronprinzen erfahren. „Wir müssen zu ihm“, hatte die Ansbacherin gesagt, und die Kronprinzessin war ihr gefolgt, von ihr gestützt, von ihr geführt und weinend.
Die künftigen Königinnen von Preußen und England hielten einander umschlungen. Der Kronprinzessin verschleierten Tränen den Blick. Die Augen der Ansbacherin waren tränenlos und klar. Sie sah den Mann, den Tisch, den Sarg, das Licht. Sie atmete zitternd, doch beherrschte sie ihr Stöhnen.
Friedrich Wilhelm wandte den Kopf auf sie zu. Regungslos blieb er sitzen, zusammengesunken, den Arm um den Sarg gelegt, den leeren, schweren Blick auf die Frauen gerichtet.
Die Ansbacherin presste den Leib der Schwägerin an sich. Gib ihm Kinder, immer wieder Kinder, gib ihm den Sohn, riefen alle Sehnsüchte, schrie alles Mitleid in ihr. In einem einzigen Schlage ihres Herzens begriff sie, dass sie von dem Blicke dieses Mannes niemals loskommen würde, was auch verloren und beendet, was auch an Glanz des Welfenhauses über ihr verheißen war.
Sie bebten alle vor dem Morgen, am bangsten der König. Um Mitternacht war ihm schon gemeldet worden, was sich in der Kapelle begab.
„Gott gnade ihm vor dem Sohn“, flüsterte der Hof.
Der Hof tat alles, die Wirren und Leiden dieser Stunden in weite Zukunft hin zu mehren.

Graf Alexander Dohna
Gott gnade dem Hof vor dem Sohn, dachte Graf Dohna, der Hüter dieser Prinzenkindheit.
Ein Wort des Knaben Friedrich Wilhelm war wieder im Umlauf: „Der Teufel hole mich! Wann ich werde groß werden, will ich sie alle miteinander aufhängen lassen und ihnen den Kopf abhauen!“
* * *
Der Plusmacher
Der Plusmacher
Siehst du einen Mann behend in seinem Geschäft,
der wird vor den Königen stehen
und wird nicht stehen vor den Unedlen.
Ein König, der die Armen treulich richtet,
des Thron wird ewig bestehen.
Die Bibel
In allen Erlassen aus den letzten Regierungsjahren König Friedrichs I. war Friedrich Wilhelms Ernst und Eifer zu spüren. Der Vater begann sich dem Sohne zu fügen; langsam schwand er hin.
Nach der Beisetzung des Enkels, die trotz aller Vorbereitungen nun plötzlich lückenhaft und übereilt schien, war Graf Dohna zu ihm gekommen, außerhalb jeder Audienz, und hatte zu ihm vom Kronprinzen geredet wie in der Knabenzeit des Thronfolgers – Dohna, der vor der Aufgabe, den ungeratenen Sohn König Friedrichs I. und Königin Sophie Charlottes zu erziehen, einst fliehen wollte und endlich seinen Kohl zu bauen und zu sparen begehrte. Er allein kannte die Leiden des Knaben; oft hatte er den Widerspenstigen, der für den Prunk empfänglich gemacht werden sollte, aufs tiefste bedauert; das Silberservice des kleinen Prinzen war so schlecht gewesen, dass Graf Dohna häufig mit dem eigenen hatte aushelfen müssen; der Kurprinz, als er Kronprinz wurde, verfügte nur über zwölf Hemden und sechs Nachthemden; das meiste davon war schlecht. Achtundzwanzigmal in einem Monat musste der Thronfolger mit dem König zur Komödie gehen und die Stunden vor dem Theaterbesuch mit Tanzunterricht hinbringen. Da hatte der Knabe aufbegehrt: „Euer Tanz lehrt mich nicht regieren!“ Denn bei allen Dingen, die er trieb, wollte er einsehen, wozu es geschah.
Er hatte sich dagegen aufgelehnt, dass sein Lehrer Rebeur, der ihm den Lebenslehrsatz einprägte und vorlebte „Tugend adelt den Menschen“ von seinem Tische ausgeschlossen blieb. „Ihr seid ein wahrer Edelmann“, rief das königliche Kind, „wie kommt es dann, dass Ihr nicht an meiner Tafel speisen dürft?“ Und er versprach dem Lehrer – den er im Überschwange seiner Leidenschaften schlug und küsste – Haus und Garten zum Trost, obwohl ihm der Ahner und Träumer Rebeur für einen Schulfuchser zu reinlich war.
Aber das schöne Wort von Adel und Tugend hatte den Prinzen noch nicht mit seinem ganzen Herzen begeistert. Da war noch ein anderes Wort, das ihm zum Lieblingsspruch wurde: Deum time – Fürchte Gott! Und fortan verlangte er nie mehr den Teufel zu sehen. Er hatte immer wieder den Anblick des Satans zu erzwingen getrachtet, bis man endlich einen alten, bösen Raben die zarten Wangen und Hände des Knaben zerhacken ließ. Jenes als lügnerisch verschriene, zornige, ja oft rasend scheinende Kind, das angesichts aller Schuld und allen Übels im Reiche des Vaters aufschrie: „Unser Herr Gott ist ein Teufel! Ich will Gott quälen; ich will katholisch werden!“ hielt dennoch streng darauf, dass Gefolge und Dienerschaft allmorgendlich bei ihm zur Hausandacht erschienen. Und hatte der Knabe Friedrich Wilhelm Gäste bei sich, so pflegte er das Gespräch gern immer wieder auf religiöse Dinge zu bringen. In seinen sehr sorgfältigen Tuschereien aber malte der verwahrloste kleine Bursche mit den übergroßen, ernsten, blauen Augen und dem stets leicht träumerisch geschürzten Mund einen Altar, auf dem Bibel und Gesetzbuch aufgeschlagen lagen. –
Daran gemahnte Graf Dohna vor dem König. Es waren offene und kühne Worte gewesen, die den alten, nüchternen, gleichmäßigen, in jedem guten Dienste treuen Grafen wieder jünger scheinen ließen. König Friedrich reichte ihm lange die Hand. „Wollte Gott, dass alle, die sich mir nähern, so herzlich mit mir sprächen; allein das ist das Los der Fürsten, die Wahrheit nur durch die trüben Nebel der Verstellung und Kabale zu erblicken.“
Der Kronprinz dankte dem alten Erzieher sehr bewegt. Er habe ihm das Leben gerettet; denn Vater und Sohn zugleich zu verlieren, das vermöchte er nicht zu ertragen. Ohne die Versöhnung mit dem Vater wäre er in tödliche Schwermut verfallen; in all der Wirrnis und dem Elend brauche er aber Taten, Taten, die der König ihm aufgab.
König Friedrich beriet sich kaum mit seinem Sohn; er erteilte ihm einfach Vollmachten. Die Korrespondenten der auswärtigen Höfe hatten aus Berlin zu melden, dass die „Intrigen und herrschenden Fraktiones bei Hofe seit einiger Zeit gänzlich ruhten, indem des Kronprinzen Kredit und Autorität jeden zwischen Furcht und Hoffnung hielte und alle insgesamt obligiere, in ihren Demarchen große Vorsicht zu gebrauchen.“
Den Kronprinzen dagegen kam das Lachen an, wie die Blackschisser konfus wurden, als wenn das ganze Land schon verloren wäre.
Denn König Friedrich ging auf eine weite Reise und ließ dem Sohne das Land.
Es war nur eine armselige Macht, die König Friedrich seinem Sohn verleihen konnte; vor den großen Mächten blieb sie ein Spott. Er überließ ihm die armselige Zahl und das unnennbare Elend von zweieinhalb Millionen Menschen; er übergab ihm ein zerfetztes Länderbündel, benachbart dem unermesslichen Russland; gelegen neben dem französischen Reich, das von den Pyrenäen bis an den Oberrhein, von dem Mittelmeer bis an den Ozean reichte; gestellt neben das unerschöpflich scheinende Österreich: groß in Deutschland, dem Orient und Italien; und unvergleichbar mit dem reichen England, dem die See gehörte mit allen umfassenden Ansprüchen des großen Inselreiches.
Des Schwedenkönigs Karl XII. geschlagenes Heer zog, von der Pest gefolgt, durch brandenburgisches Land. Berlins Protest blieb ohnmächtig. Sachsen, Polen und Russen rückten gegen Oder und Uckermark vor – Brandenburgs Truppen lagen im Spanischen Kriege der Habsburgischen Hausmacht. Der Thronfolger hatte nur zwei Reiterregimenter und ein Bataillon Fußvolk zur Verfügung und musste zuschauen, während sich fremde Heere zwölf Meilen von Berlin auf märkischem Boden bekriegten. Nichts blieb ihm als die Klage vor dem Fürsten Anhalt-Dessau: „Wir sitzen still; geht mir sehr nahe. Keine Regimenter im Lande, kein Pulver und kein Gold; und das Schlimmste, man muss sie wie rohe Eier traktieren. Die hiesigen Blackschisser, die sagen, mit der Feder wollten sie dem König Land und Leute schaffen!“
Er hatte genug, übergenug gelitten unter den Verträgen König Friedrichs und der drei Minister. Noch konnte ihm der König das so neu erst geschenkte Vertrauen mit jedem Tage wieder entziehen. Es galt, so grundlegende Veränderungen im Staatsgetriebe vorzunehmen, dass keine Sinnesänderung des Königs noch eine wesentliche Umwandlung zu bewirken vermochte.
So löschte Friedrich Wilhelm in der Zeit, da sein Vater ihn fürchtete und um Versöhnung warb, das Dreifache Weh aus. Mit dem Grafen Wartensleben durfte er noch am mildesten verfahren; dessen Hauptschuld war gewesen, dem Treiben der beiden anderen Minister nicht Einhalt geboten zu haben. Graf Wartenberg vermochte aus dem Anfang seiner Amtszeit tatsächlich Verdienste nachzuweisen; Friedrich Wilhelm billigte ihm eine Pension zu; er war bereit, sie ihm ins Ausland zu überweisen. Gräfin Wartenberg, die Gastwirtstochter, lächelte über solche Gerechtigkeit des Kronprinzen; sie nahm allein für fünfhunderttausend Taler Diamanten mit über die Grenze, Diamanten, aus Brandenburgs armem Sande gewonnen. Ihr übriger Besitz belief sich auf Millionen; doch erkannte der Kronprinz ihn als ihr unantastbares Eigentum an.

Schloss Monbijou
Nur Schloss Monbijou fiel an den König zurück; der machte es der Frau Schwiegertochter, der trauernden, jungen Mutter zum Geschenk. Reichsgraf Wittgenstein wurde verhaftet und in die Feste Spandau überführt. Sämtliche Reichsgrafen protestierten. Sie fühlten sich in dem Urteil, nicht in Wittgensteins vorangegangenem Tun beleidigt. Der Reichsgraf deckte seine Veruntreuungen; er musste die Staaten des Königs verlassen.
In das Untersuchungskomitee, das der Kronprinz eingesetzt hatte, war der Obermundschenk von Grumbkow berufen: Über die schwierigsten und undurchsichtigsten Vorgänge zeigte er sich vorzüglich unterrichtet. Zum Kabinettssekretär des Komitees hatte der Kronprinz seinen neuen Regimentsschreiber Creutz beordert.
Graf Dohna wurde zum Premierminister ernannt. Im Staatsrat fand der Redliche nur Kreaturen des Dreifachen Wehs vor. Der Kronprinz beschloss, den ganzen Staatsrat aufzulösen. Aber dieser Schritt, der das ganze Fundament der preußischen Staatsverfassung veränderte, musste mit Umsicht vorbereitet werden.
Inzwischen erging an sämtliche Regierungen des Landes ein Reskript, über den wahren Zustand des Landes zu berichten, dabei nicht das geringste zu verhehlen und die Meldungen unmittelbar zu Händen des Königs einzusenden. Meist verständigten sich die Berichterstatter untereinander, denn noch fand der Kronprinz keine Zeit, ihre Meldungen nachzuprüfen.
Leopold von Anhalt-Dessau schlug er zum Generalfeldmarschall vor.
In heimlichen Zusammenkünften mit den Gestürzten und Bedrohten klagte König Friedrich, er werde seiner alten Diener beraubt und wisse nicht, wem er sich noch zu vertrauen habe. Es wurde still um ihn. Ilgen, der unsäglich geduldige, einsichtige, tätige Leiter der auswärtigen Politik, und der Oberhofmarschall standen schon längst bei dem Neuen; Ilgen vor allem, nicht weil er zurückgesetzt war, sondern wie er sich klar eingestand, aus Voraussicht.
* * *
In diesen Tagen des Wechsels und der Wandlung, des Sturzes und Aufstiegs unternahm der Schreiber Creutz einen Selbstmordversuch. Doch zog man ihn noch lebend aus der Spree.
Der Kronprinz ließ ihn zu sich kommen. Creutz weilte schon lange in dem Kabinett, aber die Hoheit wandte sich ihm immer noch nicht zu. Der Kronprinz stand, dem Zimmer den Rücken zukehrend, am Fenster. So redete er mit Creutz.
„Glaubt Er, dass es der Ehre meines Regiments gar so förderlich ist, wenn ein neuer Schreiber kopfüber ins Wasser geht? So, so. Er will nicht mehr Regimentsschreiber sein? Er hat sich auf dem geraten scheinenden Wege um einen Posten beworben, und das Schreiben ist abschlägig beschieden worden? Es kann demnach nicht in meine Hände gelangt sein? Nun, noch gehen alle Gesuche an Seine Majestät den König. Der allein erteilt Gnaden, der allein vergibt Ämter. Der Posten, um den Er eingekommen ist, Creutz, ist auch heute dem König noch nicht verfügbar. Fünfzehn Taler mehr pro Monat liegen nicht auf der Gasse.“
Creutz nahm all seine Klugheit zusammen, und die war größer als alle Leidenschaft seines Ehrgeizes. Er schwieg, doch in Bescheidenheit und ohne Trotz. Es genüge ihm, sagte er dann, als der Kronprinz ihn entließ, wenn er das Bewusstsein mitnehmen dürfe, Seiner Hoheit gnädige Gesinnung nicht verloren zu haben.
* * *
Er hatte zu lange gehungert. Das Elend ließ ihn nicht los. Die schmalen Bissen eines Regimentsschreibers konnten diesen Hunger nicht mehr stillen. Was half es, dass er glücklich gewesen war über seinen neuen, sauberen Rock? War er nicht ein Günstling des Kronprinzen? Spürte nicht jeder: Jetzt kommt der Neue zur Macht? Aber wen trug er mit sich empor? Die großen Herren, wieder nur die großen: den Fürsten, den Grafen, den Junker; den Dessauer, den Dohna und Grumbkow.
Der Kronprinz brauchte zu all seiner Härte ein reines Gewissen. Er bat den König, das verwahrloste Amt verbrecherischer Minister auf die wenigen zu übertragen, die der jungen preußischen Krone aus kurfürstlichen Zeiten her mit Eifer dienten. Für einen Günstling bat er nicht.
Erst als er den Thronfolger als einen mächtigen Herrn am Hofe seines Vaters wiedersah, begriff es Creutz. Der Kronprinz musste schon sehr mächtig sein, wenn man in preußischen Ämtern mit fünfzehn Talern zu rechnen begann.
Für eine Nacht kehrte Creutz freien Willens in das Elend zurück, das ihn nicht losgab. Er blieb eine Nacht unter den verworfenen Mädchen seiner Gasse, unter denen die Ramen einherging wie ein stilles und erstauntes Kind und bei ihm blieb mit wunderlichen Fragen. Da war sein Sinn schon voller Geduld, aber es lag etwas Gefährliches in ihr. Noch musste er dienen. Er pries den Neuen vor der Gasse. Er pries den kommenden König, der um fünfzehn Taler feilschte. Und die verworfenen Mädchen nachts und ihre Väter und Brüder, denen sie es morgens erzählten, nickten und gaben ihm recht: „Ja, fünfzehn Taler sind viel Geld.“
In diesen Tagen verbreitete sich das Gerücht, der König habe unter dem Einfluss seines Sohnes eine ungeheure Summe für ein Pestlazarett gestiftet. Um der großen Barmherzigkeit willen sollte es den Namen tragen: La Charité.
* * *
Der Kronprinz speiste mit seiner Gattin. Über den Geschäften war es eine Seltenheit geworden. Die Kronprinzessin war ohne Vorwurf und nur erfüllt von Ehrgeiz und Stolz. Welcher Thronfolger hatte solchen Anteil an den Geschäften des regierenden Herrn wie ihr Gemahl? Zu welcher Geltung erhob er sie dadurch vor der Königin! Wie triumphierten bereits die Damen des Kronprinzlichen Hofstaates über die hochmütigen, bäurischen Mecklenburgerinnen der bigotten Königin.
Der Kronprinz sah voll Besorgnis und Liebe, wie seine Frau, zu hohen Leibes, bei der gemeinsamen Tafel immer ein wenig vom Tisch abgerückt saß, rührend und unbeholfen, wenn sie sich stärkte und labte für ihr Kind. Er erschrak vor ihrer Blässe und war zugleich beseligt, weil sie die nahenden Wehen verriet. Was war der Tod zweier Söhne vor der Fruchtbarkeit dieser Frau!
Er wollte die Pest bekämpfen und den Tod: Das kleine Leben sollte wachsen, zu jeder Stunde dieser furchtbaren Monate freudig und behütet wachsen. Niemals war größere Sanftheit in dem Ungestümen, als wenn er auf den Leib der mütterlichen Frau sah. dass sie immer wieder zwiefaches Leben war in all dem Jammer, all dem Sterben, all der Angst!
Er ließ sich die kleine Wilhelmine, die er lange vernachlässigt hatte, bringen und hob das zarte Kind mit bedauernder Geste empor.
„Sie ist anderen Kindern ihres Alters überlegen“, beharrte die Kronprinzessin, als er lachend den Kopf schüttelte, „sie ist der Abgott der Hofdamen. Sie schwatzt den ganzen Tag.“
Wilhelmine war ein Kind, wie geschaffen, präsentiert zu werden. Sie tat sofort, was Mama ihr abzulocken suchte. Sie merkte geradezu, dass man eine kleine Prüfung mit ihr veranstaltete. Alle Scherze rollten wie am Schnürchen ab. Dem Vater war alles neu. Er hielt den schwachen, kleinen, im Brokat verhüllten Körper in zärtlichen und starken Händen; er fühlte das weiche Gesicht ohne eine Scheu des Kindes an seiner Wange. Aber zugleich war es ihm nicht mehr die Tochter, das einzige Kind – das neue hielt er umklammert, den Sohn.
Die Damen unterbrachen ihn wieder mit ihrer Konversation.
Er hatte noch nicht von dem Wunder vernommen. Es fiel ein dichter Schnee in kleinen, festen Flocken, die größere Kälte verkündeten. Im Schlossgarten in Köpenick blühte die alte Agave zum ersten Mal mit einer zauberhaften Blüte von mehr denn siebentausend Blütenblättern. Der Kronprinz sah nur in den Schnee hinaus.
Die neuen Häuser der niedergebrannten Stadt Crossen waren noch nicht unter Dach und Fach, der Bau der Charité kaum begonnen.

Das Jahr ging zu Ende.
Er verabschiedete sich rasch, neue Tagesbefehle auszugeben. „Die Untertanen sollen nit übern Haufen gehen, gegen Ruin der Untertanen sollen alle guten Anstalten machen.“ So begann das erste Edikt, das er aufsetzen ließ im Namen des Vaters.
* * *
Die Wochenstube der Kronprinzessin war im stillsten Zimmer des ganzen Schlosses eingerichtet worden, über dem Turm der alten Kapelle, wo der alte und der neue Flügel zusammentrafen, hoch über dem abgelegenen zweiten Hof, in dem nur bei den großen Festen die Auffahrt der Gäste stattfand. Dort lag, durch eine Tapetentür von der reichen Büchersammlung der Königin Sophie Charlotte getrennt, das braungetäfelte kleine Bibliothekszimmer der Kronprinzessin Sophie Dorothea; dahin hatte man ihr Baldachinbett und die alte Kurfürstenwiege getragen. Die Brüstung der offenen Galerie des Hofdamenflügels verdunkelte den von Bücherwänden golden-bunten Raum selbst noch in der Mittagstunde; und nun, da ein Schneetreiben eingesetzt hatte, mussten schon sehr zeitig die Kerzen in den Leuchtern der Wandfelder brennen. Das Feuer im Kamin schlug hohe Flammen um die neuen Scheite und warf seinen Schein auf die Bücherwände und die Wiege. Der Kronprinz hob, als letzter von der Freudenbotschaft erreicht, die ganze Wiege auf die Feuereröffnung zu; die Wehmütter kreischten auf; er lachte.