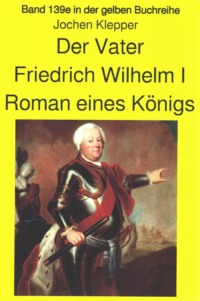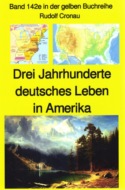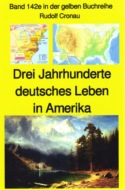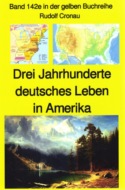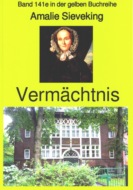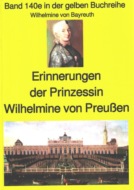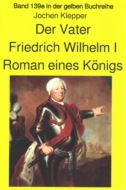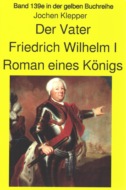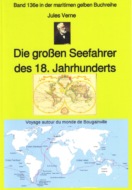Kitabı oku: «Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs», sayfa 7
„Ihr müsst ihn gut wärmen. Er hat kühle Hände. Ihr müsst ihm viel Biersuppe geben, das macht stark.“
Drohend und dabei so strahlend ließ er den Knaben den Frauen.
Am Bett der Mutter stand er still. Er knöpfte seinen Rock auf über dem brausenden Herzen und nahm aus den Taschen, was er seit dem Morgen bei sich trug für diese Stunde: die kostbaren Etuis mit dem Schmuck seiner Mutter. Er wagte kaum, die Wöchnerin zu berühren. Er schlang ihr die Ketten nicht um; er legte ihr die Perlenschnüre nur lose um ihr offenes Haar und auf die Brüste voller Milch. Er fügte behutsam die Diamantringe in ihre Hände. Nur ein Armband, strahlender als alles, streifte er fest um ihr Gelenk, den Schlag ihres Pulses zu fühlen, der immer wiederklang in neuen Menschenherzen.
„Sagen Sie selbst dem König den Namen“, bat die Wöchnerin lächelnd und begann, beseligt zu ihm aufblickend, die Ketten um den Hals zu knüpfen und die Ringe an die Finger zu stecken.
Die Hände sind noch krank, dachte der Kronprinz; dass es so schwer ist, Leben zu geben.
Wie niemals, küsste er auch heute nicht ihre Hand. Er küsste den Mund; der war wieder rot und voller Leben.
Die Wehmütter wussten nicht, wohin vor Verlegenheit.
Friedrich I. war zeitig zu Bett gegangen. Er fühlte sich unwohl und fror. Auch hatte er unangenehme Eindrücke gehabt, denn er hatte der Königin einen flüchtigen Besuch abgestattet und war sehr entsetzt, wie maßlos aufgeregt all ihre heiligen Reden waren. Sie bangte sich namenlos vor der Weißen Frau des Hauses Brandenburg.
Zum ersten Mal sah Friedrich Wilhelm seinen Vater im Bett. Er saß aufrecht, und das Hemd gab ihn noch mehr preis, als es schon einmal die Generalsuniform getan hatte. Er hatte eine hohe, schiefe Schulter. Sonst war sie von Locken und schön gerafften Falten verdeckt. Mit den knochigen, wächsernen Händen spielte er aufgeregt in den noch immer nicht ergrauten Haarsträhnen. Seine Augen waren trübe. Er blickte vom Sohne hinweg in eine Ecke.
Friedrich Wilhelm verzieh dem Vater viel. Er sah, dass er gelitten hatte.
In Haltung und Blick des Königs war etwas Zweifelndes gekommen. So saß er jetzt oft da: die wächsernen, gekrümmten Finger in den Haarsträhnen; fragend, zweifelnd, tatenlos – doch hinderte er die Taten des anderen nicht mehr. Oft saß er auch an der Wiege des Enkels, der – wie der Großvater sagte – brav schrie und recht fett und frisch war. Hier war etwas wie Vergebung.
„Er soll Friedrich heißen“, hatte der Sohn ihm versprochen, weil die Furcht des Vaters ihn bedrückte. Nun griff Leben in Leben und Name in Name. König Friedrich hütete das neue Leben, wie er, der Tatenlose, es vermochte. Er ließ ihm ein Kleid aus Silberbrokat mit Diamanten besticken, dessen Schleppe sechs Gräfinnen tragen sollten; der König würde ihn unter einem Baldachin erwarten, dessen vier Stangen vier Kammerherren und dessen goldene Quasten vier Ritter des Schwarzen Adlerordens hielten. Dem Knaben war der Titel Prinz von Preußen und Oranien zugedacht, wobei es unklar blieb, was fragwürdiger war, der Besitz Preußens oder die Anwartschaft auf Oranien. Die siebenhundert Trommeln der bisherigen Prinzentaufen aber sollten schweigen.
Auch in den Wochen nach der Taufe blieb König Friedrich an der Wiege.
Nachts, wenn er wach lag, war der König voller Angst – Angst vor der Weißen Frau. Auch die Grimasse solcher Masken muss Gott dulden. Die Gatten, König und Königin, verband nichts als die Furcht. Die Gemahlin wollte bei ihm beten, und er wies sie ab. Da verlangte sie danach, über den Schlafenden ihre bannenden Sprüche zu sagen. Noch wusste außer ihren Mecklenburgerinnen niemand am Hof um ihren Wahnsinn; und die bewachten ihr Geheimnis ängstlich. Sie beobachteten auch das Tun und Treiben des Königs für die Herrin, die fieberkrank zu Bette lag.
Der König war soeben aus seinem Betkabinett gekommen, jenem Raum, der Friedrich Wilhelm unter allen Sälen und Zimmern des Schlosses am verhasstesten war. In einem wunderlichen kleinen Tempel mit roten, damastenen Tapeten und buntem Fußboden, mit Spiegelschränken und blitzenden Kandelabern, der kleinen Kapelle oder dem Sommerzimmer, das durch eine hohe Laterne sein Licht von oben empfing, pflegte Preußens erster König vor Gott zu knien. Der Vorraum zum Gebetsgemach, ein chinesisches Kabinett mit verwirrendem Wandmosaik voller phantastischer Vögel, trug an der Tür die Tafel, dass der Eintritt in diese Appartements verboten sei, solange der König mit Gott Zwiesprache vor den Spiegelwänden halte. Nach dem Gebet zog sich der König zur Mittagsruhe in ein Stübchen seiner ersten Gattin am Ende eines langen Ganges zurück; dort hatte er durch eine Glastür einen freundlichen Ausblick auf den weinberankten Laubengang, der zu dem Alten Haus der Herzogin, dem Aufenthalt der jetzigen Königin, führte. Noch im Entschlummern gingen seine Blicke immer wieder zu der Tür hin.
Da geschah das Entsetzliche, dass er das Gespenst in ihr erblickte: wirren Haares, weiß, mit lodernden Augen und blutigen Händen, angekündigt von gläsernem Klirren. Sein Herzschlag war wie gelähmt.
Auch als sich das Furchtbare erklärte, blieb jene Mattigkeit und Dumpfheit in der Brust, und seine Knie trugen ihn nicht mehr. Die Ärzte waren um beide sehr bemüht, den König und die Königin. Diese schien gefährdeter. Das Blut war kaum zu stillen und der Schrecken, der sie vor dem Schmerz ihrer Wunden und dem Aufschrei des Königs gepackt hatte, wollte nicht mehr von ihr weichen. Noch wagten die Ärzte es nicht zuzugeben, dass der Wahnsinn offenkundig ausgebrochen war, als sie von ihrem Krankenlager heimlich aufstand, im Hemd, mit nackten Füßen auf die kalte Galerie hinausschlich und in dem Wunsche, über ihm zu beten, der gläsernen Tür nicht mehr achtete, die sie von dem schlafenden König trennte. Manchmal brach aus ihren wirren Worten noch der echte Schmerz über ihr zerronnenes Leben hervor.
Der Kronprinz empörte sich über all die Heimlichkeit um die Kranke. Er wollte ihr Leiden vor alle Öffentlichkeit gebracht wissen, um endlich die dumpfen Gerüchte um die Weiße Frau (Häufig gilt die Weiße Frau als Geist eines weiblichen Vorfahren des betreffenden Geschlechts. Im Allgemeinen gilt sie, sofern man sie nicht herausfordert, nicht als böswillig oder gefährlich. Ihr Erscheinen verursacht dennoch häufig Schrecken, da es familiäre Katastrophen, insbesondere die Todesfälle von Mitgliedern der Familie, ankündigt.) der Hohenzollern zu zerstreuen. Dem freilich gab er recht, dass der Vater seinen Tod vorausgesehen haben sollte.
Andere glaubten es mit ihm. Die Besorgnis um ihr eigenes Wohl und Wehe gab ihnen klareren Blick. Es war so weit. Der neue Herr würde kommen. Jeder Tag, den der alte König noch lebte, wurde kostbar. Man musste versuchen, noch rasch Verträge mit der Majestät zu schließen für Renten und Pensionen. Ein letztes Mal musste es gewagt sein, unter dem Schutze des todkranken Königs das Wirken des Thronfolgers abzuwenden oder aufzuhalten. Die Federn der Schreiber flogen. Die Kurierpferde jagten zum Kaiser und zu den Verbündeten. Alles war Kampf gegen Friedrich Wilhelm. Sie wollten ihm solche Lasten aufbürden, in solche Schwierigkeiten ihn verstricken, dass ihm die Möglichkeit zu freien Taten nicht mehr blieb.
Tagelang teilte die Majestät an die Familie und die hohen Staats- und Hofbeamten Gnaden aus, um ihrem Sterben Glanz zu verleihen. Der Sohn wurde erst am dritten Abend gerufen.
Er hörte die leeren Formeln ohne Rührung. Heute und morgen, glaubte er, würde der Vater noch nicht sterben. Er gab sich vorerst noch ein Schauspiel seines Todes. Als wirklich eine Besserung sich zeigte, ordnete König Friedrich Dankgottesdienste, Trinkereien und Tanzereien an. Friedrich Wilhelm ging zu seinem Grenadierbataillon, das gegenwärtig in Köpenick lag. Doch wurde er sofort zurückgerufen. Dem, der ihn weinen sah und ihn mit großer Rede trösten wollte, hörte er schluchzend zu; dann aber fuhr er ihn an: „Was hast du Hundsfott dich darum zu kümmern, dass ich doch um meinen Vater weine?!“
Nachts arbeitete er mit Creutz. Es war so spät geworden, dass der Kronprinz die Kerzen noch einmal erneuern lassen musste. Das Schloss und die Höfe lagen schon im tiefen Dunkel der kalten Februarnacht. Mitten im Rechnen sprang Friedrich Wilhelm auf, eilte ans Fenster und starrte in die Finsternis.
„Warum sind alle Kerzen angezündet? Was ist im Schloss?“ rief Friedrich Wilhelm, seinem Schreiber unverständlich, denn vor den Fenstern lag die Nacht. Er aber sah strahlende Säle. Der Regimentsschreiber sprach auf ihn ein. Der Kronprinz konnte ihm nicht glauben. Er ließ noch Diener rufen. Die standen nun frierend, übermüdet und töricht an den Fenstern. Nichts war, als tiefe, tiefe Nacht. Dem Prinzen flammte das Schloss vom Schimmer der Leuchter. Die Männer eilten mit ihm die Treppe hinab, durch die Gänge, über den ersten und zweiten Hof, sie stießen sich an Stufen und Pfeilern. Ihm war alles hell. Sie weckten noch manchen im Schloss. Keiner sah brennende Leuchter. Nur die armen Lichte, die sie mit ihren gewölbten Händen vor dem Zugwind schützten, warfen unruhigen Schein.
Im Flügel der königlichen Gemächer kamen ihnen Bediente entgegen. Sie sollten den Thronfolger holen. Die Ärzte waren beim König. Da erkannte auch der Kronprinz, dass es dunkel war ringsum und dass nur ein sehr schwacher Lichtschein aus dem Vorraum der Königszimmer zu ihm drang. Er dachte: Ich will nicht Dinge sehen, die nicht wirklich sind.
Er wollte nicht die Welt der Träume und Gesichte aufgerissen wissen. Die schwerste Wirklichkeit war über ihn hereingebrochen. Er sollte König sein, wenn er die Flucht dieser Gemächer wieder verließ. Und was bei dem Vater in seinem leidenschaftlichen Handel um die Königskrone im alten Herzogtum Preußen nur vermessener Anspruch war, wurde für den Sohn zum unentrinnbaren Auftrag: das Königtum bestand.
Der König regte sich nicht; doch sagten die Ärzte, dass er noch lebe. So ging die Dämmerung hin. Nun steckten sie überall im Schloss wirklich die Leuchter an, in den Bedientenkammern, bei den Kammerherren vom Dienst, beim Oberhofmarschall. Die Lakaien richteten die Vorsäle im Flügel des Königs her; heute noch würden sie sich mit Trauernden füllen.
Unbewegten Gesichtes stand der Kronprinz zu Füßen des Sterbebettes, noch diese Stunde und die nächste. Dann zogen als erste die Ärzte sich zurück. Sie ließen den neuen König allein.
* * *
Die vom Geblüte und vom Hofe blickten immer wieder auf die goldene Tür. Die Frist der Vorbereitung war nicht kurz bemessen.
Schweigend trat der neue König aus dem Sterbezimmer. Er neigte nur den Kopf zum Gruß und schritt schnell an allen vorüber, dem Arbeitskabinett des verstorbenen Monarchen zu.
Langsam fanden sie wieder empor aus ihren stummen Verneigungen. Der Oberhofmarschall nahm an einem Schreibtisch im Vorzimmer Platz. Seine Herren reichten ihm die angeforderten Listen. Er hatte die Inhaber aller Würden und Ämter des Hofes zu melden, die nun der neuen Bestätigung bedurften. Ein Page eilte lautlos durch die Schar der Wartenden und sprach leise mit dem Hofmarschall. Der folgte ihm sofort.

König Friedrich Wilhelm
König Friedrich Wilhelm nahm ihm die Listen ab. Er las sie mit Sorgfalt. Er legte die Blätter einzeln auf den Schreibtisch. Im Stehen tauchte er die Feder ein und zog, Seite um Seite, einen Strich durch die Würden und Namen. Die durchstrichenen Listen reichte er dem Hofmarschall zurück. Der war schweigend entlassen.
Draußen wandten sich ihm alle zu. Er blieb dicht vor der Schwelle stehen. Die Blätter zitterten in seinen Händen. Der Nächststehende nahm sie ihm ab, warf einen Blick darauf und meinte halblaut zu dem Kreis, der ihn umscharte: „Meine Herren – unser gnädigster König ist tot, und unser neuer Herr schickt uns alle zum Teufel!“ Das war das erste laute Wort am Hofe der Trauer.
Von den Ministern sprach der König nur den Grafen Dohna. Ihm gab er einige Erklärungen ab. Alle bestehenden Hofämter seines Vaters seien aufgehoben. Er brauche nicht so vielerlei Bedienung. Jedoch solle keiner sich vom Hofe entfernen, bis die Beisetzung vorüber sei. Das Amt des Oberhofmarschalls übrigens werde um der Redlichkeit des derzeitigen Inhabers willen erst mit dessen Tode erlöschen.
Während er so sprach, überflog der König die Papiere, die ihm von den Geheimsekretären seines Vaters vorgelegt wurden. Meist waren sie ihm wertlos. Er zerriss die Seiten, zerknüllte die Bogen; Fetzen und Knäuel häuften sich um ihn.
Etwas übereifrig stellte Dohna ihm die Frage, ob nicht der Fürst von Anhalt-Dessau nach Berlin zu berufen wäre.
König Friedrich Wilhelm sagte: „Nein. Aber schreibt dem Fürsten von Anhalt-Dessau, dass ich der Finanzminister und der Feldmarschall des Königs von Preußen bin. Das wird den König von Preußen aufrecht erhalten.“
Es sollte also keine neuen Günstlinge geben, und Dohna begriff nicht mehr, wie man je an seinem Zögling hatte verzweifeln wollen, ihn unfürstlich hatte nennen können.
Aus den letzten Worten seines jungen Herrn schien ihm aber noch hervorzugehen, dass er nicht mehr gewillt war, die demütigende Einschränkung auf sich zu nehmen, die in seinem Titel lag: „König in Preußen.“
Auch in den Gemächern der Königin wurde fast nur von den erfolgten Entlassungen gesprochen, abgesehen von einigen herkömmlichen Redensarten über den hohen Verstorbenen und mancher mehr oder minder versteckten Huldigung an Preußens neue Herrscherin. Königin Sophie Dorothea saß ein wenig abseits im engsten Kreise ihrer Damen. Sie trug bereits große Trauer, war sehr gnädig und ernst, sprach aber ziemlich lebhaft. Sie wartete darauf, jeden Augenblick zum König gebeten zu werden. Sie hatte einen ihrer Herren zu ihm geschickt, wann ihre Kondolation wohl genehm sei. Doch kam der König selbst. Er war dem Kammerherrn der Gattin sofort gefolgt und hatte alle Schriften liegenlassen.
Die Königin ging der Majestät bis zur Mitte des Zimmers entgegen. Friedrich Wilhelm zog seine Frau an sich und schien bewegt. „Vielleicht wird niemand ehrlicher um meinen Vater trauern als du. Ihr habt euch ausgezeichnet verstanden. Du hast einen Freund verloren, der ungleich mehr für dich tat, als ich vielleicht je zu tun imstande sein werde.“
Die Königin kam nur dazu, Bruchstücke ihrer Anrede zu stammeln. Die sollte feierlich mit „Sire“ beginnen. Aber nun hatten die Worte des Gatten alles durchkreuzt. Zudem bereitete er sie darauf vor, dass auch ihr eigener Hofstaat auf das Notwendigste beschränkt werden müsse.
Bereits am Spätnachmittag standen die Personalien der königlichen Hofhaltung fest: ein Hofmarschall; vier Generale, in Uniform, als Kammerherren; einige Kammerjunker zum Dienste der Königin. Die Königin schämte sich im Gedanken an die anderen Höfe.
* * *
Als man bemerkte, welche Anstalten für die Beisetzung Friedrichs I. getroffen wurden, schöpften Königin und Hof wieder Hoffnung. Der gesalbte Leichnam, in Goldbrokat gekleidet, war im Weißen Saal auf einem Paradebett von rotem, mit Perlen besticktem Samt acht Tage lang zur Schau gestellt. Neben dem Katafalk lagen die Zeichen der königlichen Würde. Die Marmorstatuen von zwölf Kurfürsten, welche den Weg zum Königtum bezeichneten, umstanden das Totenlager. Der ganze Saal war mit violettem Samt ausgeschlagen und verschwenderisch mit Kerzen erleuchtet. Der Sohn gab dem Vater Feste des Todes, wie der sie längst zuvor bestimmte. Nichts fehlte am Prunk und der Schönheit, die Preußens erster König sich zugemessen wähnte. Der neue König selbst erschien in strahlendem Trauermantel zu der Überführung in den Dom. Acht Pagen trugen ihm die Schleppe. Die Schweizergarde leuchtete in ihrem goldenen Schmuck. Die siebenhundert silbernen Trommeln dröhnten, die Trompeter schritten in weißen Federhüten einher. Man begriff nicht, dass der König eine alte Zeit abschloss und dass es eine Wiederkehr solchen Glanzes nie mehr geben würde.
Als der Trauergottesdienst im Dom begann, riss sich der König plötzlich von den Pagen, schlug den langen Mantel um sich, kehrte sich nicht an die entsetzten Blicke, verschwand in dem Gedränge und hockte sich in eine Kirchenbank hinter einen hohen Pfeiler, der das düstere Gewölbe eines halben Jahrtausends über sich trug. Niemand, so groß die Fülle der Menschen auch war, hatte diesen Platz begehrt, weil er den Ausblick auf das Schauspiel nicht freigab. Dort saß nun König Friedrich Wilhelm I. und sah vor sich hin; er hatte nur noch den Wink gegeben, zu beginnen. Sein hoher Podest am Katafalk blieb leer. Die Königin thronte allein bei dem Sarge. Die weiten Falten ihres schwarzen Samtgewandes hüllten neues Leben ein. Der junge König aber dachte an den Sohn, der in der Wiege lag, in der Würde, die eben noch er selbst getragen hatte: Der Kronprinz.
* * *
Kaum dass der Sarg in der Gruft versenkt war, zog der König seine Trauerkleider aus und legte die Uniform an.
Als Oberst seines Regimentes stieg er zu Pferde und stellte sich an die Spitze der Garden, die sich, solange noch die Glocken läuteten, von dem Schlossplatz am Dom zwischen der Breiten- und der Brüderstraße zur Stechbahn bewegten. Er ließ eine dreifache Salve geben, und dreifach klang sie noch weiter bei der goldenen Wachtschar der Schweizer, bei den Grenadieren am Saume des Lustgartens und bei den Kanonen auf den Wällen. Des Königs schönes Pferd trug ihn mit Sicherheit und Anmut durch das Feuer und Gedröhn.

König Friedrich Wilhelm
Der König ritt in den Kampf seiner Herrschaft, ritt aus zur Eroberung des eigenen Landes, das ihm feind war, in der niedersten Würde, die sein König und Vater ihm ließ: ein Oberst. Er ließ den Hut des Kurfürsten und die Insignien des Reichserzkämmerers daheim und nahm nicht die Krone des Königs; sein Vater war schon vor der Krönung mit Krone und Zepter einher geschritten.
Man fragte nach dem Beginn der Feierlichkeiten zur Thronbesteigung. Er erklärte, die für ein so großes Fest erforderlichen Summen für nützlichere Zwecke ersparen zu müssen. Er sprach lediglich von der Regierungsübernahme, für die zweitausend Taler Unkosten vollauf genug seien. Die Königsberger Krönung seines Vaters hatte sechs Millionen Taler von dem Lande gefordert, und als Friedrich I. sich mit seinem Hofstaat auf die Reise zur Krönung begab, wurden nicht weniger als dreißigtausend Pferde für den Transport der Menschen, Koffer und Reiseeffekten benötigt.
Nur Generalität und Garnison zu Berlin, sechs Bataillone, mussten Friedrich Wilhelm I. am Tage der Beisetzung des Vaters den Treueid schwören. Die Kurmärkische Ritterschaft war zu kurzer Huldigung aufs Schloss befohlen; die Abordnungen der Städte sollten sich auf dem Domplatz versammeln. Die litauischen und clevischen Stände aber durften erst gelegentlich nachfolgen, je nach den Reisen des Königs in seine Provinzen. Denn solche Reisen hatte er vor.
* * *
Am nächsten Morgen waren zu der ungewöhnlich frühen Stunde von sieben Uhr die Minister zum König beordert. Man rechnete mit einem neuen Strich durch die Liste.
Der König sprach zum ersten Mal in längerer Rede; man war auf Schimpfworte gefasst gewesen und erwartete sein schnarrendes „Ordre parieren – nicht räsonieren“, das schon den alten König zur Verzweiflung brachte, wenn er es den Kronprinzen von den höchsten Räten sagen hörte.
„Nach den Umstellungen der letzten Jahre“, hob König Friedrich Wilhelm ruhig an und blickte jeden von ihnen, die im Halbkreis vor ihm standen, sinnend an, „haben Sie alle dem verstorbenen König, meinem Vater, wohl gedient; ich hoffe, dass Sie auch mir das Gleiche tun werden. Ich bestätige jeden von Ihnen in seinem Amte und verspreche Ihnen, dass, wenn Sie mir treu sind, ich Ihnen gegenüber nicht nur als ein guter Herr, sondern als Bruder und Kamerad handeln werde. Es gibt aber einen Punkt, von dem ich Sie benachrichtigen muss: Sie sind an beständige Kabalen („Intrige“ oder ein „Ränkespiel“, meint also im Verborgenen betriebene Machenschaften zur Erreichung niederträchtiger Ziele) gegeneinander gewöhnt; ich will, dass sie unter meiner Regierung aufhören, und versichere Ihnen, dass ich jeden, der eine neue Intrige anfängt, auf eine Weise bestrafen werde, die Sie in Erstaunen setzen wird. Man muss dem Landesherrn mit Leib und Leben, mit Hab und Gut, mit Ehre und gewissen dienen und alles daransetzen – außer der Seligkeit. Die ist für Gott. Aber alles andere muss mein sein.“
Er legte Dohna und Grumbkow Schwert und Krone, wie er sagte, in die Hände – doch keiner seiner Anhänger kam an die Leitung. Wenn einer hoch in Gunst zu stehen schien, war es Graf Dohna, der ständige Vermittler zwischen Vater und Sohn. Denn noch aus der letzten Zeit des alten Königs und seit dem Sturz der Dreifachen Wehs hieß er Der Tribun des Volkes.
Dass Dohna diesen Namen trug, war weithin Creutzens Werk, obwohl der noch niemals ein gutes Wort von einem großen Herrn gesprochen hatte. Aber seine Klugheit und Wachsamkeit waren jetzt reger denn je. Die Zurücksetzung, die er durch seinen hohen Protektor erfahren hatte, schien alle seine Sinne noch geschärft zu haben. Er machte Dohna groß. Er brachte dem Minister alle Unterlagen, die das Volk betrafen; er machte sich ihm unentbehrlich; und verhandelte der neue Minister mit dem jungen Fürsten, so geschah es nun ein um das andere Mal, dass der Schreiber Creutz hinzugerufen wurde.
So erlebte Creutz jetzt den Triumph, als einziger Geheimschreiber den neuen König auf sein Jagdschloss Wusterhausen, das Kastell der Knabenjahre, begleiten zu dürfen, als sich der Herr sofort nach jenem ersten Empfang des Ministeriums, nur in Begleitung eines Adjutanten, für vier Tage dorthin begab. In so knapper Frist gedachte er Etat und Regierungsplan zu vollenden, die er sechs Wochen hindurch heimlich vorbereitet hatte. Diesmal hätte Creutz keinen Geheimratstitel für sein niederes Amt eintauschen mögen, denn die Begleitung jedes anderen hatte der König mit der barschen Bemerkung abgelehnt, ob denn nicht bekannt sei, dass er von keinem draußen importuniert sein wolle. Und als man den König warnte, dass er sich aller Räte entblöße, hatte er nur geantwortet, seine neuen Rechenkünste halte er höher als alle seine Räte, weil er diese gar nicht nötig habe, wo ihm seine eigenen Schreibtafeln und Ziffern das Fazit in die Hand gäben; und unter menschlichen Handlungen sei dies die einzige, die nicht betrüge, noch betrügen lasse. Ein akkurater Rechenmeister tue ihm viel sicherere Dienste als alle Schreibmeister, wie er denn auch viel eher die letzteren als den ersteren missen wolle.
Auf dieses Wort vom Rechenmeister baute der arme Mann Creutz seine Zukunft. Noch in den durchwachten Nächten in der Giebelkammer mühte er sich, das Warten zu lernen. Manchmal erschien der junge Mann sich schon zu alt dazu vor zu viel Wissen um die Hoffnungslosigkeit.
Aber ausgeruht wie einer, der in florentinischem Prunkbett schlummerte, schrieb er vier Tage hindurch Etat und Regierungsplan nieder, die König Friedrich Wilhelm entwarf. Der Regierungsplan schien ein einziges Rechenexempel. Die Schulden waren endlich samt und sonders aufgerechnet. Danach gab es keinen anderen Weg, als von nun an jedes Jahr zweieinhalb Millionen Taler einzusparen. Mit dem Verbrauch von Siegellack, Papier und Tinte fing es an; dies war die erste Weisung: „Zu den Expeditionen, die im Lande bleiben oder an den Hof gehen, müssen keine feinen, sondern nur gemeine und graue Papiere gebraucht und also das in dem Kammeretat dazu ausgesetzte Quantum bestmöglich menagieret werden. Der Quark ist nicht das schöne Papier wert.“
Nahezu in allem sollte man sich künftig mit der Hälfte des bisher Üblichen begnügen. Der Etat des Hofes aber wurde auf den fünften Teil herabgesetzt. Alle hohen Gehälter wurden rund auf ein Drittel gekürzt, sollten nun aber auch wirklich ausgezahlt werden – wenn nicht jeden Monat, so doch schlimmstenfalls zum Quartal – und nicht mehr nur in abgetretenen Forderungen und Außenständen bestehen. Heraufgesetzt wurden dagegen die Gehälter der untersten Beamten. Dem Staatsrat wurde mitgeteilt, dass er aus Ersparnisgründen aufgelöst sei. Der König mied die harten Worte, die ihm in die Feder kamen. Zwei oder drei Namen dieser durchgestrichenen Staatsratsliste erhielten den Vermerk: „Ist gut. Bleibt.“
Als König Friedrich Wilhelm sich von seinem Schreibtisch in der Fensternische des Hirschsaals erhob, hatte er für sein erstes Regierungsjahr eine halbe Million Taler eingespart. Allenthalben in den Reichen rings gehörte aller Staatsschatz dem Herrscher. Der neue Herr in Preußen nahm alle Schulden auf sich und bewilligte sich nur ein kleines Gehalt.
* * *
In Berlin zitterte man, wie die Rechnung des Königs wohl aufgehen werde. Zwischen Erlass und Durchführung war keine Zwischenspanne mehr gegeben, sich von dem Entsetzen zu erholen. Wer mehr borgte, als er bezahlen konnte, wurde als Dieb und Fälscher angesehen, seiner Ämter enthoben und für alle Zeiten unfähig erklärt, solche zu bekleiden. Wer sich boshaft benahm durch Üppigkeit, überflüssiges Bauen, übelgeführte Menage, Schädigung von Kaufleuten, ungedeckte Wechsel und dergleichen, sollte durch Pranger, Gefängnis, Festungsarbeit, Landesverweisung, Staupenschläge oder gar Tod durch Strang verurteilt werden.
Das Rangreglement all der Schuldenmacher, das am alten Hofe auf einhundertzweiundvierzig Stufen angewachsen war, verringerte der neue Herr um ein volles Hundert. Vor allem aber hatte er die höchsten Staatsbeamten und die Generale nun über die Hofmarschälle und Kammerherren gesetzt, als gedenke er eine neue Würde seines Hofes aufzurichten, soweit man dies übriggebliebene Gebilde noch Hof zu nennen bereit war.
Die Hoftrompeter und Hoboisten, die jeden Mittag das Schloss mit ihrer Festmusik erfüllten und den glänzenden Herren und Damen aufspielten zu dem schwelgerischen Mahl des alten Königs, waren zum letzten Male im Trauerzug des ersten Königs von Preußen und zum Leichenschmaus der Trauergäste erschienen. Von nun an sollten sie nur noch auf Kasernenhöfen zu dem Exerzitium der Soldaten blasen und die Becken schlagen. Der neue Herr behielt nur einen Hoftrompeter.
Die Schlosswache der hundert Schweizer, die bislang in Samt und Seide, reich mit Gold gestickt, einherstolzierte, war entlassen und wurde wie die prächtigsten Leibgardisten unter die Regimenter König Friedrich Wilhelms gesteckt. Die Schweizer warfen seinen Korporalen ihre weißen Federhüte vor die Füße. Aller Welt klang es wie Hohn in den Ohren, als der König erklärte, er jage niemand von sich; es stehe auch all den Kammerjunkern, Hofherren, Zeremonienmeistern, selbst den Hofpoeten frei, als Offiziere in die neue Armee einzutreten.
Eine königliche Tafel gab es nicht mehr für sie. Die Silbergedecke wanderten aus den Sälen in die Münze, damit Geld aus ihnen geprägt werde. Die kostbaren Weine des Schlosskellers gingen über die Grenze, über die sie kamen, und das für sie ausgeworfene Geld sollte wieder zurückkehren.
Über hundert edle Pferde aus dem Marstall, Karossen und Sänften in unermesslicher Zahl wurden fremden Fürsten zum Verkauf angeboten. Dabei trafen gerade jetzt dreizehn spanische Hengste, eine Bestellung noch des alten Königs, von siebenhundert Meilen her ein.
Aus den Gärten entfernte man die Statuen. Die ausgeräumten Gebäude, Ställe, Gärten und Parks wurden verpachtet. Die Pächter drängten sich in den Toren, und in den Vorkammern des Schlosses warteten die Juweliere. Denn die diamantenen Agraffen und Schnallen, die Perlenkrone und die Juwelen hatten als letztes das Paradebett des königlichen Leichnams geziert. Alle überflüssigen Schmuckstücke, neu getaxt und registriert, wurden verkauft und die daraus gelösten Summen vom König zur Errichtung neuer Regimenter und zur Bezahlung der väterlichen Schulden verwendet. Es sprach sich herum, dass der neue König viele Juwelen des alten Königs geschmacklos gefasst fand.
Die wilden Tiere und seltenen Vögel der königlichen Menagerie wurden an König Augustus nach Dresden verkauft, die antiken Statuen am sächsischen und russischen Hofe zu Golde gemacht. Der Fundus des väterlichen Opernhauses in der Breiten Straße gelangte zur Auflösung.
Die Staatsminister bekamen keine Schildwachen mehr vor ihre Häuser.
Der König brach mit der Gepflogenheit, dass nur Fürsten von Geblüt an der königlichen Tafel sitzen durften. Die Tafel der Gräfinnen hörte auf; der Maître de la garderobe verschwand.
Die Tafelbedienung hatten nicht mehr Edelleute, sondern nur noch Pagen und Lakaien; und selbst der Leibmundschenk war nun nicht einmal mehr wie vordem als Lakai, sondern nur wie ein Stall- und Reitknecht gekleidet, ohne Tresse und mit rotem Kragen.
Die Königin übersah geflissentlich die Verwandlung, die mit der Tafel vor sich gegangen war. Zinn war statt Silber gedeckt. Sie übersah auch die Aufmerksamkeit, die der König ihr erweisen ließ: Ihr eigener Platz war mit allen edlen Geräten, wie sie einer Fürstin nur irgend zukommen können, bestellt. Von den hausväterlichen Tischreden des Königs, der plötzlich nur noch deutsche Hausgerichte auftragen ließ, fühlte sie sich unangenehm berührt.
„Sie entbehren“, hob er schon beim Vorgericht an, „heute zum Nachtisch die Früchte südlicher Zonen – in wenigen Monaten werden die gleichen Früchte in unseren Gärten reif sein, uns genauso gut munden und nicht den zwanzigsten Teil kosten.“
Der König war mitten in der Durchführung des Wusterhausener Reformplans. Jedes Ereignis des Tages war zu diesem Projekt in Beziehung gesetzt, selbst die Rast und Labsal der Mahlzeiten.
Noch ehe es dunkel wurde, hielt der Hausherr einen Rundgang durch sein Schloss, Schlüters machtvolles Werk, die Schöpfung eines Römers in der Mark Brandenburg. Friedrich Wilhelm gedachte nicht, die oberen Räume des verstorbenen Königs mit all ihrem Gold und Elfenbein zu beziehen, sondern richtete sich im Erdgeschoss ein, das wesentlich einfacher, wenn auch für seine Begriffe noch sehr prächtig, eingerichtet war.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.