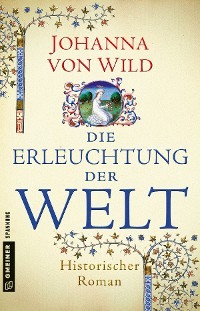Kitabı oku: «Die Erleuchtung der Welt», sayfa 4
»Was führte dich allein in diese Gegend? Und wozu trägt ein Mädchen ein Haumesser? Kommst du von einem Wingert?«
Helena blieb stumm.
Mit hochgezogenen Brauen sah die Äbtissin ihre Mitschwestern an. Beide schürzten die Lippen, schüttelten nur unmerklich den Kopf. Äbtissin Maria Ignatia traf eine Entscheidung.
»Du kannst hierbleiben, bis es dir besser geht, dann werden dich Schwester Innocentia und Schwester Katharina zurückbringen. Es sollte nicht allzu schwer werden, herauszufinden, wohin du gehörst. Ein Mädchen mit deiner Haarfarbe ist selten. Allerdings wäre es mir lieber, du sagst es uns selbst«, fügte sie mit einem feinen Lächeln hinzu.
Helena schüttelte den Kopf. »Bitte, schickt mich nicht fort«, flehte sie leise.
Bevor die Äbtissin etwas sagen konnte, mischte sich Schwester Katharina ein, die das Mädchen schon vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen hatte. Sie war zwar die Älteste des Klosters, doch ihre Augen blickten immer noch wach und klar. Ihr Vater hatte sie schon als Mädchen ins Kloster gesteckt, und der Wunsch, einmal eigene Kinder zu haben, war dadurch nie in Erfüllung gegangen.
»Ehrwürdige Mutter, gewährt Ihr mir einen Augenblick?«
Die Äbtissin nickte gnädig und trat ein paar Schritte zur Seite.
»Ich glaube, man hat ihr Gewalt angetan. Ihre Kleider sind zerrissen«, flüsterte Schwester Katharina leise, »und sie verschweigt bestimmt aus diesem Grunde, von wo und vor allem vor wem sie geflohen ist. Ich bitte Euch, lasst das Mädchen hierbleiben. Wir könnten eine neue Laienschwester gebrauchen.«
Die Worte ließen die Äbtissin schmunzeln. »Schwester Katharina, du wünschst dir eine Laienschwester, damit du im Klostergarten zwei weitere Hände hast, die mitanpacken können, nicht wahr?«
Die Nonne senkte beschämt den Blick. »Ihr habt mich durchschaut, ehrwürdige Mutter. Vergebt mir meinen Eigennutz.«
»Wenn Helena vor ihrem Lehnsherren geflohen ist, wird er sie suchen«, überlegte Äbtissin Maria Ignatia. »Ich weiß nicht, ob das Mädchen hierher passt, es hat etwas Trotziges an sich.« Sie seufzte leise. »Sie darf das Kloster zunächst nicht verlassen.«
Schwester Katharina sah auf. »Soll das etwa heißen …?«
»Ja, sie kann bleiben, ich nehme sie auf. Zwei Jahre soll sie hier mit uns leben und arbeiten, den Habit der Laienschwester tragen und den Vorsatz hegen, Gott zu dienen. Nach diesen zwei Jahren soll sie das feierliche Gelübde ablegen. Höre ich nur eine einzige Klage über die Arbeit, die wir ihr geben, verweise ich sie noch am selben Tag des Klosters.«
Schwester Katharina sank auf die Knie, küsste den Ring an der der Hand der Äbtissin. »Ich danke Euch, ehrwürdige Mutter.«
Helena konnte kaum fassen, dass sie bleiben durfte. Aber die Bedingung, die daran geknüpft war, ließ sie nachdenklich werden. Ein Leben im Kloster? Niemals heiraten, niemals eigene Kinder haben. Sie dachte an ihre Geschwister, die sie vielleicht nie wiedersehen würde, wenn sie das Kloster nicht verlassen durfte. Zumindest vorerst. Lange überlegen musste Helena allerdings nicht. Wenn sie das Angebot ausschlug, was dann? Wo sollte sie hin? Nach Hause konnte und wollte sie nicht. Hier, hinter den Klostermauern, war sie zumindest sicher. Unbewusst griff sie nach dem Lederbändchen an ihrem Hals, tastete nach dem Püppchen, das sie nun schon so lange trug.
»Was ist das?«, wollte Schwester Katharina wissen, die ihr beim Anziehen des Habits half.
»Ein Geschenk, das ich hüte wie einen Schatz. Bitte, nehmt es mir nicht weg«, bettelte sie.
Katharina runzelte die Stirn.
»Ich weiß nicht, es gehört sich nicht, Schmuck zu tragen, auch nicht für eine Laienschwester, und sei er noch so schlicht.«
Ängstlich umklammerte Helena das Püppchen, Tränen traten ihr in die Augen. »Die Prinzessin hat mir die Puppe geschenkt«, flüsterte sie.
Für einen Moment zweifelte Schwester Katharina an ihren Worten, doch sie erkannte keine Lüge in Helenas Augen.
»Du sprichst von Prinzessin Mechthild, die Tochter unseres Kurfürsten?«, fragte sie immer noch etwas ungläubig.
Helena nickte und erzählte von dem Geschehen, das sich vor drei Jahren zugetragen hatte. Schließlich rang sich die Nonne dazu durch, ihr die Kette zu lassen. Unter dem Habit würde sie nicht zu sehen sein. Doch sie holte trotzdem die Erlaubnis der Äbtissin ein.
»Wir besitzen keine weltlichen Dinge«, beschied Äbtissin Maria Ignatia ihr streng, als ob diese das nicht wüsste. Wobei das nicht ganz richtig war. Witwen, die sich ins Kloster zurückzogen, durften einige wenige persönliche Dinge behalten. Aber Helena war keine Witwe.
»Ehrwürdige Mutter, bitte gewährt ihr diese Ausnahme. Das arme Kind hat viel durchgemacht. Vielleicht kommt einmal der Tag, an dem sie nicht daran festhalten muss, aber im Augenblick …«
Die Hartnäckigkeit Katharinas ließ die Äbtissin erweichen. Ihre Mitschwester hatte offenbar in kürzester Zeit einen regelrechten Narren an dem Mädchen gefressen.
So begann Helenas Zeit im Kloster Lobenfeld. An den schwarzen Habit gewöhnte sie sich schnell, einzig und allein der weiße Schleier, der sie als Laienschwester kennzeichnete und den sie tragen musste, ließ sie jeden Tag hadern, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Warum hatte Gott ihr eine solch außergewöhnliche Haarfarbe geschenkt, wenn sie ihre Haare unter dem Schleier verbergen sollte? Zudem musste sie sich überwinden, mitten in der Nacht zur ersten Hore aufzustehen. Doch nach und nach gewöhnte sie sich auch daran. Achtmal am Tag sangen die Ordensschwestern Psalmen, und es wurde gebetet. Singen lag Helena nicht, denn ihr selbst fiel auf, dass sie die Töne nicht traf. Oftmals sang sie ganz leise oder bewegte nur die Lippen, lauschte lieber den Stimmen der anderen. Die Mahlzeiten wurden schweigend eingenommen, auch dies empfand Helena als belastend. Verstieß jemand gegen diese Regel, wurde er meist mit Essensentzug bestraft. Nur ein einziges Mal hatte Helena diese Regel gebrochen und dann nie wieder.
Was sie wirklich liebte, war die Arbeit im Klostergarten, wo Gemüse und Kräuter angepflanzt wurden. Schwester Katharina war ein unerschöpflicher Quell des Wissens, was die Arzneipflanzen, die im Garten gehegt und gepflegt wurden, anbelangte. Helena lernte schnell, und Schwester Katharina bereitete es ungemeine Freude, das Mädchen an ihren Kenntnissen teilhaben zu lassen.
»Schwester Katharina«, sagte Helena eines Tages, »ich möchte gerne Latein lernen. Nicht nur die Namen der Arzneipflanzen. Könnt Ihr mich das lehren?«
Sie als Laienschwester betete das Vaterunser und den Rosenkranz auf Deutsch. Die Chorschwestern sangen auf Latein, und auch die Tischgebete wurden auf Latein gesprochen.
Verblüfft sah Katharina das Mädchen an. »Ich denke, das kann ich schon«, erwiderte sie bedächtig, »ich werde aber zuerst mit unserer ehrwürdigen Äbtissin darüber sprechen.«
Äbtissin Maria Ignatia entsprach Helenas Wunsch, nur sollte sie darüber hinaus ihre täglichen Arbeiten nicht vernachlässigen. So lehrten die Schwestern sie nicht nur die Worte, sondern brachten ihr auch Lesen und Schreiben bei. Die Buchstaben konnte sie schon, da ihr Freund von der Pfarrschule ihr diese bereits gezeigt hatte. Je mehr Helena lernte, desto größer wurde ihr Wissensdurst. Eine völlig neue Welt erschloss sich ihr, als ihr das Lesen immer leichter fiel. Weltliche Bücher gab es im Kloster nicht, aber in der Klosterchronik zu lesen und zu erfahren, was viele Jahre vor ihrer Geburt vor Ort geschehen war, empfand Helena als ungemein packend.
»Möchtest du dich im Illustrieren versuchen?«, lächelte Schwester Innocentia, als sie sich im Skriptorium dem Tisch näherte, an dem Helena saß und wie selbstvergessen auf einem kleinen Stück Papier eine Bordüre malte.
Helena sah auf, verdeckte beschämt ihr Werk mit der gewölbten Hand, um die Tinte nicht zu verwischen. »Ich bitte um Vergebung, aber ich habe die Seite, die Ihr mir zum Kopieren aufgegeben habt, schon fertig. Und ich wollte nur versuchen, ob auch ich so schön malen und verzieren kann wie Schwester Agatha.«
»Lass sehen, was du gemalt hast«, forderte Innocentia.
Helena hob die Hand, damit die Schwester einen Blick auf das Papier werfen konnte.
»Das ist wunderbar«, flüsterte die Nonne ergriffen. »Du besitzt eine Gabe, Helena.«
Auf dem kleinen Stück Papier waren verschlungene Blätterranken zu sehen, zwischen denen winzige Rosenblüten hervorlugten. Kleine Schmetterlinge flatterten um die filigranen Blüten, auf einem herzförmigen Blatt entdeckte Schwester Innocentia eine Schnecke.
»Aber so gut wie Schwester Agatha werde ich nie malen können«, seufzte Helena.
Die Nonne war zwar ganz anderer Meinung, behielt diese aber für sich. »Das Malen bereitet dir Freude, nicht wahr?«
Helena nickte stumm.
»Was meinst du, soll ich mit unserer ehrwürdigen Äbtissin sprechen, ob du mehr Zeit im Skriptorium verbringen darfst, um mehr Übung zu bekommen?«
Die Versuchung war groß, aber Helena liebte auch die Arbeit im Kräutergarten. Zudem fühlte sie sich Schwester Katharina verpflichtet, die sich damals dafür eingesetzt hatte, dass Helena im Kloster bleiben durfte.
»Nein«, antwortete Helena schließlich, »es gibt noch so viel im Garten zu tun, bevor der Winter kommt, und ich möchte Schwester Katharina nicht im Stich lassen. Aber ich danke Euch für Eure gute Absicht.«
Ein schelmisches Funkeln schlich sich in Schwester Innocentias Augen. »Sehr rücksichtsvoll von dir. Und im Winter wirst du auf jeden Fall mehr Zeit finden, denn dann gibt es im Garten kaum etwas zu tun.« Sie nahm das bemalte Papier an sich und verschwand mit einem verschwörerischen Lächeln auf den Lippen.
Am nächsten Tag bestellte Äbtissin Maria Ignatia die Laienschwester nach der Sext zu sich.
»Mir wurde zugetragen, Gott hat dir ein Talent mitgegeben. Und in der Tat, das hast du.«
Sie klopfte vorsichtig mit dem rechten Zeigefinger auf ein Stück Papier, das vor ihr auf dem Tisch lag. Helena erkannte ihre Zeichnungen.
»Schwester Innocentia«, stellte sie mit leiser Stimme fest und schlug die Augen nieder.
»Ja, ganz recht. Ich wünsche, dass du mehr Zeit im Skriptorium verbringst, um deine Kunstfertigkeit zu verbessern.«
»Aber …«, traute sich Helena zu sagen, wurde jedoch sofort unterbrochen.
»Widersprich mir nicht! Ich weiß, was du sagen möchtest. Schwester Innocentia hat mich darüber unterrichtet, dass du Schwester Katharina nicht im Stich lassen willst. Das ehrt dich, und nichts anderes habe ich von dir erwartet. Mehr Zeit im Skriptorium bedeutet nicht, du sollst gar nicht mehr im Garten arbeiten. Ich besitze seit einiger Zeit die Kopie einer Handschrift, die von der Benediktinerin Hildegard von Bingen stammt. ›Causae et Curae‹ soll auch von uns kopiert werden, und ich wünsche deine Mithilfe bei den Illustrationen.«
Helena wusste nicht, was sie sagen sollte. Was für eine Aufgabe! Und wie viel sie dabei lernen konnte! Alles über die Entstehung und Behandlung von Krankheiten, was Hildegard von Bingen zusammengetragen hatte. Schwester Katharina hatte Helena von der klugen Heilerin, die vor langer Zeit gelebt hatte, erzählt. Freudentränen traten in Helenas Augen, und sie spürte einen Kloß im Hals. Unvermittelt sank sie auf die Knie, berührte mit den Lippen den Saum des Gewandes der Äbtissin.
»Ich danke Euch, ehrwürdige Mutter«, brachte sie mit erstickter Stimme hervor.
»Steh auf, mein Kind«, sagte Äbtissin Maria Ignatia sanft, »Gott hat dich zu uns gesandt, weil er wollte, dass deine Gabe nicht vergeudet wird.«
So half Helena nicht nur im Kräutergarten, sondern malte und zeichnete Pflanzen und deren für die Medizin verwendete Teile. Helena erlernte Dinge, von denen sie nie zu träumen gewagt hätte. Als Kind aus armen Verhältnissen lesen und schreiben und Latein lernen zu dürfen, war ein wahres Gottesgeschenk. Stumm dankte sie jeden Abend auf Knien ihrem Schöpfer, den Schwestern und der Äbtissin, bevor sie ihren Kopf auf das einfache Lager sinken ließ.
Noch Wochen später, nachdem der Medicus den Winzer zusammengeflickt hatte, packte Cuntz die Wut, wenn er an Helena dachte. Sein Bein würde nie wieder so beweglich sein, und der Schmerz war sein ständiger Begleiter. Er verfluchte den Medicus, den er einen Quacksalber schimpfte, obwohl es seine eigene Schuld war, wenn er nun den Rest seines Lebens hinkte. Entgegen den Anordnungen hatte er sich viel zu früh und viel zu viel bewegt. Die Wunde war zwar gut verheilt, aber durch die ständige Unruhe hatte der Muskel nicht ordentlich zusammenwachsen können, und darüber hinaus zierte seinen Oberschenkel nun eine hässliche Narbe.
Sein erster Ritt führte ihn nach Neckargemünd, wo er Wigbert aufsuchte. Am Tag nach seiner Verwundung war jedem das Verschwinden der jungen Magd aufgefallen, und Cuntz’ Erklärung lautete, sie hätte sich einfach aus dem Staub gemacht. Aber dies würde er keinesfalls hinnehmen und sich selbst darum kümmern, sie zurückzuholen, sobald er wieder in der Lage dazu war. Schließlich sollte sie die Schulden ihres Vaters bei ihm abarbeiten.
Er fand Wigbert auf einem Feld, das er gemeinsam mit seinem Sohn Siegfried beackerte. Zuvor war Cuntz bei der armseligen Kate gewesen und hatte dort niemanden angetroffen. Eine Nachbarin hatte ihm geraten, es auf den Feldern vor den Stadttoren zu versuchen. Cuntz war es herzlich egal, als er sah, wie der Tagelöhner mühsam die zweite Heumahd einbrachte und ritt rücksichtlos ein paar Garben um.
»Herr, haltet ein«, brüllte Wigbert entsetzt, als er den Reiter über das Feld galoppieren sah.
Sein Augenlicht war schwach, daher konnte er den Reiter nicht gleich erkennen. Erst als dieser sein Pferd im letzten Moment zügelte und vor ihm zum Stehen brachte, wusste der Bauer Bescheid. Die Flanken des Pferdes bebten von dem scharfen Ritt, die Nüstern waren bis aufs Äußerste gebläht, der Körper schweißbedeckt und vom Maul troff weißer Schaum.
»Wo ist sie?«, herrschte Cuntz den Tagelöhner an und stieg vom Pferd. Ein stechender Schmerz durchfuhr sein linkes Bein.
»Wo ist wer? Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen«, antwortete Wigbert und bekam weiche Knie, als er den Zorn in Cuntz’ Augen sah.
»Stell dich nicht dümmer, als du bist. Helena, dieses kleine Biest.«
»Aber wieso, du hast sie doch mitgenom…« Wigbert dämmerte, was geschehen sein musste. Seine Tochter hatte offenbar die Beine in die Hand genommen und das Weite gesucht. Und natürlich schlussfolgerte Cuntz, Helena wäre nach Hause gerannt.
»Sie ist nicht hier, Cuntz.«
Cuntz rammte ihm die Faust ins Gesicht. Wigberts Lippe platzte auf, und er taumelte zurück. »Das sehe ich selbst, du Nichtsnutz. Wo ist sie?«
Siegfried war herbeigeeilt, als er sah, wie Cuntz seinen Vater schlug. »Was ist hier los, Vater?« Tapfer stellte sich der Junge vor ihn.
Wigbert wischte sich mit dem Handrücken das Blut vom Mund. »Deine Schwester ist wohl abgehauen.«
»Aber, Herr«, wandte sich Siegfried mit dünner Stimme an Cuntz, »sie ist nicht nach Hause gekommen. Seit sie mit Euch fort ist, haben wir sie nicht wiedergesehen.«
Cuntz ging nicht darauf ein und würdigte den Jungen keines Blickes. »Deine Schulden, Wigbert, sind noch längst nicht beglichen. Ich werde dafür sorgen, dass ich zu meinem Recht komme.« Mit Mühe erklomm Cuntz sein Pferd, wendete und galoppierte davon. Irgendwo musste sich diese kleine rothaarige Hure doch verstecken, und er würde sie finden, ganz gleich, wie lange es dauerte. Derweil konnte er Anstrengungen unternehmen, Wigbert das Leben schwer zu machen.
1429
Dilsberg, August
Schwester Katharina verließ einmal in der Woche gemeinsam mit zwei weiteren Ordensschwestern das Kloster, um im nahe gelegenen Dilsberg die kranken Kinder des Waisenhauses zu versorgen. Zu gerne wäre Helena mitgekommen, doch nach wie vor hielt die Äbtissin ihr Verbot aufrecht, und Helena sah ihren Mitschwestern sehnsüchtig hinterher.
Seit Helenas Ankunft im Kloster Lobenfeld war inzwischen mehr als ein Jahr ins Land gegangen. Der Sommer neigte sich dem Ende, und die Tage wurden allmählich kürzer. Einvernehmlich arbeitete die junge Laienschwester Seite an Seite mit Schwester Katharina. Aus Efeublättern stellten sie einen Extrakt her. Das Elixier wirkte besonders gut gegen Husten, und nun, da die kältere Jahreszeit vor der Tür stand, legten sie einen Vorrat an. Zu dem Efeutrank gaben sie ein wenig Honig, um den bitteren Geschmack abzuschwächen. Im Frühjahr hatten sie Lindenblüten gesammelt und getrocknet. Auch davon würden sie in der kalten Jahreszeit einiges brauchen, denn aufgebrüht wirkten die getrockneten Pflanzenteile fiebersenkend.
Jetzt im August gab es noch jede Menge anderer Kräuter zu suchen: Beinwell gegen Blutergüsse und Verstauchungen, Frauenmantel gegen, wie der Name schon vermuten ließ, Frauenbeschwerden, und Eisenkraut, ein wahres Wunderkraut gegen vielerlei Beschwerden, das man äußerlich und innerlich anwenden konnte. Und natürlich Weidenrinde. Davon konnte man nie genug haben, denn sie half bei Fieber, Schmerzen und Entzündungen. Vergangenen Winter hatte Helena die meiste Zeit im Skriptorium verbracht und geholfen, die bisher kopierten Seiten des Buches von Hildegard von Bingen zu illustrieren.
»Helena«, plötzlich stand die Äbtissin neben ihr, Helena zuckte erschrocken zusammen, war sie doch in ihre Arbeit vertieft gewesen, »morgen wirst du Schwester Katharina und Schwester Innocentia zum Waisenhaus begleiten.«
Helena sah auf, starrte sie ungläubig an. Hatte sie das richtig verstanden? Sie durfte morgen die Klostermauern verlassen?
»Ehrwürdige Mutter, ich …«, stotterte sie.
Ein feines Lächeln glitt über das Gesicht der Äbtissin. »Ja, mein Kind, du wirst den Schwestern morgen zur Hand gehen. Ich denke, es ist an der Zeit, dich mitgehen zu lassen.«
Helena sank auf die Knie, griff nach Maria Ignatias Hand, küsste den Ring. »Ich danke Euch, ehrwürdige Mutter.«
Die Äbtissin half ihr hoch. »Du hast eine außergewöhnliche Auffassungsgabe. Du lernst schnell, bist gehorsam und fleißig. Dies ist nun der Lohn dafür, dass du dich so schnell in unsere Gemeinschaft eingefügt hast. Also, enttäusche mich nicht, wenn du morgen mit zum Waisenhaus gehst.«
»Das werde ich nicht, ehrwürdige Mutter. Ganz bestimmt nicht.«
In der Nacht fand Helena vor Aufregung keine Ruhe, wälzte sich auf ihrem Lager hin und her, bis sie endlich in einen unruhigen Schlaf fiel. Das Aufstehen zur Hore kurz nach Mitternacht war noch schwerer als sonst, und zur Laudes bei Tagesanbruch kam sie kaum aus dem Bett. Doch als sie endlich mit den Schwestern aufbrach, fühlte sie sich munter.
Ein alter Bauer, den Rücken krumm von jahrelanger harter Arbeit, kam mit einem Ochsengespann, um sie abzuholen. Die regelmäßigen Fahrten nach Dilsberg waren seine Gegenleistung für das Entgegenkommen der Äbtissin. Vor wenigen Monaten hatte sie Kuniberts einzige Tochter als Magd in den Dienst des Klosters aufgenommen. Das Mädchen, das mit einem verkrüppelten Fuß zur Welt gekommen war, half beim Waschen und Putzen. Arbeiten, die keine der Schwestern gerne versah. Kunibert war dankbar gewesen, denn er bezweifelte, dass jemals irgendein junger Bursche den Wunsch verspürte, ein hinkendes Mädchen zu heiraten, und so hatte der Bauer ein Maul weniger zu stopfen.
Bei strahlender Sonne rumpelte der Ochsenkarren los. Helena saß auf einer Decke zwischen Säckchen, Krügen und irdenen Töpfen, die getrocknete Arzneipflanzen, Elixiere und Salben enthielten und in zwei großen Weidenkörben gut verstaut waren. Trotz der holprigen Fahrt genoss sie die kurze Reise nach Dilsberg. Auf den Feldern wurden Dinkel, Roggen und Emmer geerntet. Zahlreiche Männer schnitten das Korn, welches die Frauen und älteren Kinder zu Garben bündelten, die sie aufstellten, damit sie in den nächsten Tagen in die Scheunen gebracht werden konnten. Helena dachte an ihre Familie. Auch ihr Vater und Siegfried würden vermutlich nun auf den Feldern arbeiten und hoffen, dass es nicht regnete, bevor das Getreide trocken in den Scheunen lagerte. Feuchte Halme faulten, und das bedeutete einen Winter voller Hunger. Wenigstens ging es ihrer kleinen Schwester Greta gut, die immer noch bei Anna lebte. Das hoffte sie zumindest.
»Heute ist Markt in Dilsberg«, erzählte Kunibert, der auf dem Kutschbock saß, und blickte über die Schulter zu den Frauen. »Wenn Ihr etwas braucht, Schwester Katharina, dann kann ich es besorgen, solange Ihr im Waisenhaus Euren Dienst verseht. Das verkürzt mir die Wartezeit.«
»Das trifft sich gut, Kunibert. Bring uns gerauchten Fisch, gepökeltes Fleisch und Käse«, antwortete die Nonne. Sie griff unter ihre schwarze Kukulle, knotete einen ledernen Beutel von ihrem Gürtel, der die Tunika hielt, und ließ einige Münzen in ihre Hand gleiten.
»Schwester Innocentia, du wirst Kunibert begleiten«, sie reichte ihrer Mitschwester die Münzen, »Helena kommt mit mir.«
»Sieh nur, Helena, dort oben liegt Dilsberg«.
Helenas Blick folgte staunend Schwester Katharinas ausgestrecktem Zeigefinger. Die beeindruckende Burgfeste lag auf einer Kuppe an einer Neckarschleife. Der sechseckige Bergfried, der die Burg überragte, war schon von Weitem für jedermann sichtbar. Helena sah die mächtige Schildmauer der Vorburg, hinter welcher sich die Häuser der Bewohner von Dilsberg befanden. Die Einwohner der Stadt waren allesamt freie Bürger und mussten keine Steuer entrichten, wie Schwester Katharina erklärte. Dafür mussten sie jedoch ihre Unterkünfte für Aufenthalte der Heidelberger Hofgesellschaft oder in Kriegszeiten für die Soldaten zur Verfügung stellen. Vom Turm flatterte ein Banner im lauen Sommerwind, das das Wappen des Kurfürsten Ludwig aufwies. Zwei sich gegenüberliegende Felder, die je einen auf den Hinterbeinen stehenden Löwen mit roter Krone zeigten, die anderen beiden Felder leuchteten in sich abwechselnden weißen und blauen Rauten.
Kunibert passierte das Stadttor, hielt wenig später die schnaufenden Ochsen vor dem Waisenhaus an und half den Nonnen beim Aussteigen. Helena blieb auf der Ladefläche stehen und reichte die Weidenkörbe hinunter. Dann kletterte auch sie vom Wagen, trug gemeinsam mit Schwester Katharina die Körbe hinein, während Schwester Innocentia mit Kunibert in Richtung Markt verschwand.
»Schwester Katharina«, wurde die Nonne von einer kleinen Kinderschar freudig begrüßt, als die beiden Frauen erschienen und für einen Augenblick die schweren Körbe absetzten. Sie tätschelte die Köpfe der Kinder, die alle etwa vier bis acht Jahre alt waren.
»Wer bist du denn?«, traute sich ein kleiner Junge zu fragen und zupfte zaghaft an Helenas Habit.
»Ich bin Helena. Und wie heißt du?«
»Siegfried.«
»Mein Bruder heißt auch Siegfried«, lächelte sie und strich ihm über die schmutzige Wange.
Schwester Katharina bedeutete Helena, ihr zu folgen, und nahm einen der Körbe auf. Helena griff sich den zweiten, und der kleine Siegfried trabte neben ihr her und plapperte vor sich hin.
»Die Anna ist ganz krank, und Jacob hat sich heute Morgen das Bein gebrochen.«
»Na, dann ist es ja ein Glück, dass wir nun hier sind«, erwiderte Helena.
Sie betraten den Schlafsaal, in welchem an die zwanzig Strohmatratzen auf dem Boden lagen, und stellten die Körbe ab. Siegfried legte seine schmale Hand in Helenas Linke und zog sie zu einer der Schlafstätten.
»Das ist Anna.«
Helena kniete sich neben die kleine Gestalt, die sie mit fieberglänzenden und geröteten Augen ansah. Als Helena eine Hand auf die Stirn des Kindes legte, hatte sie das Gefühl, sich zu verbrennen. Das dünne Kind glühte förmlich, und auf der Haut zeigte sich ein roter, fleckiger, knotiger Ausschlag.
Schwester Katharina, die hinzugekommen war, zog die Decke zurück, öffnete das Hemdchen der Kleinen. Auch hier waren die Flecken zu sehen, der ganze Körper des Mädchens war übersät. Helena erschrak.
»Zwei meiner Brüder sind vor vier Jahren gestorben. Sie zeigten einen ähnlichen Ausschlag«, raunte sie Schwester Katharina zu.
Statt einer Antwort nickte die Nonne nur, berührte für einen Moment Helenas Hand. Eine mitfühlende und tröstende Geste. Eine untersetzte Frau eilte herbei, eine der Vorsteherinnen des Waisenhauses, das menschenfreundliche Bürger gestiftet hatten.
»Gepriesen sei der Herr für Euer Kommen, Schwester Katharina! Zuerst hatte Anna nur Fieber und diesen bellenden Husten, gestern kamen diese Flecken hinzu. Es geht ihr immer schlechter.«
Die Nonne schob einen Finger zwischen die Lippen des Mädchens, ließ sie den Mund öffnen. Auf der Mundschleimhaut zeigten sich weißliche, teils violette Flecke. Sie hatte diese Zeichen schon mehrfach bei anderen Kindern gesehen und wusste, diese Krankheit, deren Namen sie nicht kannte, konnte gefährlich werden. Vor allem bei solch schwächlichen Kindern wie die kleine Anna eines war. Nicht wenige Kinder verstarben daran. Und oft erkrankten binnen kürzester Zeit weitere Kinder und zeigten die gleichen Anzeichen.
Ein Hustenanfall schüttelte das Mädchen. Als es sein Köpfchen hob und ein Sonnenstrahl sein Gesicht traf, riss es jäh ein Ärmchen hoch, um sich gegen das Licht zu schützen. Auch Lichtscheu gehörte oft zu den Zeichen dieser namenlosen Erkrankung, wusste Schwester Katharina.
»Wir müssen sie in eine dunklere Ecke legen, das Licht tut ihr weh, und sie von den anderen Kindern trennen. Und dann bringt mir Tücher und kaltes Wasser«, forderte sie die Vorsteherin auf. »Helena, du gibst ihr Thymiantinktur zu trinken, dann sieh nach, ob wir Augentrost, Knoblauch und Spitzwegerich mitgenommen haben.«
Helena stand hastig auf und sah die Behältnisse in den Körben durch, während die Nonne das Kind aufhob und in einen anderen Raum brachte, wo es dunkler war.
Die Vorsteherin erschien mit dem Gewünschten und half, das Mädchen in feuchte Tücher zu wickeln, um das Fieber zu senken. Helena hielt Annas Kopf und flößte ihr von der Thymiantinktur ein.
»Augentrost und Knoblauch haben wir dabei«, sagte sie und setzte das Gefäß ab, damit das Kind schlucken konnte, »aber keinen Spitzwegerich.«
»Keinen Spitzwegerich? Wir haben genügend Elixier hergestellt, das kann nicht sein!«, rief Schwester Katharina ungläubig aus.
»Ich befürchte doch. Es ist meine Schuld, ich war so aufgeregt, dass ich mitgehen durfte. Ich muss es vergessen haben«, gestand Helena zerknirscht.
Die Nonne verzog verärgert das Gesicht. »Dann geh den Berg hinab, dort findest du bestimmt jede Menge davon. Beeil dich.«
Die Laienschwester nickte, verließ das Waisenhaus, eilte durch das Stadttor und lief so schnell sie konnte bergab. Die Vorsteherin hatte ihr noch einen Lederbeutel mitgegeben, in welchem Helena das Kraut sammeln konnte. Aufmerksam hielt sie ihren Blick auf den Wegrand geheftet, hob nur ab und an den Kopf, um sich an der herrlichen Landschaft zu erfreuen. Der Fluss glitzerte in der Sonne, und Helena hätte viel darum gegeben, sich ihres Habits entledigen zu können und in das kühle Nass zu springen. Das Wasser war sicher noch warm, denn die Spätsommersonne besaß noch erstaunlich viel Kraft.
Bisher hatte Helena noch keinen Spitzwegerich entdeckt, und ihre Verzweiflung wuchs. Hier am Wegrand würde sie wohl nichts finden, und sie beschloss, den Weg zu verlassen und in der angrenzenden Wiese zu suchen, die von einem Wald gesäumt wurde. Niemand war zu sehen, und sie gestattete sich, den lästigen weißen Schleier abzunehmen und ihn hinter ihren Gürtel zu schieben. Mit gespreizten Fingern fuhr sie sich durch die Haare und genoss den lauen Wind auf ihrem Haupt, während sie stumm Abbitte bei Äbtissin Maria Ignatia leistete.
Es war die richtige Entscheidung gewesen, denn bald sah sie die aufrechten, kräftigen Stängel des Spitzwegerichs mit seiner lang gezogenen Blütenähre zwischen den Gräsern und Blumen herausragen. Helena bückte sich und sammelte so lange, bis der Beutel fast gefüllt war. Während ihrer Arbeit hatte sie sich bis zum Waldrand bewegt. Gerade wollte sie sich auf den Rückweg machen, als ihr ein Schlehenstrauch auffiel, dessen Früchte schon aufgrund des warmen Wetters früher als sonst gereift waren. Die blauen Beeren konnte man zu einem Elixier verarbeiten, das den Körper stärkte. Ein Aufguss aus der Rinde galt als fiebersenkend und appetitanregend. Helena begann die Beeren zu pflücken und schabte mit ihrem Speisemesser die Rinde ab.
Ein Geräusch ließ sie aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes brach eine Rotte Wildschweine hervor. Die wenige Monate alten Frischlinge rannten quiekend auf sie zu, gefolgt von der aufgebrachten Bache. Irgendetwas musste die Tiere aufgescheucht haben. Helena raffte ihren Habit mit einer Hand und spurtete los. Wildschweine waren gefährlich, vor allem wenn sie Nachwuchs hatten.
Der Habit hinderte sie daran, größere Schritte zu machen, und sie glaubte schon, den heißen Atem der Bache in ihrem Nacken zu spüren. Das wütende Grunzen gellte in ihren Ohren, und sie hetzte weiter, bis sie den Weg erreichte und warf einen schnellen Blick über die Schulter. Das erzürnte Muttertier hatte die Verfolgung aufgegeben und war mit ihrem Nachwuchs in den Schutz des Waldes zurückgekehrt. Als Helena erleichtert aufatmete und wieder nach vorn sah, stieß sie beinahe mit einem Reiter zusammen.
»Hooooh, Galen, brrr!«, beruhigte der junge Reiter seinen dunkelbraunen Wallach und tätschelte den schweißnassen Hals des Pferdes. »Wohin so eilig?«
Helena blickte in freundliche, haselnussbraune Augen. Der Reiter mochte nur wenig älter sein als sie. Seine gelockten Haare, die fast dieselbe Farbe wie das Fell seines Pferdes besaßen, trug er halblang, seine Wangen waren gerötet vom schnellen Ritt. Ein grünes Barrett saß keck auf seinem Kopf, unter dem schwarzen Wams trug er ein helles Hemd, dazu eine braune, enge Hose, und seine Füße steckten in Stulpenstiefeln.
Helena wurde sich ihrer offen zur Schau getragenen Haare bewusst. Verlegen nestelte sie den weißen Schleier hinter ihrem Gürtel hervor und bedeckte ihre dunkelrote Haarpracht.