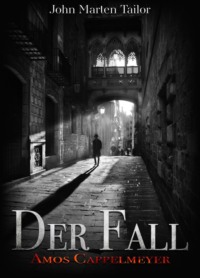Kitabı oku: «Der Fall - Amos Cappelmeyer»
Der Fall - Amos Cappelmeyer
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Nachwort
Texte: © Copyright by John Marten Tailor
Alle Rechte vorbehalten. All rights resereved.
https://john-marten-tailor.com
Umschlaggestaltung: www.thaleaklein.de/premade-neu-vercovert
Bildquellen: www.depositphotos.com und www.pexels.com
Verlag:https://john-marten-tailor.com/Impressum
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Personen und Handlungen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten sind nicht beabsichtigt und unterliegen dem Zufall.
Für meinen alten Kumpel Bernd, er würde gewiss wissen, wer gemeint ist.
Prolog
Ich bin, wer ich bin ...
Die Leute mochten mich schlicht als Mann mittleren Alters bezeichnen, mein Name: Amos Cappelmeyer. Ja, ganz recht, im Englischen wie im ostdeutschen Dialekt Ämos.
In meinem Geburtsjahr wurde Che Guevara erschossen, Martin Luther King schwang feurige Reden gegen den Vietnamkrieg und ein Dr. Manfred Eigen aus Göttingen erhielt den Nobelpreis für Chemie. Dies alles ereignete sich im Jahr des Herrn 1967. Ich stamme aus einem Örtchen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, von dem garantiert 99,9% der Menschheit niemals je gehört haben. Egal, für mich bleibt es der reizvollste Ort auf Erden.
Ich bin, wie ich bin.
Leider schlug die Damenwelt einen weiten Bogen um meine Person, da die Natur mich nicht eben gesegnet hatte, und ich, ehrlich gesagt, keine besonderen Anstrengungen unternahm, dem entgegenzuwirken. Von durchschnittlicher Statur, etwas unter ein Meter achtzig groß, hatte ich mir zumindest das volle dunkle Haar meiner Jugend bewahrt, welches von mir in Eigenleistung hin und wieder gestutzt wurde, wie der Rasen vorm Küchenfenster. Ich war weder trainiert, noch definiert - wie es auf neudeutsch heißt -, der Waschbrettbauch verbarg sich geschickt. Es bestand kein Anreiz, mit der Zeit zu gehen, bei uns auf dem Land war die Welt in Ordnung. Zu meiner modernsten Errungenschaft zählte ein preiswertes Smartphone, weil ich mir einredete als aufsteigender Stern am Schriftstellerhimmel das Internet zu benötigen.
Insgeheim sehnte sich mein Herz nach ein bisschen Zuneigung, von der großen Liebe wagte ich nicht zu träumen. Einsam suchte ich die Erfüllung als Schreiberling, mit zugegeben - mäßigem Erfolg. Hier und da einen Artikel in hiesigen Lokalblättern zu veröffentlichen, ein kleiner Lichtblick. Meine Sternstunde blieb die Kolumne »Der Totenkult in Mitteldeutschland von der Frühzeit bis zur Gegenwart am Beispiel der Gemeinde Kleinschmalkalden«, doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt, einen echten Roman zu verfassen. Etwas, mit mehr Volumen, das man in der Hand halten konnte, wie die Bücher meiner Vorbilder aus Jugendtagen. Doch selbst nie in den Genuss der EOS, der erweiterten Oberschule, gekommen, geriet meine Karriere bereits vor ihrem Beginn ins Stocken. Knauserig, wie es meine Natur vorgab, schaffte ich ein paar Cent aus der Arbeit im Postdienst auf die hohe Kante. Von den Ersparnissen versuchte ich, meinen Traum zu erfüllen, - dabei verschlug es mich ins Ausland.
Ich nahm meinen kompletten Jahresurlaub, um nach München zu reisen, wohin ich eingeladen worden war. Ja, das Warten hatte sich ausgezahlt. Nach dem Gespräch mit der Verlagsleitung wurde ich übermütig. Mit kaum mehr als meinem Postbank-Sparbuch mit 1.500 Euro, Wäsche für ein paar Tage und ein Laptop im Gepäck, entschied ich spontan, nicht direkt nach Hause zu fahren, sondern am Münchener Hauptbahnhof den nächsten x-beliebigen Zug zu besteigen. Den kündigte die Abfahrtstafel für 12 Uhr 25 auf Gleis 9 an.
Zufällig war dessen Ziel Wien.
Der Tapetenwechsel sollte meiner aufgeputschten Kreativität Vorschub leisten, daher mietete ich mich von unterwegs mit Hilfe des Smartphones für sieben Tage in einem bescheidenen Hotel in der österreichischen Hauptstadt ein. Versprach mir raschen Reichtum. Wie konnte Mann nur so blauäugig sein, sich mit einem Verlag auf ein verwegenes Angebot einzulassen: 700.000 Euro, wenn ich es fertigbrachte, einen spannenden Roman abzuliefern, Thema frei, Minimum 300 Seiten - in sieben Tagen! Einfacher als ein Lottogewinn. Der Pferdefuß: Gelang es mir nicht, verlor ich mein Haus in bester Alleinlage, doch diese Option zog ich maximal mit einem Achtel Hirnkapazität in betracht.
So nahm das Schicksal seinen Lauf.
In grenzenloser Überheblichkeit unterschrieb ich mit einem goldenen Federhalter die Vereinbarung, vor den Konsequenzen die Augen verschlossen. Man hatte mich bei der Ehre gepackt. Mich, einen drittklassigen Schriftsteller vom Lande. Nur Gevatter Tod war längst fester Bestandteil des Plans ...
Ich bin, was ich bin.
Kapitel Eins
Ein einziger Tag
Sommer 1978
Man schrieb die dritte Ferienwoche, ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch, geschaffen dafür, diesen im Freien zu verleben. Zwei Knaben, annähernd gleichen Alters, nicht nur körperlich unterschiedlich wie Tag und Nacht, fristeten ihn in einer Art ungesunder Zwangsgemeinschaft an einem kleinen See auf dem großelterlichen Grundstück. Libellen schwirrten, Bienen summten voller Lebensfreude, es duftete nach gemähtem Gras und Mücken umkreisten ihre Blutopfer, während die Kinder, nur in ihren Badehosen, Steinchen über die Wasseroberfläche hüpfen ließen.
»Ist das öde! Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich soll«, maulte der Dunkelblonde, dessen Erscheinung und besonders sein Gesichtsausdruck ihn beim ersten Blick von der Kategorie „netter Nachbarsjunge“ ausklammerte.
Dasselbe, wie letztes Jahr und das Jahr davor. »Es sind Ferien«, stellte sein Spielgefährte dann lakonisch fest, weil er keinesfalls belehrend wirken wollte. Noch beim Sprechen katapultierte er mit voller Kraft einen weiteren flachen Stein auf den See hinaus, der diesmal sofort versank. Pech.
»Scheiße, das funzt nich`. Mir reicht`s! Ich bin kein Baby mehr. Wessen behämmerte Idee war das?«
»Fluch nicht, Bruno«, mahnte der schmächtige Zehnjährige mit dünner Stimme und biss sich sofort auf die Lippe.
»Wer sagt das?«, geiferte Bruno streitlustig, wobei er extrem einer alten englischen Hunderasse ähnelte. Er litt unter enormen Stimmungsschwankungen, was sein jüngerer Vetter schmerzhaft hatte lernen müssen, als er dabei einen Milchzahn verlor. Dies ereignete sich in einem anderen, längst vergangenen Sommer. Trotzdem, jedes Wort, jeder Widerspruch könnte der Zünder für den nächsten Wutausbruch sein - und vergangen ist nicht gleich vergessen.
»Weißt du doch.« Nachdem er die Augen verdreht hatte, schleuderte Amos wieder einen flachen Stein weit hinaus, der vorbildlich dreimal hintereinander aufditschte, und freute sich insgeheim, dass er etwas besser beherrschte. Etwas, für das man weder riesengroß noch stark sein musste. Ihm lagen eher die Kopfsachen. Mathe zum Beispiel, oder Aufsätze schreiben. Locker hätte er jetzt eine Abhandlung über die Flora im Thüringer Wald zwischen Kleinschmalkalden und Tambach-Dietharz zu Papier bringen können. Einfach so. Doch Holzkopf Bruno funkelte ihn finster an, dabei zerquetschte er einen hässlichen schwarzen Käfer zwischen zwei Fingern. Schmatz.
Gar nicht gut. Amos griff nach einer Pusteblume in Reichweite und begann nervös daran herumzuzupfen.
Ein fieses Grinsen legte sich für den Hauch eines Momentes um Brunos Mundwinkel.
»Was der Alte sagt, juckt mich nicht. Der hat mir überhaupt nix zu befehlen.«
Amos zuckte zusammen. Er verabscheute es, wenn jemand respektlos von seinem verehrten Großpapa sprach. Der Großvater liebte schließlich all seine Enkel gleichermaßen. Aber der Sermon fand kein Ende:
»Bei dir sieht die Sache anders aus, du Werchel. Meine Eltern sind nicht so dämlich, sich beim Kraxeln den Hals zu brechen.« Da hatte der Cousin ein Tabu-Thema angeschnitten, bei dem selbst der beherrschte Amos aus der Haut fuhr.
»Halt sofort den Mund! Du sollst nicht so reden!«
»Ach!« Bruno sprang mit unerwarteter Behändigkeit auf. Seine kurzen Finger gruben sich in den dunklen Haarschopf des Kleineren, dass dieser aufschrie, und zerrten ihn auf die Knie.
»Au! Au! Bist du blemblem? Lass mich los!«
Bruno war in seinem Element, als er sadistisch forderte:
»Sag bitte.«
»Du sollst loslassen.« Obwohl Amos sich geschworen hatte, nie wieder klein beizugeben, zwängte er das eine Wort über die Lippen: »– Bitte.«
Bruno ließ derart abrupt los, dass Amos auf seinen Hintern landete.
»Du Lutscher! Du erbärmlicher, kleiner ...«, an dieser Stelle gingen Bruno die Vokabeln aus. In der Abteilung Gehirn war er etwas zu kurz gekommen.
»Hör auf!« Wieder auf den Beinen stürmte Amos wie eine Furie auf den Hünen zu, rammte ihm eine Faust in den Wamst. Sicher hatte der Schlag nicht ernstlich weh getan, dafür war Bruno nun echt stinkig. Mist.
Amos tat das einzig Vernünftige, er ergriff die Flucht - unter den höhnischsten Beschimpfungen.
»Lauf zu Opi, du kleiner Schmarotzer! Heul doch!«
Amos schlug einen Haken und stürzte sich von dem knapp fünf Meter langen Steg in den Teich. Er empfand das Wasser kälter, wie an einem Sommertag zu vermuten, aber als er die Augen öffnete, konnte er prima sehen.
Bruno plumpste ins Wasser. Schneller wie erwartet.
Amos Vorsprung schrumpfte weiter, dann kam ihm die zündende Idee.
Kurz tauchte er auf, um seine Lungen zu füllen. Der Teich mass an dieser Stelle eine Tiefe von über zweieinhalb Metern. Vorne am Steg gammelte ein altes Kinderfahrrad auf dem Grund herum, das einst Klein-Bruno gehörte und inzwischen von Gräsern überwuchert wurde. Die Schwimmkünste des Cousins waren nicht herausragend.
Ein Punkt für die Kleinen.
Amos witterte seine Chance, tauchte zielgerichtet unter. Bald hielt er in den Händen, was er haben wollte, genau in dem Moment, als Bruno über ihm herum paddelte und brutal versuchte, ihn zu ertränken. Amos wusste, was es zu tun galt.
Er war im Besitz der Fahrradkette, die benutze er wie ein Strick, probierte, Bruno damit zu fesseln, und zwängte ihn weiter unter den Steg. Im Wasser war alles leichter, lernt man in der Schule oder aus Erfahrung. Der Große strampelte überrascht, am Ende seiner Atemluft. Bläschen entwichen seiner Nase, die Beine zappelten, die Kette rutschte erneut ab.
Das darf doch nicht wahr sein! Wieder ein Plan, der nicht funktioniert. Bruno würde ihn windelweich prügeln. Nein, mehr noch. Mit einem Zahn als Obolus würde er sich jedenfalls nicht zu frieden geben. Plötzlich verfing sich Brunos linker Fuß im Fahrradrahmen, panisch wedelte er mit den Armen, die Augen aufgerissen. So überrascht.
Er kam nicht frei, ihm fehlte es an Kraft.
Jetzt oblag es Amos, zu entscheiden, und zwar sprichwörtlich über Leben und Tod. Nie beabsichtigte er, seinem Cousin ernsthaft zu schaden, deshalb dauerte es nur Sekunden, bis er begann, an ihm herumzuzerren, um ihn frei zu bekommen. Brunos Augen blieben geschlossen.
Amos tauchte kurz auf, stieß einen Hilferuf aus, ging danach sogleich wieder auf Tauchstation. Er bog und zerrte an dem speckigen Fuß, dann war es geglückt. Der schmächtige Junge brachte Bruno an die Wasseroberfläche, schrie erneut um Hilfe, wie es seine Lungen hergaben. Irgendwie gelang es ihm gar, den Körper an das flache, grasige Ufer zu ziehen.
Auf einmal war der Großvater da, in seiner typischen Kluft bestehend aus Holzschuhen und einem Arbeitskittel. Amos Herz ging auf.
Geschafft. Alles wird in Ordnung kommen.
»Mach platz, Werchel!«
Werchel bedeutete so viel wie kleines, unbeholfenes Kind und war fester Bestandteil des großelterlichen Vokabulars. Der ältere Mann beugte sich hinunter und tätschelte dem Bewusstlosen die Wangen.
»Bruno? Hörst du mich? Bruno? – Wie lange war er im Wasser, Ämos?«
Amos zuckte die Schultern unter dem stechenden Blick des Erwachsenen.
»Nicht lange. Weiß nicht«, stotterte er unbeholfen, wünschte sich sehnlichst, Worte zu hören wie: Es wird alles wieder gut, doch stattdessen startete Großvater Wiederbelebungsmaßnahmen. Wie gebannt starrte der Knabe auf den Brustkorb seines Vetters sowie die grauen Hände seines Vormunds, die in einem gleichmäßigen Rhythmus zu pumpen begannen.
Täuschte das, oder sah Bruno viel weniger bedrohlich aus?
Die sich überschlagende Stimme des Großvaters riss Amos aus seinen Gedanken.
»Und eins, und zwei, und drei!« Unverhofft hustete Bruno, würgte, bis Wasser aus Mund und Nase trat. »Junge, mein lieber Junge! Du bist da. Alles in Ordnung?« Krächzend kam ein »Ja«, das Amos in diesem Moment alles bedeutete.
»Was ist denn nur geschehen? Ämos?«
»Uns war so warm, deshalb sind wir schwimmen gegangen. Auf einmal waren da ganz merkwürdige Wasserwesen, die haben Bruno festgehalten ...!«
»Ach, Ämos, du mit deiner blühenden Fantasie. Reiß dich zusammen. Dein Cousin wäre fast ertrunken!« Und im gleichen Atemzug: »Wir bringen dich erstmal rein. Wie wäre das, Junge?«
»Mmh.«
»Fass mit an, Ämos. Wir schaffen ihn in die Küche. Da kann er sich aufwärmen.«
Beim Abendessen waren sie vollzählig am Tisch versammelt. Die Großeltern auf der einen, die Kinder auf der anderen Seite. Der blasse Amos hielt den Blick gesenkt, erwartete jeden Augenblick die fällige Standpauke, doch die blieb aus. Bruno verhielt sich merkwürdig, hatte nicht mehr gesprochen seit dem Erlebnis im Teich.
Großvater blätterte missmutig in den Thüringer Nachrichten, räusperte sich. Er bekam jedes Mal schlechte Laune, wenn er über das Übel im Lande las. Deshalb hatte Amos gelernt, Zeitungen als eher abträglich für den Familienfrieden einzustufen. So kam es sporadisch vor, dass ein Exemplar, welches er am Morgen aus dem Briefkasten holen sollte, verschwand. Das Resultat erwies sich jedoch als kontraproduktiv, denn Großvaters Laune blieb den kompletten Tag über getrübt.
»Das darf nicht wahr sein«, raunte Luitpold, ohne die Lippen zu bewegen.
»Wie bitte? Du sprichst in Rätseln. Lass uns teilhaben, Lui«, forderte Oma Hilde, entfaltete ihre Serviette und drapierte sie auf ihrem Schoß, wie es sich für eine Dame geziemte. Sie hatte nicht aufgegeben, den Kindern Tischmanieren beibringen zu wollen, doch das hatte weder bei ihrem Gatten funktioniert, noch bei den eigenen Kindern und die Aussichten für die jüngste Generation Cappelmeyer standen lausig.
»Noh, im Harz oben ist eine Frau abgängig - bei diesen schwerreichen Hotelheinis. Weißt schon, die wo ständig die Annoncen in der Zeitung sind. `Nen Sohn hat`s wohl, kaum älter als wie unsere Beiden hier und plötzlich ist sie wie vom Erdboden verschluckt? Wer glaubt denn sowas? Hier, sogar mit Foto.« Er klopfte auf das Bild, als ob die anderen am Tisch es dann besser sehen könnten. »Kann fast jede sein, wenn ihr mich fragt. Aber es ist eine Belohnung ausgelobt, stellt euch vor. 500 Mark! – Glaube ja nicht, dass sie gefunden wird. Aber wer fragt einen alten Mann.«
»Ja, ja, die Welt ist verdorben«, nickte Hilde traurig, klatschte in die Hände und knipste in Nullkommanichts ihr bestes Sonntagslächeln an. »Aber jetzt esst bitte auf, Jungs und dann ist Schlafenszeit für euch. Morgen ist ein neuer Tag.«
500 Mark, das war unvorstellbar viel Geld, nicht nur für einen Knaben wie Amos.
Kapitel Zwei
Unklar
Gegenwart
… das Unfassbare geschah gleich in der ersten Nacht. Baufahrzeuge frästen alten Asphalt von der Straße direkt unter meinem Fenster. Eine Arbeit, über deren Sinn oder Unsinn ich nicht zu urteilen vermochte.
Auf jeden Fall stank es unerträglich nach verbranntem Teer.
Ein Höllenlärm, den kompletten Spätnachmittag lang, seit ich nach viereinhalb Stunden Zugfahrt die Zimmertür aufgesperrt hatte. Zudem war es stickig und warm in dem Kabuff, welches mir als Sparzimmer verkauft worden war. Wie sollte ich da schlafen, geschweige denn schreiben können? Ich, der Schriftsteller, inmitten seiner kreativen Phase, der nichts als absolute Stille und Ruhe gewohnt war? Für den ein Buntspecht bei der Arbeit an Lärmbelästigung grenzte?
Das Schreiben konnte ich mir heute abschminken, hoffte auf morgen.
Um nicht länger in der Enge des stillosen Zimmers sinnlos umher zu tigern, klappte ich den Laptop zu, streifte mir mein abgewetztes Lieblingsjackett mit den Armflicken über die Schultern, setzte meinen Stetson auf und begab mich in die Lobby. Der hochnäsige Concierge versicherte mir, nicht über die Straßenbaumaßnahmen informiert worden zu sein. Ich kaufte ihm das nicht ab und beschloss, um die Häuser zu ziehen. Immerhin war dies die Landeshauptstadt, da sollte doch was gehen.
Weit kam ich nicht, denn ich hatte nie Bauarbeitern hautnah bei der Arbeit zugesehen. Eine eigentümliche Faszination ergriff mich. Die rotierenden Scheiben der Fräse fraßen sich hungrig durch maroden welligen Teer. An der Seite mitlaufend beobachtete ich die drehenden Fräsmonster. Meine Neugier blieb nicht unbemerkt.
»Was glotzt`n Du so dämlich, du Tunte? Noch nie ehrliche Männer bei der Arbeit gesehen?«
»Äh, offen gesagt, nicht.« Kurzum schilderte ich dem Straßenarbeiter, dass ich einer der bekanntesten Schriftsteller unserer Epoche sei und gewöhnlich mit meiner Zeit knausern müsse. Er zog zweifelnd eine balkenförmige Augenbraue hoch.
»Ach, echt? Wie ist dein Name, Hallawachl?«
Ich räusperte mich, rang um Selbstbewusstsein: »Amos Cappelmeyer.«
»Kappelmeier? Ja, von dem habe ich gehört. Das ist doch der, der ...«
Zu meiner Verwunderung schien mein Gesprächspartner diesen Namen zu kennen, woher auch immer, und zitierte aus Büchern, von denen ich nichts wusste. Seine unrasierte Visage lud zum Reinschlagen ein, während er auf gebildet tat und seine Augen leuchteten gar wie kleine Funken, als er sein literarisches Wissen kundtun durfte, ohne von den harten Knochen aus der Asphalt-Branche verspottet zu werden.
Sollte ich mich zu erkennen geben, zugeben, dass ich in Wahrheit eine Null war? Kam nicht in Frage, denn ich würde den fürchterlichen Kerl der Firma »Leffler International Bau« niemals wieder sehen und machte mir einen Jux daraus, vorzugeben, jemand zu sein. Nach einer Weile fühlte ich mich wie sein Bruder, wir qualmten sogar eine Kippe zusammen. Doch die Kaltfräsmaschine produzierte auf einmal merkwürdige Geräusche und ruinierte den Moment. Gunar, so hieß der Typ, beschattete mit einer Hand seine Augen und fluchte, den Glimmstängel zwischen den Lippen:
»Scheiße! Nicht schon wieder.«
»Was meinst du damit, Gunar? Passiert das öfters?«
»Frag nicht so dämlich.« Als Mann weniger Worte demonstrierte ein fester Griff in meinen Nacken seine Entschlossenheit. Er schleifte mich zur Asphaltfräse.
»So, du Dummschwätzer, jetzt bist du dicht genug dran am Geschehen und kannst sehen, wie die Maschine ihre Arbeit ereldigt.« Das rotierende Fräswerk, welches direkt vor meiner Nasenspitze lärmend Fräsgut durch die Gegend spuckte, jagte mir gehörig Ballerkacken ein. Mein Alter Ego brüllte wie am Spieß, was zum Glück im Lärm der Fräse unterging. Oder?
»Spuck es aus, wer bist du, du Spinner?«
»Ich, ich bin ...« Vor Aufregung pinkelte ich mir in die Hosen. Es wurde wärmer um meine Genitalien. Gut, dass ich den Großteil an Flüssigkeit bereits ausgeschwitzt hatte. Er ließ von mir ab. So schnell mich meine Füße trugen, rannte ich davon. Die Ledersohlen klackerten höllisch laut, doch das fiese Lachen dröhnte noch aus einhundert Metern Entfernung in meinen Gehörgängen. Wieder Mal hatte ich versagt, sah aus wie ein Heckenpenner. Mit dem Jackett verdeckte ich die einurinierte Stelle, stank jedoch zehn Meter gegen den Wind. Selbst die Hotelbediensteten krümmten sich vor Lachen, bildete ich mir ein. Zitternd schloss ich mein Zimmer auf, welches linker Hand in einem schlauchartigen Flur lag, dessen Boden von geschmackloser rotgepunkteter Auslegeware geschmückt war, die den Geruch von Verwesung ausdünstete. Noch im Vorraum entledigte ich mich meiner Kleider. Schleunigst die Taschen entleeren. Eine rasche Dusche könnte helfen, nur wie üblich fehlte in der Flasche die Seife. Entnervt rief ich bei der Rezeption an, um dort meinem Unmut Luft zu machen.
Wenig später klopfte es.
»Wer da?« Keine Antwort. »Herrgottszeiten.« Ich riss die Tür auf, vor mir stand eine bildschöne rothaarige Frau mit einer Flasche knallgelber Flüssigseife und einem Grinsen von Ohr zu Ohr.
»Zimmerservice! - Die Saf. Soll ich dich einsafen, Schnuckiputz?«
»Bitte was? Unterstehen Sie sich! Nun geben Sie schon her!« Ich entriss ihr die Flasche und knallte der zwielichtigen Person die Tür vor der Nase zu. Nachdenklich, aber rollig trat ich unter die Dusche. Schließlich war ich nur ein Mann aus Fleisch und Blut. Meine Lanze stand kerzengerade, dürstete danach, ein Weib zu beglücken.
»Was meint ihr, ist das gut so?«, erkundigte sich die kleine Rothaarige angeekelt, als sie sich kunstvoll drapierte. So nah am Boden stiegen Ausdünstungen in ihr zartes Näschen, die nichts erfreuliches Vermuten ließen. Mittlerweile bereute sie, sich auf dieses Kammerspiel eingelassen zu haben. Der Bodenbelag kratzte, wie ein Strohballen auf nackter Haut und binnen Sekunden war ihr, als ob ihr ganzer Körper von unzähligen mikroskopisch kleinen Parasiten befallen worden sei. Eine Dusche würde danach nicht ausreichen. Sie hatte sich definitiv unter Wert verkauft. »Machen die hier auch mal sauber?« Die Frage galt ihren beiden männlichen Begleitern, die das Equipment aus Filmrequisiten in einem Alu-Koffer verstauten.
»Halt die Klappe und rühr dich nicht«, bekam sie zur Antwort.
»Okey-dokey. Tote Frau kann ich am besten.«
»Sonst wären wir nicht hier, Süße.« Noch ein paar letzte Handgriffe, dann war alles perfekt arrangiert.
»Die Show kann beginnen. Und keine Bewegung, Beata. Rückzug, Franky. Wir sind raus.« Die beiden Männer eilten den verwaisten Korridor entlang und entschwanden über den Notausgang.
Dreißig Minuten später duftete der Anzug angenehm nach Zitrone und hing zum Abtropfen in der Wanne. Mit einem Handtuch um den Bauch gewickelt öffnete ich die Tür einen Spalt, schielte hinaus. Womöglich stand sie ja noch da? Ich hegte die unsinnige Hoffnung, dass sie auf mich gewartet hatte.
Verdammt! Und ob sie noch da war.
Mir verging mit einem Schlag alles.
Ausgerechnet jene Frau, die mir vor wenigen Augenblicken ein zwielichtiges Angebot unterbreitet hatte, lag tot vor meiner Tür. Was für ein Desaster, das bedeutete Ärger mit der Polizei.
Leere Augen starrten an die Decke. Durchtrennte Kehle. Eine Wunde zog sich gut fünfzehn Zentimeter von einem Ohr zum anderen. Kein appetitlicher Anblick. Winzige Einkerbungen an den Wundrändern hatte ich längst bemerkt und analysiert. Als eifriger Krimifan hatte ich keine Folge meiner Lieblings-TV-Serie verpasst und wusste bestens Bescheid. Grundsätzlich kamen nicht viele Messertypen in Betracht. Davon abgesehen, hatte ich trotz meines Alters nie zuvor einen toten Menschen gesehen.
Ein Würgereiz reaktivierte die stibitzten Chips aus der Lobby. Vor Schreck schnellte die Tür ins Schloss zurück. Aufbrandendes Geschrei im Flur bereitete mir gehöriges Fracksausen. Kurz darauf klopfte es energisch, doch meine Stimme versagte den Dienst. Das Hämmern ließ Wände erzittern, akustisch untermalt von den Worten:
»Polizei! Öffnen Sie sofort die Tür!« Warum sollte ich? Meine Weste war rein, daher stellte ich mich taub. »Wir wissen, dass Sie da sind. Aufmachen!«
Eine Minute später durchbrachen sie die Tür, pressten mich nackt gegen die Wand.
»Hey, Moment mal!« Handschellen klickten unsanft meine Handgelenke hinter meinem Rücken zusammen. Die Staatsgewalt dachte nicht im Traum daran, einen Mörder zu bekleiden. Was sollte ich auch anziehen? Den Anzug hatte ich gerade frisch gewaschen, er hing tropfend in der Duschwanne, somit sprachen alle Indizien gegen mich. Schweiß benetzte meine Stirn. Die Polizei sah nur, was sie sehen wollte. Einer der Beamten schüttelte den Kopf, als ob er fürchterlich enttäuscht von mir sei. Dabei kannten wir uns überhaupt nicht.
»Ab mit dem Wicht!«
Sie führten mich durch das Treppenhaus, ich betone, unbekleidet. Auch die Lobby sollte auf ihre Kosten kommen. Hinter vorgehaltener Hand amüsierte man sich über meinen zu klein geratenen Penis. Die Uniformierten drückten mich gedemütigt auf den Rücksitz aus Kunstleder. Es quietschte. Sogar vorschriftsmäßig angeschnallt wurde ich von den pflichtbewussten Beamten, die jedoch nicht umhinkonnten, eine weitere herablassende Bemerkung über mein kleines Geschlechtsteil fallen zu lassen. Was für Hohlbirnen, nur Augen für das Offensichtliche. Mir wurde übel bei dem Gedanken, dass bedeutsame Spuren außer Acht gelassen werden könnten. Aber was sollte ich tun, hatte ich doch nur wenig Zeit meinen Roman zu vollenden. In diesem Moment verfluchte ich meinen Leichtsinn, im Handumdrehen Geld generieren zu wollen. Dass ich als Mörder hätte eingebuchtet werden können, kam mir nicht in den Sinn.
Am Polizeirevier angekommen, einem unscheinbaren Gebäude ohne jeglichen Charme, fiel eine Handvoll Reporter wie die Geier über meine Person her, schossen jede Menge Fotos. Auch Fragen, wie ich die Frau umgebracht habe, waren dabei. Wie konnten sie es wagen, mich in der Öffentlichkeit dermaßen bloß zu stellen! Und wie, zum Henker, konnte das mit der Frau so rasch bekannt werden?
Ich schwieg verbissen. Hatte ich keine Rechte?
Mit dem nackten Gesäß auf dem kalten Blechstuhl sitzend, wartete ich auf die anstehende Befragung. Doch zu meiner Verwunderung erschien niemand. Dauernd ging die Tür auf und verschiedene Personen spazierten an mir vorbei mit scheelen Blicken. Ich war die Attraktion auf dem Revier und machte dicht.
Abermals sezierte ich das Erlebte gedanklich, überlegte, was ich übersehen hatte.
Hunger und Durst quälten mich, pissen musste ich obendrein. Nach einer gefühlten Ewigkeit, schätzungsweise sechs bis acht Stunden, betrat ein Polizeibeamter den Raum, der einen Stock verschluckt haben musste. Ein Polizeioberkommissar seines Zeichens, der verkündete:
»Herr Cappelmeyer, Sie dürfen gehen. In ein paar Minuten bringt ein Kollege Ihr Gewand.« Keine Entschuldigung, nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Wiederum dauerte es zwei Stunden, bis jemand für mich Zeit fand. Die Beamten knallten meine Sachen auf den Tisch, Reisetasche, Notebooktasche, den Stetson. Wohl denn, nichts geht über einen ordentlichen Hut. Sobald ich ihn trug, fühlte ich mich wie ein Geheimagent längst vergangener Zeiten.
Gedanken an die arme Frau plagten mich. Sie war die Einzige, die mir überhaupt je ein unmoralisches Angebot unterbreitet hatte. Schuldete ich ihr deshalb etwas? Während ich mich anzog, betrat ein anderer Polizist den Raum, ein weiterer unsympathischer Bursche. Er erwies sich als höflich und schien bemüht um meine Person.
»Herr Cappelmeyer, ich fahre Sie zurück zu Ihrem Quartier.«
Das war das Letzte, was ich wollte.
»Nein! Kommt nicht in Frage. Warten Sie kurz.« Mein Smartphone besaß nur minimale Energie, die Datenübertragung war auf Schneckentempo gedrosselt, aber für eine Hotelsuche musste es genügen. »Bingo!« Das abgelegene 2-Sterne-Haus in der Nähe versprach Ruhe und sollte für meine Bedürfnisse ausreichen. »Zur Schwalbe«. Allein der Name ließ die Herberge verdächtig erscheinen. Große Auswahl blieb um diese Zeit allerdings nicht. »Da will ich hin.«
»Wie Sie meinen.« Der Beamte chauffierte mich.
Ich rechnete mit dem Desaströsesten, da meine Visage gewiss in sämtlichen Nachrichtensendungen durch den Dreck gezogen worden war. Offenbar gab es hier keinen Fernseher oder er war kaputt. An der Rezeption buchte ich mit hochrotem Kopf ein Einzelzimmer für sechs Übernachtungen mit Frühstück auf Kosten der Polizeibehörde. Der Beamte unterschrieb die Rechnung und verabschiedete sich formvollendet. Sollte ich jetzt Erleichterung verspüren? Mir war nach allem, etwa einen Heben bis der Arzt kommt, oder doch eher Sex? Der Portier räusperte sich und überreichte mir den Schlüssel.
»Nummer Sechs, bitteschön. Das Zimmer ist nach hintern gelegen, eines unserer größten. Die Stiege ist da vorne.« Treppe, kein Fahrstuhl. Na ja, hatte ja nur leichtes Gepäck. Also machte ich mich auf in die dritte Etage zu Zimmer sechs, wieder auf der linken Seite, zog die elektronische Karte durch den Scanner. Die Tür sprang weit auf. Überraschenderweise eröffnete sich vor mir eine Wohnlandschaft von wenigstens zwanzig Quadratmetern mit einem separaten Schlafraum. Bestimmt hatten die unsichtbaren Finger der Polizei mitgewirkt, was mir nur recht war und der Ärger teilweise besänftigt. Ich war ein genügsamer Mensch. Erziehung prägt uns ein Leben lang.
In mir staute sich die Müdigkeit, aber meiner Geldbörse stand ein anstrengender Job bevor. Nach dem Frischmachen suchte ich den hauseigenen Schankraum auf, dort quetschte ich mich auf einen von sechs freien Barhockern. Es gab wenig Publikumsverkehr. Der Barkeeper platzierte prompt eine eiskalte Flasche Wodka, Soda und ein Glas auf den Tresen. Der Alkohol plätscherte kaskadenartig über das Eis im Becher, das bei dem Kontakt knisterte und knackte. Der erste Schluck umschmeichelte den Gaumen. Einkehrende Ruhe beförderte meine Gedanken zu der toten Frau, die mit durchtrennter Kehle ihre Leben ausgehaucht hatte. Die zackigen Abrisse an den oberen Hautschichten, Hand-, und Fußgelenken, die Fesselungsspuren aufwiesen, waren ein Indiz für Gewalt, aber ohne Obduktionsbericht nur schwer zu beurteilen. Ein unlösbares Puzzle, hatte es den Anschein, aber nicht für Amos Cappelmeyer!