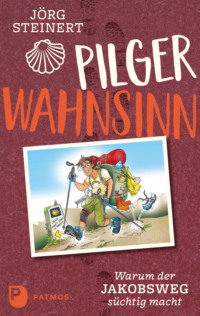Kitabı oku: «Pilgerwahnsinn», sayfa 2
2 AUF DEM KÜSTENWEG: ZWISCHEN BEGEISTERUNG UND ZWEIFEL
Überfüllte Herbergen
In Berlin schwärmte ich allen von meinen Erfahrungen auf dem Jakobsweg vor. Ich recherchierte die Gesamtlänge des Camino del Norte, der zum Großteil entlang der spanischen Atlantikküste verläuft. 150 Kilometer hatte ich schon geschafft. Es lagen also noch 680 Kilometer vor mir.
Im Juli des gleichen Jahres ging es weiter. In drei Wochen wollte ich von Bilbao nach Santiago laufen. So lange hatte ich noch nie Urlaub im Ausland gemacht.
Ich war voller Tatendrang, an meiner körperlichen Fitness hatte ich aufgrund der guten Erfahrungen im Baskenland keinen Zweifel. Und die Wunderwaffe Hirschtalg sollte meine beanspruchten Füße wieder vor Blasen schützen. Andere Verletzungen und Erkrankungen fürchtete ich nicht.
Ich ging von wenigen Menschen aus, da der Küstenweg aufgrund seines Schwierigkeitsgrades nur von etwa sechs Prozent der Pilger gelaufen wird. Zwar regnet es zwischen Atlantik und Bergen häufig, aber mit der richtigen Kleidung wäre das alles kein Problem. Sicherheitshalber hatte ich mir eine neue Wanderhose gekauft.
Zu meinem Glück war es sommerlich warm. Ich startete in Portugalete bei Bilbao, wo ich im Frühjahr meinen Weg vorerst beendet hatte. Die Herberge war ungewohnt voll. Sechs Prozent waren also gar nicht so wenige bei einer geringen Herbergsdichte. Aber ich bekam ein Bett. Es hatten sich schon erste Grüppchen gebildet. Ich blieb allein.
Am ersten Pilgertag lief ich 27 Kilometer, das waren acht Kilometer weniger als meine neue tägliche Durchschnittsdistanz. Meine Pilgerfreundinnen Christine und Maria, mit denen ich SMS schrieb, sahen meine ambitionierten Pläne kritisch, da wir im Baskenland täglich maximal 25 Kilometer gelaufen waren. Aber dort kennzeichneten auch anspruchsvolle Höhenprofile und ein matschiger Untergrund den Weg. Und ich wollte nun eine echte Herausforderung meistern.
Die Landschaft empfand ich als wunderschön. Selbst die Etappen entlang der Autobahn störten mich nicht.
Als ich am ersten Pilgertag sehr erschöpft in Castro Urdiales ankam, fing mein rechtes Bein im Bereich der Achillessehne an zu schmerzen. Auf dem letzten Kilometer forderte mich das Gehen sehr. Aber ich war mir sicher, am nächsten Morgen sei alles wieder gut.
Zunächst musste ich aber das spanische Wort „Completo“ lernen. Die Pilgerherberge war überfüllt, sogar alle Notschlafplätze waren vergeben. Ausgerechnet ich war der erste Pilger in der Schlange, der kein Bett bekam.
Hilfsbereit wurde mir eine private Unterkunft organisiert. Die älteren Leute vermieteten ihre Gästezimmer und Schlafplätze auf dem Sofa. Ich war stundenlang der einzige Pilger im Haus. Die Frau redete unentwegt auf mich ein. Ich musste ständig in meinem Mini-Wörterbuch blättern, um an der Konversation irgendwie teilhaben zu können.
Mein Magen knurrte vor Hunger. Die anderen Pilger, die inzwischen angekommen waren, vermittelten mir, dass ich mich daran gewöhnen müsse, dass das Abendessen erst sehr spät eingenommen wird.
Mit vollem Bauch ging es kurz nach 22 Uhr zu Bett. Die Nacht war die Hölle. Der nette spanische Pilger in meinem Doppelzimmer hörte sich wie eine Kettensäge an. Am Frühstückstisch sahen mich alle mitleidig an, weil sie das Schnarchorchester durch die Wände mitbekommen hatten.
Aber noch schlimmer war, dass sich die anfänglichen Schmerzen zu einer Achillessehnenentzündung entwickelt hatten.
Ich humpelte pflichtbewusst langsam los, gestützt auf meinen Wanderstock. Alle Pilger überholten mich. Ich hörte häufig ein freundliches „Buen Camino“, ein Gespräch kam nicht zustande. Auch nicht mit der Anfang 20-jährigen Jessi und ihrem etwa zehn Jahre älteren Freund Nils aus Hamburg. Ich hatte sie schon am Flughafen in Berlin an ihrem gelben Buch als Pilger identifiziert. Das Paar machte einen netten Eindruck, sie wirkten zugleich etwas distanziert. In einem sportlichen Stechschritt zogen sie an mir vorbei.
Wie sollte ich humpelnd 35 Kilometer zurücklegen? Was war denn auf einmal los? Aber ich hatte einen strikten Plan, daher zeigte ich Biss. Und es ging weiter voran, wenn auch nur langsam.
Während alle anderen Pilger einen langen Strandabschnitt genossen, war ich vom mühsamen Laufen auf dem Sand genervt. Ich hielt immer wieder an. Weniger wegen des wunderschönen Ausblicks, sondern wegen der Schmerzen.
Die erste Cafeteria war die meine. Hier konnte ich einen Café con leche genießen. In Deutschland trank ich bis dahin nie Kaffee, aber in Spanien lechzte mein Körper danach. Und da kam er: ein sportlicher Mann um die 35 Jahre, der eine halbvolle Flasche Wein mit sich durch die Gegend trug. Ich hatte bis dahin meist Pilger kennengelernt, die sogar die Wäscheklammern vor der Pilgerreise abwogen oder in der Lage waren, sich auf das wirklich Notwendigste zu reduzieren. Und jetzt war da dieser Typ, der Wein mit sich herumschleppte, in einer schweren Glasflasche. Ohne mit ihm zu sprechen, mochte ich ihn. Eine halbe Stunde später hörte ich Schritte hinter mir. Es war Mr. Weinflasche. Er hatte in einem anderen Restaurant Halt gemacht. Auch er war allein unterwegs und hatte bislang ebenso keinen Anschluss gefunden. Ihn faszinierte an mir, dass ich humpelnd unterwegs war.
Der junge Papa lebte getrennt von seinem Kind und seiner Ex-Partnerin. Sein Motiv für den Jakobsweg lag daher auf der Hand. Ich hatte schon viel davon gehört, dass Menschen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen, kurz nach dem Ende einer Beziehung oder zum Stressabbau auf den Jakobsweg gehen. Bei mir war es die Mischung aus allem, vielleicht auch etwas Abenteuerlust.
In den nächsten Tagen kreuzten sich meine Wege immer wieder mit Jessi und Nils. Irgendwie gelang es mir, die gleichen Tagesetappen wie sie zu schaffen. Jessi brauchte nicht lange, um festzustellen, dass Mr. Weinflasche sein Leid in Alkohol ertränkte. Beliebt machte er sich damit bei dem norddeutschen Paar nicht, das weitestgehend auf Alkohol verzichtete.
Ich beteiligte mich weder an der abendlichen Kneipentour von Mr. Weinflasche noch wollte ich in den Chor der Enthaltsamkeit einstimmen. Ich erfreute mich wie die meisten Pilger jeden Abend an einer halbe Flasche Wein, die es zum 3-Gänge-Pilgermenü für insgesamt nur zehn Euro gab.
Nicht nur das Essen und Trinken war verdammt günstig. Auch die Unterkünfte. Da ich aufgrund meines langsamen Tempos in den Pilgerherbergen jedoch häufig keinen Platz mehr bekam, musste ich auf Pensionen und Hotels ausweichen. Der Vorteil war, dass ich hier besser schlief. Der Nachteil lag in den höheren Kosten. Auch wenn 30 Euro nicht viel waren für eine Nacht, so waren es doch erheblich mehr als sechs Euro. Einige deutsche Abiturienten übernachteten daher notgedrungen im Freien. Das kam für mich nicht infrage.
Es lief irgendwie alles anders als erwartet. Die Verstöße gegen die mir bekannten Pilgerregeln störten mich besonders. Warum hielten sich die Mitpilger im Sommer nicht an die Nachtruhe im Schlafsaal ab 22 Uhr? Da waren die partywütigen Studenten und Schüler. Und dann war da auch noch Jesus. Er hieß nicht wirklich so. Aber der etwa 40-Jährige verglich sein Leid mit dem von Jesus Christus. Die jüngeren Pilgerinnen nahmen ihn offenbar auch noch ernst. Ich war von dem Gejammer nur genervt.
Jesus war ein lieber Kerl, aber auch ein ungepflegter Schmarotzer. Er wollte alles umsonst. Selbstbewusst hatte er sich ohne jegliches Geld auf den Weg begeben. Sosehr er für sich in Anspruch nahm, keinen finanziellen Beitrag zum Schlafplatz und zum gemeinsamen Essen zu leisten, so sehr interessierte er sich auch nicht für die Regeln. Das genaue Kontrastprogramm zu mir. Und nun standen unsere Betten auch noch nebeneinander.
Die übelriechenden Wanderschuhe durften nicht mit in den Schlafsaal genommen werden. Sie standen im überdachten Außenbereich zum Auslüften. Kurz vor 23 Uhr und nach vielen Diskussionen sollte nun endlich das Licht im Schlafsaal ausgemacht werden. Jesus kam kurz zuvor herein und zehn Sekunden vor der kompletten Dunkelheit im Saal zog er seine Wanderschuhe direkt neben meinem Kopfende aus und stellte sie auf den Boden. Es roch bestialisch. Ich hätte die Schuhe gerne beiseitegeschoben. Aber ich ekelte mich davor, womöglich versehentlich in die schweißgetränkten Latschen zu fassen. Daher drehte ich mich angewidert in die andere Richtung, im Nacken die unmenschliche Duftwolke von Jesus. Mir blieb hier wirklich nichts erspart.
Zumindest die Sonne lachte mich jeden Tag an. Am Surferstrand etwa zwei Kilometer vor Santander genossen die anderen Pilger mal wieder einen schönen Wegabschnitt direkt am Meer. Mich schmerzte hingegen immer noch jeder Schritt im Sand, und ich sehnte mich nach der Fähre, die wohl bald kommen würde. Eine junge Surferin lief auf mich zu. Sie wollte wissen, ob ich ein Jakobspilger sei. Ich bestätigte dies. Sie strahlte über das ganze Gesicht und berichtete, dass sie den Weg im Vorjahr gelaufen sei und dass dies ihr Leben verändert hätte. Ihre Offenheit beeindruckte mich sehr. Bis eben war ich noch auf meine Schmerzen konzentriert. Jetzt fragte ich mich, ob der Camino auch mein Leben verändern würde.
Natürlich kam ich auch mit anderen Pilgern ins Gespräch. Aber es waren immer die gleichen oberflächlichen Fragen, die einander gestellt wurden. Woher kommst du? Wohin gehst du? Was machst du?
Die Frage nach dem Woher bezog sich auf die eigene Herkunft. Dies umfasste meist den aktuellen Wohnort. Deutschland galt als nichts Besonderes. Aber Berlin fanden alle cool.
Das Woher bezog sich aber auch auf den Start der eigenen Pilgerreise. Die Pilger waren an ganz unterschiedlichen Orten gestartet. Und auch nicht jeder Pilger brachte die Zeit und die Kraft auf, bis Santiago zu laufen.
Auf die Frage nach meinem Beruf hatte ich keine Lust. Schließlich war die katholische Kirche noch nie für ihre Toleranz gegenüber Homosexuellen bekannt. Und es war nun mal ein katholischer Weg. Doch die Reaktionen waren durchgängig sehr positiv. Zugleich redete ich in meinem Urlaub nun über die Arbeit.
Aber ich hatte hier weiß Gott andere Sorgen. Viele Stunden am Tag konnte ich in der wunderschönen Natur allein laufen, in Ruhe meinen Gedanken freien Lauf lassen. Doch spätestens am Nachmittag, wenn es um die Herbergssuche ging, trat der Bettenmangel wieder offen zutage.
Zum Glück ging es mir dank einem Tape am Bein inzwischen gesundheitlich wieder etwas besser. Ich kam zunehmend schneller voran. Dass ich in den Herbergen häufig trotzdem keinen Platz mehr bekam, frustrierte mich, zumal die Bettenvergabe alles andere als fair lief. Da war zum Beispiel der Chinese Lee. Er war perfekt gestylt, sogar der Kaffeebecher aus Metall, der am Rucksack baumelte, schrie nach Lagerfeuerstimmung. Doch Lee war kein Abenteurer, er war vielmehr ein Busreisender. Er war ein sehr freundlicher Mann. Seine Feststellung „Oh, du bist heute wirklich wieder die gesamte Strecke gelaufen“ war sicher als Lob gemeint, aber ich empfand sie als Provokation. Lee war nicht der einzige Pilger, der sich das Leben mit motorisierter Hilfe leichter machte.
Da mich Jessi und Nils nur humpelnd kannten und ich auf einmal immer eher als sie am jeweiligen Tagesziel ankam, vermuteten sie, dass auch ich zu den Busreisenden gehören würde. Aber in Wahrheit folgte ich einer harten Routine mit frühem Aufstehen und wenigen Pausen.
Jessi und Nils hatten zwar sechs Wochen Zeit, aber aufgrund der überfüllten Herbergen mussten auch sie sehr lange Tagesetappen auf sich nehmen. Ich freute mich, die vertrauten Gesichter immer wiederzusehen. Und bei jeder Begegnung berichtete ich über andere Beschwerden. Sie witzelten, welche neue Verletzung oder Erkrankung ich mir als Nächstes zuziehen würde. Nach der Achillessehnenentzündung folgte eine Magendarmerkrankung, ein Wespenstich am Po, Schürfwunden durch einen Sturz in einen Graben, ich ließ fast nichts aus. Und trotzdem wirkte ich unbekümmert, unbeschwert und optimistisch. Ich litt jedoch, anders als mein Lächeln vermuten ließ, sehr unter dem Stress und den Strapazen. Und mein Galgenhumor half langsam auch nicht mehr weiter.
Die einzigen Belohnungen, die ich mir gönnte, waren das reichhaltige Pilgermenü am Abend, guter spanischer Wein und das Dessert Flan, die spanische Variante von Karamellpudding. Ansonsten war mein Tag darauf ausgerichtet, mit schwerem Rucksack auf den Schultern 35 Kilometer in hügeligem Gelände zu meistern und einen überdachten Schlafplatz zu finden.
Auch gab es trotz der vielen Pilger kaum ein geselliges Miteinander, so wie ich es beim ersten Mal erlebt hatte. Die meisten waren irgendwie für sich. Man kannte sich, aber ich fühlte mich nicht wirklich verbunden. Jessi und Nils ließen mich nur langsam an sich heran.
Zumindest die nahende Regenfront wurde ein interessantes Gesprächsthema. Während bei den anderen Pilgern Panik ausbrach, nahm ich es gelassen. Mit meinem lieb gewonnenen Regenponcho und der neuen Wanderhose war ich bestens auf das schlechte Wetter vorbereitet. Ich freute mich sogar ein bisschen darauf.
Es dauerte nur wenige Minuten im Regen und ich musste feststellen, dass meine neue Hose nicht wasserdicht war, sondern sich wie ein Schwamm vollsaugte. Der nasse Stoff klebte sehr unangenehm an der Haut. Ansonsten hatte ich nur kurze Hosen und eine Wanderleggins dabei. So oder so würde das Wasser von oben in die Wanderstiefel laufen. Und das nicht nur für ein paar Stunden, auch nicht für einen Tag, sondern für vier Tage am Stück. Mir war inzwischen alles egal.
Nach dem ersten Regentag waren nicht nur meine Füße kalt und nass, sondern fast der gesamte Inhalt meines Rucksackes war feucht. In meinem Pilgerbuch stand, dass man die Kleidungsstücke in Stoffbeutel packen solle, weil durch das Geraschel von Plastiktüten andere Pilger im Schlafsaal gestört werden. Na toll, Stoffbeutel waren vielleicht nicht geräuschintensiv, aber sie saugten sich voll Wasser. Wie war überhaupt Wasser in den Rucksack gekommen? Ein Reißverschluss war einen Spalt offen. Und ich wusste bis dahin nicht, dass man den Poncho auch über den Rucksack stülpt und nicht wie eine Regenjacke nur am eignen Leib trägt. Es war zum Heulen. Sogar mein Schlafsack war nass. Keine einzige trockene Hose. Nur noch ein T-Shirt, meine Badehose und ein Paar Wechselschuhe waren trocken.
Mein Blick beim Laufen war in den kommenden Tagen nur noch zu Boden gerichtet. Mein Regenschutz hielt bis zum Knie. Ab dort floss mir das kalte Wasser die Beine herunter. Die Kälte stieg in mir auf. Ab und zu zog ich mich unter dem Vordach einer Garage oder im Häuschen einer Bushaltestelle um, damit ich zumindest für ein paar Minuten den Eindruck von Trockenheit und Wärme hatte. Ein Kirchenbesuch zum Innehalten und Ausruhen war mir nicht gegönnt. Alle Kirchen auf dem Weg waren abgeschlossen. Restaurants und Bars gab es auf diesem Wegabschnitt nur sehr wenige.
Ich war abends dankbar für jede Herberge. Hauptsache ein trockenes Bett. Na ja, fast jede Herberge. In der angeblich urigen und stimmungsvollen Herberge in San Vicente de la Barquera war es schmutzig, die Matratzen waren durchgelegen und im Badezimmer fiel ständig der Türknauf ab. Als ich nachts aufwachte, musste ich aufgrund einer verkühlten Blase so dringend auf Toilette, dass ich versehentlich keine Schuhe anzog und stattdessen barfuß schlaftrunken zum Badezimmer lief. Auf meinem Rückweg spürte ich den klebrigen Untergrund und den körnigen Schmutz, der sich auf meiner gesamten Fußfläche festsetzte. Ausgerechnet jetzt konnte ich mich nicht erinnern, welcher mein Schlafsaal war. Also ging ich in irgendeinen Schlafsaal hinein und gleich wieder heraus. Und in den nächsten hinein. Es war so dunkel. Wo verdammt nochmal war mein Bett? Ich stand etwa drei Minuten vor einer Schlafstelle, unsicher, ob darin jemand liegen würde. Doch Stück für Stück gewöhnten sich meine Augen wieder an die Dunkelheit, und ich tastete mich vorsichtig heran. Es war zum Glück mein Bett, in dem ich aber nicht mehr lange verbringen wollte, weil es so extrem unbequem war.
Um 5 Uhr stand ich schon wieder auf und tippte Mr. Weinflasche, der im Doppelstockbett über mir lag, an die Schulter. Ich fragte ihn flüsternd, ob er mit mir aufbrechen wolle, da es hier so furchtbar sei. Als er erfuhr, wie spät es war, antwortete er aber nur etwas empört „Nein“ und drehte sich um. Also zog ich trotz strömendem Regen allein los.
Die ersten Sonnenstrahlen durfte ich erst am nächsten Tag genießen. Sie waren eine Wohltat. Entspannung setzte aber nicht ein, da ich immer noch einen straffen Zeitplan im Nacken hatte.
Eines Abends fragte mich jemand in der Herberge, wohin ich morgen gehen würde. Ich bezog diese Frage zunächst auf die Distanz. Das war aber nicht gemeint. Es ging auch um keine hübsche Tagesalternative. Es ging um einen anderen Weg. Ein anderer Weg? Ich wollte Richtung Santiago und nicht auf irgendeinem anderen Weg weiterlaufen. Aber auch darum ging es nicht, sondern darum, ob ich dem Camino del Norte weiter folgen würde oder die Pilgerschaft auf dem Primitivo fortsetzen wolle. Von diesem Weg hatte ich noch nie etwas gehört, daher war das keine ernsthafte Option für mich.
Am nächsten Tag, mitten in einem kleinen Dorf gabelte sich auf der Hauptstraße tatsächlich der Weg. Große Pfeile wiesen nach links, auf den Primitivo, der vom Meer wegführte. Geradeaus ging es weiter auf dem Norte. Mein Weg stand fest. Mein Buch gab nur Auskunft über Strecke und Unterkünfte des Küstenweges. Und trotz allem Stress wollte ich auch nicht vorzeitig das Meer verlassen.
Etwa 25 Kilometer vor Gijón hatte ich an diesem Tag entschieden, meine erste 40-Kilometer-Strecke zu laufen, um die in den Anfangswochen zu wenig gelaufenen Kilometer aufzuholen. Dadurch ließ ich auch die junge Jessi und den sportlichen Nils hinter mir, die meinten, jetzt sei ich total verrückt geworden.
Mein Schritttempo war in den kommenden Tagen nicht mehr das Problem. Nicht mal das hässliche Industriegebiet zwischen Gijón und Avilés konnte meine Motivation mildern. Aber das Laufen auf dem Seitenstreifen einer viel befahrenen Straße zehrte an meinen Nerven. Die vorbeirauschenden Lkws machten mir Angst. Ich klammerte mich immer wieder an die Leitplanke, um nicht im Sog des Fahrtwindes mitgerissen zu werden. Das war kein entspanntes Pilgern, sondern Überlebenstraining.
In Kantabrien und Asturien setzten mir zunehmend die viel befahrene Küstenstraße und die häufigen Asphaltstrecken zu. Die Aussicht war zugleich immer wieder überwältigend. Wunderschöne Strände und hohe Wellen lockten vor allem Surfer, da es zum Baden zu kalt und aufgrund der Strömung teilweise gefährlich war. Die Naturgewalten des Ozeans waren beeindruckend.
—
Als sich die Entdeckung des Grabes von Jakobus vor 1.200 Jahren über Europa verbreitete, war der Großteil der Iberischen Halbinsel von Muslimen besetzt. Daher waren die Pilger gezwungen, den anstrengenden Weg entlang der Nordküste zu nehmen. Als es infolge der christlichen Rückeroberung einfachere Wegmöglichkeiten gab, verlor dieser Streckenverlauf an Bedeutung. Aufgrund des Pilgerbooms der vergangenen 40 Jahre wurde der Küstenweg Stück für Stück wieder beliebter.
—
Ich hatte immer nur die Zahl sechs Prozent im Kopf. Und den täglichen Bettenmangel vor Augen. Wie mag es dann auf dem Hauptweg, dem Camino Francés, den 60 Prozent der Pilger laufen, wohl sein? Dass dieser in etwa 100 Kilometer Entfernung parallel verlaufende Weg sich aber mit seiner Infrastruktur entsprechend darauf eingestellt hatte, während der Küstenweg bezüglich der Herbergsdichte noch in einen Dornröschenschlaf versetzt war, wusste ich nicht. Wie ich später erfuhr, wechselten einige Pilger daher zum populären Inlandsweg.
Ich blieb dem Norte treu und nutzte die verschiedenen kleinen Wegführungen entlang der Küste, um ein Maximum an Naturerlebnissen zu genießen. Auch wenn Genuss angesichts meines sportlichen Zeitplans wohl die falsche Bezeichnung war.
Die kleinen Umwege hatten den Vorteil, dass ich auf vielen Wegabschnitten fast allein unterwegs war. Dies änderte aber nichts daran, dass abends in den Herbergen wieder „Completo“ verkündet wurde.
Ich lief Tag für Tag am Meer entlang. Aber zum Baden war keine Zeit. Außerdem gab es an der schroffen Steilküste wenige Möglichkeiten. Und ich hatte in meinem Pilgerführer gelesen, dass durch Baden die Füße aufweichen, was die Blasenbildung befördern würde. Und ein weiteres körperliches Leiden konnte ich mir wirklich nicht erlauben. Inzwischen hatte ich nämlich auch noch eine Sehnenscheidenentzündung im Bereich des Handgelenks, bedingt durch das stundenlange Festhalten meines Wanderstockes.
Die Sonne brannte, das Meer glitzerte, die Wellen rauschten. Nein, das konnte ich nicht ignorieren. Ich verweilte ausnahmsweise für ein paar Minuten an einem Badestrand und hüpfte vergnügt den Wellen entgegen. Das kurze Vergnügen war so erfrischend, für Körper und Seele. Ein Herbergsbett würde ich aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit sowieso nicht mehr bekommen. Aber ein Zimmerchen in einer Pension hatte sich immer gefunden. Zwei Stunden später hatte ich bereits zum vierten Mal das Wort „Completo“ gehört. Im Umkreis von 15 Kilometern gäbe es kein Bett mehr, so ein österreichischer Pilger, der auf seinem Smartphone herumspielte. Ein teures Vier-Sterne-Hotel war die letzte Rettung. In der Tat war das Hotel noch nicht ausgebucht. Und aufs Geld sollte es jetzt nicht ankommen.
Es gab nur noch ein Zimmer. Aber wir waren zwei Pilger. Da das Bett groß war, schwatzte uns die Rezeption das Zimmer zusammen auf. Ich kannte den Mann nicht, aber was blieb mir anderes übrig.
Das Zimmer war wirklich schick. Der etwa 50-jährige Künstler breitete sich selbstbewusst aus. Leider auch im Bett. Er hatte kein Schamgefühl und begann seine Fußnägel zu schneiden. Ein Würgereiz breitete sich in meiner Kehle aus. An kollektives Zähneputzen hatte ich mich gewöhnt, aber fremde Fußnägel überschritten meine Ekelgrenze. Er bemerkte meine Verwunderung, nahm dies aber nicht zum Anlass, sich ins Badezimmer zurückzuziehen, sondern einen Vortrag über Fußhygiene zu halten. Genau das hatte ich jetzt noch gebraucht.
Der Mann hatte auch nachts kein Gefühl für Grenzen. Schräg lag er im Bett, welches nur eine Breite von 1,50 Meter hatte. An den Bettrand gedrängt konnte ich dieses luxuriöse Zimmer nicht genießen. Und dann auch noch der Krach, der durch die Wände drang. Wir waren in einem Seitenflügel des Hotels untergebracht, neben uns eine feierwütige Gruppe von Spaniern.
Irgendwie schaffte ich es doch noch einzuschlafen. Und als ich wenig später wieder aufwachte, hatte ich das Bett für mich allein. Ich freute mich schon, dass der Typ verschwunden war. Manche Pilger sind krass drauf und laufen nachts. Warum nicht auch er.
Ich schlurfte Richtung Toilette und erschrak mich gewaltig. Denn er lag samt Bettzeug in der Badewanne. Er hatte sich dort einquartiert, da das Badezimmer weniger stark vom nächtlichen Partylärm betroffen war. Doch wo sollte ich jetzt auf Toilette gehen? Drei Stunden später war das Badezimmer endlich wieder frei.
Was für eine furchtbare Nacht. Die nächsten Nächte bekam ich wieder ein eigenes Bett, und auch der Gang zur Toilette war jederzeit möglich. Ein Stressfaktor blieb die Frage der Unterkunft aber weiterhin.
Mein Pilgerausweis füllte sich wie ein Tagebuch mit Stempeln. Jeder Stempel erzählte eine andere leidvolle Geschichte. Der Urlaub war abenteuerlich, aber in anderer Hinsicht als erhofft. Der Camino gab mir nicht das, was ich wollte, sondern was ich brauchte. Leider war das eins auf die Fresse.