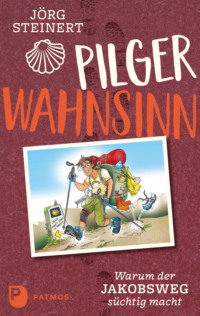Kitabı oku: «Pilgerwahnsinn», sayfa 3
Schnauze voll, ich breche ab
Zwischen 13 und 15 Uhr war für die meisten Pilger Schluss. Sie kehrten in der Herberge ein. Die Spanier hielten einen traditionellen Mittagsschlaf. Andere Pilger lagen in der Wiese oder saßen im Café. Doch mir war das zu langweilig. In den meisten Orten gab es außer der Herberge und einer Kneipe nichts. Das Meer war meist zu weit entfernt, als dass man abends einfach so mal hätte schwimmen gehen können. Auch hatte ich um 15 Uhr mein Tagessoll von 35 Kilometern noch nicht geschafft. Für mich war gegen 17 oder 18 Uhr die perfekte Einkehrzeit: Es bestand noch genug Zeit zum Wäschewaschen, Duschen und Abendessen, ohne dass Langeweile aufkam.
An diesem Abend, es war inzwischen nach 19 Uhr, stand ich verzweifelt in einer Apotheke. Nein, ich wollte keine Medikamente oder Bandagen. Mir ging es inzwischen körperlich wieder gut. Die beiden Mitarbeiterinnen telefonierten fürsorglich das halbe Dorf ab, um mir einen Schlafplatz zu organisieren. Zuvor hatte ich mir in der Herberge anhören müssen, ich könne doch unter dem Vordach der Schule schlafen, auf dem Betonboden. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Das Wort „Completo“ konnte ich nicht mehr hören. Obwohl ich immer sehr früh aufstand und wenig Pausen machte: Der Bettenmangel war zu extrem. Ich wollte einfach nur ein Bett oder ein Sofa, egal, Hauptsache nicht den nackten Boden draußen, wo ich der nächtlichen Nässe und Kälte ausgesetzt wäre. Die nette Apothekerin gab mir zu verstehen, dass es wirklich gar nichts mehr im Dorf gab, sie mir aber ein Bett in zehn Kilometern Entfernung reserviert habe. Also nahm ich die Füße in die Hand, da es schon langsam dunkel wurde.
Auf dem Acker außerhalb des Dorfes schlug ein anderer Pilger gerade sein Zelt auf und umringte dieses freudig mit einer Flasche Wein in der Hand. Ich griff zum Mobiltelefon und rief meine Eltern an. Meine Mutter war dran. Ich dachte, ich würde sie überraschen, indem ich ihr verkünde, dass Schluss sei mit dem Pilgern. Aber sie war vielmehr überrascht, dass ich nicht schon eher abgebrochen hatte. Massenschlafsäle und ihren Sohn, der sich als Kind gern allein in sein Kinderzimmer zurückzog und sich auch als Erwachsener noch vor vielen Dingen ekelte, konnte sie einfach nicht zusammenbringen.
Ich hatte beschlossen, noch etwas Strandurlaub in Sitges bei Barcelona zu machen. Doch in Geographie war ich noch nie gut. Meine Mutter teilte mir nach einer kurzen Recherche mit, dass das über 900 Kilometer entfernt sei. Zudem war mein Rückflug ab Santiago schon gebucht. Ich verwarf daher erst einmal diese Alternative. Irgendeinen schönen Badeort zum Verweilen würden es wohl auch an der nordspanischen Atlantikküste geben.
Ich wollte mich nicht mehr sorgen, ob ich nachts einen Schlafplatz haben würde. Daher konnte ich meine Reise definitiv nicht in der bisherigen Art und Weise fortsetzen.
Ich schwitzte aus allen Poren. Nicht nur unter den Armen, am Rücken und auf der Stirn. Wirklich überall schoss der Schweiß aus mir. Ich war einfach fertig.
Nachdem ich auch die letzten zehn Kilometer gemeistert hatte, kam ich in einem sehr schicken Hotel an. Und hier sollte ich für kleines Geld von 25 Euro schlafen können? Fast, von hier wurde ich in ein nahegelegenes Gewerbegebiet gefahren. Die große Wohnung hatte viele kleine Zimmer. Ich hatte freie Wahl. Meine nächtlichen Mitbewohner lernte ich nicht kennen, da ich mich in einem Zimmer verbarrikadierte. Ich hörte nur, wie einer nach dem anderen nachts abgeliefert wurde. Aber wo war ich hier eigentlich gestrandet? Auf dem Jakobsweg war ich nicht mehr.
Am nächsten Morgen lief ich zurück zur Küste, wo ich in einem Fischerdorf wieder auf den Jakobsweg traf. Ich steuerte zielgenau auf den Busbahnhof zu, ein absolutes Tabu auf meinem bisherigen Weg. Während der nächsten 30 Minuten schaute ich mitleidig auf die Pilger, die sich entlang der Küstenstraße quälten. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Jetzt war ich also auch einer dieser Busreisenden. Nein, ich war sogar ein Abbrecher, einer, der auf dem Weg gescheitert war.
Mein Zielort war ein touristischer Ort mit Badestrand. Hier plante ich die nächsten anderthalb Wochen zu verbringen. Doch wollte ich 200 Kilometer vor dem Ziel wirklich abbrechen? Nein, wollte ich nicht. Aber auch keinen weiteren Stress. Warum das Kind mit dem Bade ausschütten? Zweifel waren okay. Aber Zweifel an der Art meiner Pilgerschaft, nicht am Pilgern an sich. Und ich war noch nie ein Mensch, der Dinge aufgab, nur weil es Probleme gab.
Die Pflicht, Santiago zu Fuß zu erreichen, schlug ich mir aus dem Kopf. Was gestern war, war egal. Was in drei Tagen sein würde, war auch nicht bedeutsam. Das Heute zählte, der Moment. Befreit von Sorgen der vergangenen Tage und den Befürchtungen der Zukunft leerte sich mein seelischer Rucksack. Das zwischenzeitliche Scheitern gab mir die Möglichkeit, neu zu starten. Ich lernte, dass manchmal auch selbst auferlegte Zwänge einfach beiseitegeschoben werden müssen.
Am nächsten Tag lief ich nur zwölf Kilometer bis Ribadeo. Ich nahm mir für den kurzen Weg Zeit. Gegen 13 Uhr hörte ich schon wieder „Completo“ in der Herberge. Wie absurd. Wie früh sollte ich denn noch ankommen, um ein Bett zu bekommen?
Ich wollte dieses verhasste spanische Wort kein einziges Mal mehr hören, daher ging ich zur Touristeninformation, um eine Auskunft darüber zu bekommen, wo etwas frei wäre. Doch die Siesta-Zeit ist den Spaniern heilig. Ich eilte durch die Eingangstür und wurde – ebenso wie andere Pilger – wieder nach draußen gebeten, weil ab sofort Mittagspause sei. Ab 17 Uhr könnten wir wieder nachfragen. Ich sah vor meinem geistigen Auge, wie alle Zimmer der Stadt bis dahin wieder vergeben sein würden. Ich wollte einfach nur eine Hotelliste. Aber die Mitarbeiterin motzte mich an, da sie Hunger hatte und jetzt Mittagessen wollte. Ich war jedoch nur an einem Schlafplatz interessiert. Ich verlor das Wortgefecht, stürmte wütend aus der Touristeninfo und rannte in ein Fahrrad. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Auf einmal stand die Mitarbeiterin hinter mir, nickte mir mürrisch zu, ich folgte ihr und sie half mir doch weiter.
Inzwischen hatte mich meine Freundin Katja angerufen, die auf dem Weg nicht zurechtkam. Ich besorgte uns daher ein schnuckeliges Doppelzimmer.
Katja war etwa 100 Kilometer hinter mir. Wir waren schon seit 14 Jahren befreundet und kannten uns vom Studium. Sie war der Typ Mensch, der immer Selbstbewusstsein und gute Laune ausstrahlt. Aber jetzt ging es ihr nicht gut.
Ich hatte Katja eine Woche zuvor auf dem Weg getroffen. Da sie sehr langsam unterwegs war, hatte wir nur einen gemeinsamen Abend. Ich wollte sie und Mr. Weinflasche verkuppeln, was aus ihrer Sicht aber vollkommen absurd war. Kurz danach kam mir Mr. Weinflasche abhanden.
Ich freute mich, als Katja in Ribadeo mit dem Bus ankam. Und zugleich war klar, dass sie sich den Bettenmangel nicht antun wollte, dem man in den kommenden Tagen ausgesetzt wäre. Und während ich Santiago wieder fest im Blick hatte, schickte ich meine Freundin am nächsten Morgen mit dem Bus zurück nach Irun, damit sie das Baskenland, das sie noch nicht kannte, wie ich lieben lernen konnte. Ich war mir sicher – und hatte damit recht –, dass in dieser großen Entfernung zu Santiago die Unterkunftssituation wieder entspannter sei. Und Katja folgte diesem Rat. Sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich einließ. Aber es sollte ihr Leben verändern.
Wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen
Katja schlummerte noch, als ich meine Sachen zusammenpackte. Es war so schön mit ihr. Und zugleich war es für uns beide genau richtig, unseren jeweils eigenen Weg zu gehen.
Zudem musste ich mich auch noch vom Meer verabschieden, einem der wenigen Dinge, die mir auf dieser Leidensreise Kraft gaben. Bei Ribadeo verließ der Weg das Meer Richtung Landesinnere.
Da ich gelernt hatte, wie wichtig es ist, im eigenen Tempo unterwegs zu sein, lief ich gemütlich los. Ohne Stress. Ich konnte die Umgebung mit ihren verzauberten kleinen Dörfern und der bodenständigen Ursprünglichkeit richtig genießen. Ich hatte nach all diesen Rückschlägen tatsächlich weitergemacht und mich aus dem selbst geschaffenen Hamsterrad befreit.
Bereits gegen Mittag kam ich bei einer Herberge auf Spendenbasis an. Ich war der erste Pilger. Ich fand eine Kasse des Vertrauens und menschenleere Schlafräume vor. Ich grübelte, ob ich weiterlaufen oder hierbleiben solle? Doch ich wollte keine weiteren Risiken mehr eingehen und blieb.
Während ich meine Wäsche stundenlang im Wind beobachtete, wurde mir klar, dass alle Alltagssorgen wie weggeblasen waren. Ich grübelte nicht über Luxusprobleme in Berlin. Hier war ich froh, wenn meine Grundbedürfnisse Essen, Trinken und Schlafen befriedigt wurden.
Immer wieder kamen Pilger vorbei, die sich die gammelige Herberge anschauten und schließlich doch weiterzogen.
Eine schlichte Bar war in direkter Nähe. Die kulinarische Verköstigung war eine Katastrophe. Es gab Bocadillos, also Sandwiches aus trockenem Baguette. Dazu ein gekühltes Wasser. Wasser und Brot sowohl zum Mittagessen als auch Abendessen fühlte sich wie Knastfraß an. Keine Früchte, kein Dessert, nichts Warmes.
Inzwischen waren auch andere Pilger eingekehrt. Es waren junge Spanier, deren Geräuschempfinden mal wieder nicht dem meinen entsprach. Es gab zwei große Schlafsäle und ein kleines Schlafzimmer mit nur einem Doppelstockbett. Ich hatte mich auf beiden Etagen des Doppelstockbettes ausgebreitet, um den Eindruck zu erwecken, dass der kleine Raum komplett belegt sei. Ich wollte mit keinem dieser lautstarken Menschen den Schlafraum teilen.
Zum Abend wurde die Herberge immer voller und ich wusste, dass jedes Bett gebraucht wurde. Daher entschied ich mich, die ankommenden Pilger genau zu scannen und einem ruhig wirkenden Pilger das Bett über mir anzubieten. Die Wahl fiel auf Matteo, einen Italiener mit schwedischen Wurzeln.
Wir verstanden uns auf Anhieb gut und klagten uns unser Leid. Matteo hatte ein Zelt dabei. Das zusätzliche Gewicht machte ihm zu schaffen, weshalb er sich davon trennen wollte. Drei Tage zuvor hatte ihn das Zelt aber gerettet. Während ein anderer Pilger abends an ihm vorbeieilte und er es total verrückt fand, dass jemand gegen 20 Uhr noch ein Dorf verlässt, hatte er mit Genehmigung eines Bauern sein Quartier auf dem Acker aufgeschlagen. Als ich ihm erzählte, dass ich dieser Verrückte war, musste er lachen. Uns beiden war dieser Moment eindringlich in Erinnerung geblieben.
Ich mochte Matteo sehr. Aber wichtiger als neue Bekanntschaften war mir die Gewissheit, ein Bett zu finden. Am nächsten Morgen brach ich – mit Stirnlampe auf dem Kopf – vor Sonnenaufgang im Dunkeln auf. Ich kam nicht weit, denn auf einem Feldweg versperrten mir zwei aggressive Hunde den Weg.
Ich wusste, dass ein Biss ausreichen konnte, das Ende meiner Reise zu besiegeln. Und ich konnte die Hunde auch nicht erkennen. Waren es kleine Tölen mit großer Schnauze oder ernstzunehmende Gefahrenquellen? Ich vernahm nur ihr Knurren und Bellen. Ihre Augen reflektierten das Licht meiner Stirnlampe. Jeden Schritt, den ich rückwärts machte, folgten sie mir. Die Tiere bewegten sich immer am Rande des Lichtkegels meiner Lampe. Lockte meine Lampe sie an oder hielt sie sie ab? Ich wollte es nicht testen. Also gab ich mich geschlagen und nahm im Dunkeln entlang der Dorfstraße einen riesigen Umweg in Kauf. Es wäre mir peinlich gewesen, in die Herberge zurückzukehren. Aber gebissen werden wollte ich auch nicht.
Über eine Stunde später war ich endlich wieder auf dem Weg. Der liebgewonnene gelbe Pfeil half mir bei der Orientierung. Wenig später holte mich Matteo ein, der sich wunderte, dass mein Vorsprung nicht größer war, obwohl ich so früh aufgebrochen bin. Meine Geschichte von den aggressiven Hunden amüsierte ihn. Er fand sie nicht dramatisch genug. Mit einem breiten Grinsen fragte ich mich kokettierend, ob es nicht eventuell doch ein Rudel Wölfe gewesen sei. Denn ein mutiger Pilger wie ich würde sich doch nicht von Dorfkötern einschüchtern lassen. Ja, vielleicht waren es doch ein Dutzend Wölfe, denen ich mich heldenhaft gestellt hatte …
Bei jedem Dorfhund, der uns mit wedelndem Schwanz entgegenkam, rief Matteo: „Vorsicht, ein Wolf!“ Er liebte es, mich aufzuziehen.
Matteo hatte eine rege Fantasie. Wir malten uns aus, wie wir die Pilger hinter uns in die Irre führen könnten, damit sie uns später kein Bett wegnehmen. Ein anderes Mal stellten wir uns angesichts zahlreicher humpelnder und verletzter Pilger vor, dass es eigentlich Zombies wären, die man töten müsse. Unser Humor passte gut zueinander. Beim nächsten „Completo“ wollte ich zudem einen Aufstand der Pilger anführen. Alle Türen, egal wie voll das jeweilige Haus auch sei, sollten uns offenstehen. Wir waren nicht irgendwelche Touristen. Wir waren Pilger, denen Hilfe zuteilwerden musste. Ich war erstmals in meinem Leben in Revolutionslaune.
Zum Glück hörte uns niemand zu. Er oder sie hätte uns in eine Psychiatrie für gewalttätige Verbrecher einliefern lassen. Aber wir waren körperlich am Ende. Unsere Fantasie lenkte uns von den körperlichen Leiden ab. Und wir kamen in der Tat zügig voran. Eines Tages schafften wir sogar 40 Kilometer, ohne dass es anstrengend war. Es machte einfach Spaß mit Matteo.
Ab und zu bremste mein neuer Pilgerfreund und stocherte mit seinem Stock im Boden herum. Er sammelte tatsächlich Steine. War sein Rucksack nicht schon schwer genug? Der romantische Italiener sammelte Steine in Herzform, um sie als Andenken zu behalten oder einer lieben Person in der Heimat zu schenken.
Einer von Matteos Steinen war ganz gewiss für eine Person auf dem Weg bestimmt: Leticia. Ich kannte sie nur aus Matteos Erzählungen. Er hatte sie am Anfang seines Weges kennen und lieben gelernt. Sie musste ihren Weg nach zwei Wochen unterbrechen, um ihrer Arbeit in Madrid nachzugehen. Doch auch sie hatte sich in Matteo verliebt und wollte für die letzten Kilometer zurückkehren.
Ich hatte davon gehört, dass sich lange Zeit insbesondere Südamerikanerinnen auf den Jakobsweg begaben, um einen passenden Partner zu finden. Ob solche vermeintlichen Erwartungshaltungen mit späterem Glück verbunden waren, entzog sich meiner Kenntnis. Aber ich bemerkte, dass sich die Menschen hier gut kennenlernen konnten. Wenn du hier mit dem Gegenüber klarkommst, den Tag und die Nacht gemeinsam verbringst, körperliche Strapazen meisterst und trotz aller zutage tretenden Unzulänglichkeiten den anderen immer noch ansprechend, interessant und vielleicht sogar attraktiv findest, dann muss es wirklich Liebe oder echte Freundschaft sein.
Und so wie Matteo, der auf dem Camino del Norte seine Liebe fand, mit der er vielleicht sogar den Rest seines Lebens verbringen würde, erging es auch anderen.
Da das Durchschnittsalter in den Sommermonaten sehr niedrig war und die Fraktion der 20-Jährigen die größte Gruppe ausmachte, war das Schaulaufen zugleich enorm. Junge testosterongesteuerte Männer versuchten, junge Frauen zu beeindrucken, die wiederum kindlich kicherten.
Meine Freundin Katja hingegen suchte gar niemanden. Weder neue Freunde noch einen Partner. Sie war zufrieden. Und im Gegensatz zu meinen 35-Kilometer-Mammutmärschen legte sie zum Teil nur fünf Kilometer am Tag zurück und schlug dann wieder ihr Zelt auf. Während mein Ziel mit Santiago feststand, hatte sich in der ansonsten so entspannten Katja eine unerwartete Orientierungslosigkeit breitgemacht. In Ribadeo hatte ich ihr zum Glück den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Sie genoss den Weg im Baskenland tatsächlich sehr. Hier lernte sie den charmanten Spanier Jorge kennen, einen Ladenbesitzer aus der Region Rioja, der auch als Pilger unterwegs war.
Doch nicht alles auf dem Jakobsweg entwickelte sich wie im Märchen. Während der Pilgerschaft zeigte sich ziemlich deutlich, wenn Paare nicht zueinander passten. Während sie sich im Alltag durch Beruf oder Studium gut aus dem Weg gehen konnten, hatten sie den jeweils anderen auf dem Jakobsweg Tag und Nacht um sich. Ich bemitleidete daher im Stillen einen deutschen Pilger, der von seiner Freundin durch die Gegend gescheucht wurde. Wenn man ihn etwas fragte, nahm sie ihm sogar das Antworten ab. Während ich mir dieses Trauerspiel ansehen musste, war ich erstmals seit langem froh, nicht in einer Beziehung zu sein.
Mein Geschenk war keine neue Partnerschaft, aber die Freundschaft mit Matteo. Es stimmte, dass ich allein gehen musste, um schnell zu sein. Aber um weit zu kommen, musste ich jemand finden, der den Weg mit mir zusammen geht.
Ich hatte Herausforderungen gemeistert, war Unvorhergesehenem begegnet, erlebte Verwundung und Heilung, musste mich um Essen, Trinken und einen Schlafplatz bemühen und durfte Gastfreundschaft erleben. Ich stellte auf ganz einfache Weise fest, wie wenig ich zu einem zufriedenen Leben brauche. Doch war ich wirklich ein Pilger? Oder nur ein Wanderer auf einem geistlichen Weg?
Wie katholisch ist der Jakobsweg?
Es gefiel mir gut, auf dem Weg auf so viele Kirchenkritiker zu stoßen. Und eine spanische Pilgerin bestätigte mit ihrer Geschichte meine Sicht von der katholischen Kirche. Auf einer früheren Pilgerreise fand sie bei einem Gewitter keine Bleibe. Angekommen bei einer Kirche wendete sie sich an den dortigen Priester, der ihr spirituelle Unterstützung anbot, aber einen Schlafplatz – und sei es nur die kalte, aber trockene Kirchenbank – versagte. Laut ihrer Schilderung versuchte sie dem Priester zu verdeutlichen, dass sie kein spirituelles Problem habe, sondern ein ganz weltliches, da draußen das schlechte Wetter tobte. Aber sie fand kein Gehör und musste außerhalb von Kirche und Pfarrhaus nächtigen.
Etwa eine Woche nachdem ich die Geschichte gehörte hatte, lief ich mit Matteo durch das verregnete Galicien. Die Region machte ihrem Ruf alle Ehre. Irgendwie hatte ich immer „gallisch“ statt „galicisch“ im Kopf. Ebenso wie das Land von Asterix und Obelix, die natürlich keine Spanier, sondern Franzosen waren, hatte sich diese einfache Region ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Und sogar das Wetter trotzte dem Klimawandel. Während in Deutschland sommerliche 40 Grad herrschten, hatten wir hier gerade einmal 16 Grad und Dauerregen.
Da Matteo keinen Poncho besaß, trug er fast den ganzen Tag einen Schirm. Beide Hände waren von der Kälte schon blau angelaufen. Doch die Rettung nahte. Das alte Kloster von Sobrado dos Monxes sollte uns Schutz und eine erholsame Nacht bieten. Hier wollten sich auch Matteo und Leticia wiedersehen, um in den nächsten Tagen gemeinsam in Santiago einzulaufen.
Zunächst stießen wir auf verschlossene Tore. In unserem Schlepptau befand sich das junge Paar mit der schikanösen Frau. Wir alle waren pitschpatschnass, erschöpft und zu keinem weiteren Schritt in der Lage. Das änderte aber nichts an den Einlasszeiten. Die Mittagsöffnungszeit hatten wir um eine halbe Stunde verpasst. Die Tore sollten sich erst in drei Stunden wieder öffnen. Für diese Regel hatte ich kein Verständnis. In drei Stunden hätte ich mir eine fette Erkältung eingefangen. Also wummerte ich mit der geballten Faust gegen das Tor. Matteo und die anderen beiden Pilger winkten ab. Ich wollte mich nicht geschlagen geben. Nach ein paar Minuten tat ich es doch.
Verzweifelt saß ich am Boden, als sich die Eingangspforte öffnete. Aber nicht, um uns hereinzubitten, sondern um Besucher herauszulassen. Während die anderen Pilger die Situation als gegeben akzeptierten, eilte ich zum Mönch, der mich grimmig anschaute. Das Argument, dass uns kalt sei, konnte sein Herz nicht erweichen. Er war schon dabei, die Tür wieder zu schließen, als ich ihm verzweifelt zurief, dass wir doch nicht mehr als vier Pilger seien. Er warf einen prüfenden Blick um die Ecke, der ihm bestätigte, dass außer mir tatsächlich nur drei weitere Personen anwesend waren. Er willigte also ein.
Während wir dankbar durch das Einlasstor gingen, merkte der Mönch leise und schuldbewusst an, dass dies gegen die Regeln des Klosters sei. Um anschließend mit einem Schmunzeln zu ergänzen, dass es manchmal notwendig ist, die Regeln zu brechen.
Mit der katholischen Kirche hatte ich noch nie viel am Hut. Als Jugendlicher spottete ich über Papst Johannes Paul II. Und anlässlich des Deutschlandbesuchs von Papst Benedikt XVI. war ich für ein halbes Jahr lang Sprecher eines Protestbündnisses, welches die „menschenfeindliche Geschlechter- und Sexualpolitik des Papstes“ kritisierte. Und nun pilgerte ich auf einem katholischen Weg und bekam in einem Kloster Unterschlupf.
Mit gläubigen Menschen hatte ich weniger Probleme, da die meisten Katholiken die Lehren der eigenen Kirche zu Sexualmoral und Frauenrechten seit Jahrzehnten zunehmend kritisch sehen. Aber die Institution Kirche stellte ich bei allen Handlungen stets infrage, ihre Absichten und Motive sowie ihr Machtstreben und ihr Geltungsbedürfnis. Selbst karitative Einrichtungen sah ich mit Skepsis.
Und nun zeigten mir eine milde Geste und ein kurzes menschliches Schmunzeln, dass auch ich zu mehr Differenzierung in der Lage sein sollte. Mein Ex-Freund, ein Ex-Katholik, sah in solch emotionalen Momenten meinerseits eine intellektuelle Schwäche. Ich würde mich zu leicht einlullen lassen, so seine These.
Meine Sorge galt an diesem Nachmittag aber nicht meinen Wertvorstellungen, sondern wie ich meine Schuhe bis zum nächsten Tag wieder trocken bekommen würde. Der Handtrockner in den Wasch- und Toilettenräumen war dabei recht nützlich. Das fünfsekündige kurze Blasgeräusch ging mir zwar bereits nach ein paar Minuten gewaltig auf die Nerven. Aber tapfer stand ich etwa zwei Stunden an dem Gerät. Es heulte kurz auf und schon war es wieder aus. Wie verrückt wackelte ich permanent mit den Schuhen und den herausnehmbaren Schuhsohlen unter dem Sensor, bis das Gerät wieder ansprang.
Matteo kümmerte sich kaum um seine nassen Sachen. Er war zu aufgeregt wegen des Wiedersehens mit Leticia. Als sie später eintraf, wurden wir einander kurz vorgestellt. Aber dann waren die beiden mit sich als Paar beschäftigt.
In meiner Altersgruppe existierte einfach niemand. Sie waren verloren gegangen, hatten jemanden gefunden oder kümmerten sich in der Heimat um Karriere und Familie. Während der Handtrockner wieder kurz aufjaulte, stellte ich mir die Frage, was ich Mittedreißigjähriger hier zwischen Paaren, Studenten und Rentnern eigentlich wollte. Nein, nochmal dachte ich nicht über einen Abbruch nach. In Santiago wollte ich ankommen. Aber Erwartungen hatte ich ansonsten keine mehr an den Weg.
Inzwischen waren die Tore auch offiziell wieder geöffnet. Und die durchnässten Pilger strömten in Scharen in das alte ehrwürdige Kloster.
Ich schlenderte durch die Wandelgänge auf dem Weg zum Schlafraum, als mir aus einem Badezimmer eine Frau mit nassen Haaren und einem großen Handtuch um den Körper gewickelt fast schon kreischend zurief: „Jörg, Jörg, bist du es?“ Es war Jessi. Sie und Nils hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wie lang war es wohl her? „Bestimmt 100 Kilometer“, meinte ich gönnerhaft. Sie korrigierte mich: „Bestimmt mehr als 200.“ Tatsächlich hatten sich unsere Wege vor 300 Kilometern getrennt.
Jessi und Nils waren unter sich geblieben. Und ich war für sie offenbar gar keine so schlechte Pilgerbegegnung. Wir drei freuten uns sehr über das Wiedersehen. Ihre kühle norddeutsche Art hatte ich zuvor als nicht vorhandene Zugewandtheit interpretiert. Erst jetzt erkannte ich ihre Herzlichkeit. Sympathisch waren sie mir bereits vorher.
Beim gemeinsamen Abendessen entbrannte eine Diskussion darüber, ob und welche Pilgerurkunde wir uns in Santiago holen würden. Die lateinische Compostela für religiöses Pilgern, gewissermaßen das Original, wollte ich nicht nehmen. Das stieß auf großes Unverständnis, insbesondere bei Jessi. Ich sei doch den ganzen Weg gelaufen und könne stolz darauf sein. Aber für mich fühlte sich das nach einer Unterwerfung unter kirchliche Dogmen an. Daher wollte ich nur eine einfache „sportliche“ Urkunde.
Bereits der Reformator Martin Luther zweifelte die Echtheit der Grabesstätte von Jakobus an, weil dort eventuell nur die Gebeine eines toten Hundes liegen würden. Und ich wollte so oder so keinem Heiligen huldigen, weil ich an „Heiligkeit“ nicht glaubte, höchstens an „Scheinheiligkeit“.
Während die Menschen im Mittelalter aufbrachen, um ein Gelübde zu erfüllen, würden die wenigsten Pilger ihre Absichten heutzutage so beschreiben. Und doch vermutete ich bei nicht wenigen meiner Begleiter ein inneres Gespräch mit Gott. Ich hingegen schrie weder Richtung Himmel noch flüsterte ich in Gedanken mit ihm.
Auch wenn ich wochenlang auf einem katholischen Weg zum Grab des Apostels Jakobus lief, ich war mir ziemlich sicher, dass ich ohne religiöse Absichten hier war. Ich sah im Pilgern ein bloßes Ausbrechen aus dem Alltag. Bis aufs Kloster in Sobrado mied ich auf dem gesamten Weg religiöse Unterkünfte, obwohl ich aufgrund des Bettenmangels alles andere als wählerisch sein konnte. Ein Sturkopf war ich schon immer.
Als armselig empfand ich den Glauben, den die Menschen über Jahrhunderte der Kirche schenkten. Diese versprach ihnen, dass durch die Pilgerschaft nach Santiago ihre Sündenstrafen erlassen werden, um nach dem Tod dem Fegefeuer zu entgehen. Der kirchliche Missbrauch des menschlichen Glaubens widerte mich an. Die Drohkulisse des Fegefeuers erzeugte das Bild eines strafenden Gottes, den ich so nicht mochte.
Auch Jakobus war mir nicht sonderlich sympathisch, da er lange Zeit als Symbol der christlichen Rückeroberung der Iberischen Halbinsel herhalten musste und auf Kunstwerken häufig als Krieger mit Schwert in der Hand dargestellt wurde. Zugleich faszinierten mich die Legenden um den Apostel.
—
Jakobus der Ältere gehörte zu den ersten vier von Jesus berufenen Jüngern. Nach Christi Himmelfahrt soll er auf der Iberischen Halbinsel, der damaligen römischen Provinz Hispania beziehungsweise dem heutigen Spanien, erfolglos gepredigt haben. Er kehrte daher zu Lebzeiten nach Jerusalem zurück.
Im Jahr 44 während der Herrschaft von Herodes Agrippa I. wurde er als erster Apostel mit dem Schwert hingerichtet. Seine Jünger sollen seinen Leichnam nach der Enthauptung einem Schiff übergeben haben, das von einem Engel geleitet in Galicien ankam. Die Gebeine wurden schließlich von Helfern im Landesinneren beigesetzt. Dann geriet das Grab in Vergessenheit. Nach der Wiederentdeckung etwa 800 Jahre später wurde darüber eine kleine Kirche errichtet, um die herum sich Santiago de Compostela entwickelte.
Der Name Santiago de Compostela leitet sich von Santiago als Kurzform von Sankt Jakobus und Compostela als spanische Übersetzung von Sternenfeld ab. Nicht nur die Erzählung um die Entdeckung des Grabes durch Sternenschnuppen und andere Himmelserscheinungen, sondern auch die Behauptung, dass der Leichnam dort begraben worden ist, wird historisch angezweifelt. Doch auf Fakten waren Legenden noch nie angewiesen.
Am 25. Juli 816 wurde die damalige Kirche über der Grabstätte geweiht. Aus dem Kirchweihtag wurde später der Gedenktag an den heiligen Jakobus.
Im Jahr 997 wurden Santiago und dessen Kirche vom Heer des muslimischen Feldherrn Almansor zerstört. Aus Respekt blieb das Apostelgrab dabei aber unangetastet.
Um das Jahr 1075 wurde mit dem Bau der heutigen Kathedrale begonnen. Santiago entwickelte sich ab diesem Zeitpunkt neben Rom und Jerusalem zu der bedeutendsten Pilgerstätte des Christentums.
Seit Mitte des 15. Jahrhunderts wurde immer dann ein „Heiliges Compostelanisches Jahr“ ausgerufen, wenn der 25. Juli, der ursprüngliche Kirchweihtag, auf einen Sonntag fiel. In diesen Heiligen Jahren wird bis heute auch die Heilige Pforte der Kathedrale geöffnet und ein vollständiger Erlass von Sündenstrafen verkündet. In den Heiligen Jahren kann ein starker Anstieg der Pilgerzahlen vermerkt werden.
Schon im Mittelalter erlebte das Pilgern eine Kommerzialisierung, die bis heute anhält. Vermeintliche Reliquien wurden gehandelt, Pilgermuscheln als Beweis für die Pilgerschaft verkauft. Unterkünfte, Verpflegung und sonstige Dienste wurden seit jeher angeboten.
Nach dem Pilgerboom im Mittelalter gingen die Pilgerzahlen zunächst zurück. Einen großen Anteil daran hatte die Reformation ab dem 16. Jahrhundert. Martin Luther bezeichnete das Pilgern als „Narrenwerk“. Der Reformator wehrte sich gegen die von der Kirche propagierte Vorstellung, dass man Gott mit seiner Pilgerleistung gnädig stimmen müsse. Die Ansicht, man könne vor Gott gerechtfertigt sein, wenn man gute Werke tut, lehnte Luther ab und betonte die Rechtfertigung aus der Gnade Gottes im Glauben.
In Norwegen wurde das Pilgern von den herrschenden Protestanten ab 1537 sogar unter Todesstrafe verboten. Aber auch ohne Verbote war das Pilgern kein unbeschwerter Zeitvertreib. Für den Fußmarsch an den westlichen Rand Europas und zurück verging in der Regel ein ganzes Jahr. Viele Gläubige fielen dabei Krankheiten und Räubern zum Opfer.
Auch Seuchen waren wiederholt ein Problem. Im Jahr 1854 wurden aufgrund einer Cholera-Pandemie Feierlichkeiten und Menschenansammlungen in Santiago verboten. Doch die Pilgerbewegung erholte sich immer wieder von diesen Rückschlägen.
Im Jahr 1884 erklärte Papst Leo XIII. die Echtheit des Apostelgrabes und versuchte damit, Zweifel am Pilgerort ein für alle Mal zu zerstreuen.
Große Probleme gab es im 20. Jahrhundert. Die beiden Weltkriege, der spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur erschwerten eine Pilgerschaft erheblich. Der neuzeitliche Boom setzte erst wieder in den 1980er-Jahren durch die Besuche von Papst Johannes Paul II. in Santiago ein.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.