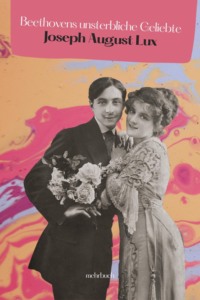Kitabı oku: «Beethovens unsterbliche Geliebte», sayfa 3
Die Töchter hatten auf alle Fragen abwechselnd nur mit einem einsilbigen: »Ja, Mama!« geantwortet oder mit einem ausweichenden Hinweis auf den Bruder Franz, der näheren Bescheid wisse; die Fragen hatten eine sehr einschläfernde Wirkung, nur die letzte Bemerkung über die Musikfeste machte alle lebendig und gesprächig.
»Aber Mama, das wäre herrlich! Wie kommst du nur plötzlich auf diesen Gedanken?!« rief Josephine fröhlich aus. »Und weißt du, Theresa, wen wir dann einladen?!«
Theresa beugte sich tiefer auf ihre Handarbeit und erwiderte nichts.
»Ach, wenn's nur mit meinem Klavierspiel besser ginge«, seufzte Josephine. Und dann rasch, wie von einer Erleuchtung betroffen: »Mama, mir fällt etwas ein! Du hast gesagt, ich darf mir zu meinem kommenden Namenstag in vierzehn Tagen etwas wünschen – ich weiß jetzt was! Wirst du ja sagen, Mama?«
»Wenn es nichts Unmögliches ist.«
»Es ist gar nichts Unmögliches! Es ist vielmehr etwas höchst Einfaches.«
»Nun, dann ist es schon gewährt.«
»Dank, Dank, liebe Mama!«
»Dürfen wir nicht wissen, was es ist«, fragte die Kusine Giulietta.
»Ja freilich, Kind, wie soll ich dir denn sonst deinen Wunsch erfüllen«, fügte Mama hinzu.
»Ach, den erfülle ich selber, nachdem ich nun einmal deine Erlaubnis habe,« lachte der Schelm, »aber ich will kein Geheimnis daraus machen: ich möchte bei Beethoven Klavierunterricht nehmen!«
Die Eröffnung war verblüffend.
Theresa ließ ihre Handarbeit fallen und sah die unternehmende Josephine fragend an: »Pepi, du bist aber eine!«
Josephine warf den Kopf auf: »Warum denn nicht? Du kannst ja mitkommen und auch Stunden nehmen, wenn du willst.«
Das war einleuchtend.
»Ich fürchte, er wird uns nicht nehmen«, meinte Theresa plötzlich zaghaft.
»Wir laden ihn einfach zu uns ein«, entschied die resolute Pepi. Darauf Theresa eifrig:
»Nein, das ist ganz vergebens; und wenn er nicht kommt? Dann haben wir das Spiel verloren. Er nimmt keine Einladungen an, wie ich gehört habe. Drum ist es am besten, wir gehen selbst zu ihm!«
»Du hast Courage, Theresa! Mehr wie ich!«
Mama geriet ganz außer sich.
»Aber, Kinder, Kinder, das geht ja nicht! So hab ich es nicht gemeint! Ich kann meine Erlaubnis unmöglich dazu geben. Wenn ihr de Olivera als Klavierlehrer haben wollt, meinetwegen, er gibt in aristokratischen Häusern Unterricht und ist ein Mann von guten Manieren.«
»Ach, Olivera ist nichts. Du hast übrigens dein Wort gegeben, Mama; und ich bleibe dabei: Beethoven und kein anderer!«
»Überdies, Mama, ist Erzherzog Rudolf Schüler Beethovens geworden«, warf Theresa ein. »Wo bleibt da Olivera in diesem Vergleich?«
Giulietta verfolgte mit wachsendem Interesse die Debatte. »Beethoven, sagt mir, wer ist denn das? Habe den Namen nie gehört.«
Gallenberg neigte sich zur schönen Kusine: »Komtesse, er verdient ihr Interesse gar nicht. Ein neuerer sehr häßlicher Musiker, der augenblicks in Wien von sich reden macht.«
»Oh, häßlich also ist er?« wandte sich Giulietta fragend an ihre Kusinen, »das interessiert mich aber. Wo kann man den Mann sehen?«
»Häßlich?!« riefen Theresa und Josephine jetzt wie aus einem Munde. »Nein – interessant ist er!«
»Die Häßlichkeit würde ich ihm gerne verzeihen,« sagte die alte Gräfin, »aber er ist anmaßend, arrogant, fast brutal und gewöhnlich. Ich finde ihn abstoßend. Er nennt sich ›van‹, ist er denn von Adel?«
»Er ist von Adel,« erklärte aufs entschiedenste Theresa, »ganz gewiß durch sein Genie.«
»Die Frau Gräfin hat recht,« zeterte jetzt Gallenberg, der etwas nervös geworden war, »er ist anmaßend, brutal, gewöhnlich. Das ›van‹ ist kein Adel.«
»Gallenberg!« sagte Giulietta leise und etwas irritiert, »unterdrücken Sie Ihre Beredsamkeit!« Eine verächtliche Handbewegung der ungnädigen Schönen, und er sank sofort seufzend auf seinem Stuhl zusammen.
»Wo habt ihr diesen – – Beethoven kennengelernt?« wollte Giulietta wissen.
Und nun ging es an ein lebhaftes Erzählen der Eindrücke vom letzten Freitagskonzert bei Lichnowsky, wobei Theresa und Josephine einander an begeisterten Schilderungen überboten.
»Ach schade, Giulietta, daß du nicht dabei warst! Wenn du ihn gesehen hättest, wenn er am Klavier spielt und phantasiert – das vergißt man nicht mehr!« Josephine begann zu schwärmen: »Was dann auf seinem Gesicht vorgeht, ist gar nicht zu beschreiben. Es ist wie ein prachtvolles Gewitter, ganz wie seine Musik; aber auch zum Fürchten. Ich habe förmlich Angst vor ihm! Ich glaube, er kann recht zornig und böse sein.«
»Nein,« entgegnete Theresa, »er ist herzensgut, ich weiß es. Das sagt schon sein idealer Blick!«
»Er hat dich auch lange genug angeschaut«, bemerkte Josephine, der Racker, und lachte dazu.
»Oh, im Gegenteil,« protestierte Theresa errötend, »ich habe immer nur bemerkt, daß er dich angeschaut hat, Josephine!«
»Nun, dann hat er halt uns alle zwei angeschaut«, gab Josephine zu.
»Shocking«, sagte die alte Gräfin und erhob sich. Die Jugend blieb allein im Zimmer.
»Ich möchte aber wissen, warum er euch nicht hätt' anschauen sollen,« wunderte sich Giulietta, »das ist doch ganz natürlich; ich wenigstens täte mich furchtbar ärgern, wenn er mich nicht anschauen würde!«
Gallenberg räusperte sich. »Hm!«
»Aber die Theresa hat er länger angeschaut als mich«, eiferte Josephine.
»Du beobachtest viel zu viel, Pepi!«
»Ihr habt ja auch geredet miteinander; darf man wissen, was?«
»Oh, das weiß ich selber nimmer!«
»Und was hat denn er gesagt?«
»Er? Ich glaube, er hat überhaupt nichts geredet. Er ist sehr wortkarg. Er war nur sehr ärgerlich über Haydn. Die Gräfin Thun hat's ihm ausreden wollen und hat's erst recht verdorben. Es war auch zu dumm!«
»So, was hat sie denn gesagt?« forschte Giulietta.
»Nun ungefähr, daß man seine Musik nicht versteht.«
»Da hat sie recht gehabt«, ließ sich Gallenberg wieder hören. Aber die energische Giulietta schnitt ihm ungeduldig das Wort ab:
»Gallenberg, schweigen Sie, wenn Sie reden wollen!«
»Gut, dann rede ich, wenn ich schweigen will!«
Die Hochblonde würdigte ihn überhaupt keiner Antwort mehr. »Aber sagt mir: ist er wirklich so häßlich? Wie sieht er denn eigentlich aus?«
»Von häßlich keine Spur. Eher schön, nicht wahr, Josephine?«
»Na ja – die Nase etwas verunglückt ...«
Dagegen Theresa: »Kann ich nicht finden. Ich könnte mir eine andere Nase in diesem Löwengesicht gar nicht denken – – Sie erinnert vielleicht etwas an Michelangelo – ich glaube, da liegt irgendeine Ähnlichkeit. Und die Stirn, diese gewaltige offene Stirn!«
»Du hast ihn dir aber gut angeschaut, Theresa.«
»Oh, gar nicht. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wie er aussieht. Ich habe nur so eine ungefähre Idee.«
»Groß, schlank?« fragte Giulietta.
»Klein, derb!« konnte sich Gallenberg nicht enthalten einzuwerfen.
Theresa mußte sich besinnen: »Klein? Bestimmt nicht. Imponierend. Riesenmäßig!«
»Wie interessant!« kam es von den Lippen Giuliettas. »Elegant, gut gekleidet?«
»Salopp, plebejisch, wie seine Manieren«, fuhr Gallenberg heraus.
Giulietta stampfte zornig mit dem Fuß: Gallenberg –!«
Und Josephine: »Er ist freilich in allen Stücken anders wie Sie, Graf!«
»Gott sei Dank!« rief Giulietta, »ich will es hoffen. Ihr macht mich furchtbar neugierig!«
Und Theresa ergänzte: »Er ist eben in allem bedeutend, originell und neuartig, ungewöhnlich. Ganz wie seine Musik. Drum hat er Gegner und Feinde.«
»Aber auch Freunde!« betonte Josephine.
»Ein Bär!« piepste der etwas verlebte Jüngling.
»Besser ein Bär als ein Stutzer«, gab Giulietta zurück. »Schade, daß ich ihn nicht kenne.«
Das eigensinnige Köpfchen, von der Prachtfülle des rotblonden Haares umwellt, warf sich zurück, eine verwegene Idee blitzte in dem pikanten Gesicht auf, darin allerhand Teufeleien ihr verführerisches Wesen trieben. Giulietta fühlte sich jederzeit zu verwegenen Schelmenstreichen aufgelegt; sie spielte gern mit dem Feuer und wußte ihre Koketterie in vollendete Unschuld zu kleiden. Nur einen Augenblick lang tauchte der lose Schalksgeist in dem Antlitz der reizenden jungen Hexe auf. Dann bezwang sie sich auch schon zu einer gut geheuchelten Unbefangenheit.
»Ach!« seufzte sie, »ich sollte auch eigentlich etwas tun für mein arg vernachlässigtes Klavierspiel. Es ist doch jammerschade darum!«
Gallenberg ergriff lebhaft die kostbare Gelegenheit: »Gräfin, bei Ihrem bewundernswerten Talent – ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich Ihnen dabei nützlich sein könnte – – –«
Giulietta lachte spöttisch und warf sich in den Sessel weit zurück, indem sie ihn durch die gesenkten Wimpern ziemlich hochmütig anblickte. Geringschätzung lag in ihrer Gebärde und in ihren Worten: »Sie wollen mir Unterricht geben, hahaha! Es klingt wirklich komisch. Ich fürchte außerdem, daß ich bei Ihnen gar nichts lernen würde – – Warum? Weil ich mir von Ihnen gar nichts sagen ließe und stolz auf meine alten Fehler wäre, nur um Sie zu ärgern.«
Der Gehänselte war jetzt gekränkt und schwieg. Das blasse faltige Gesicht nahm den Ausdruck eines ungezogenen, trotzenden Knäbleins an. Es rührte die Grausame nicht im mindesten; sie freute sich vielmehr, daß sie seine Eitelkeit verwundet hatte.
»Nein,« sagte Giulietta, »ich habe eine andere Idee. Wie wäre es, meine Geliebten, wenn ihr mich mitnehmen würdet zu Beethoven. Wenn wir zu dritt kommen und ihm recht schön tun, dann kann er nicht nein sagen. Und wenn es ihm zuviel ist, dann kann er ja wählen: eine von uns dreien!«
Jetzt war die Überraschung und Betretenheit auf Seite der Schwestern.
»Ja – wenn du glaubst«, sagte etwas gedehnt Josephine.
Und nach einer Pause Theresa:
»Übrigens: warum auch nicht? Wenn er uns nur nicht alle wegschickt.«
Giulietta lachte spitzbübisch auf: »Nun, nun, ich will euch nicht eifersüchtig machen.«
»O durchaus nicht«, sagten die beiden Schwestern etwas verlegen; »es steht ja jedem frei, ihn zu bitten – – wir haben nicht mehr Recht auf ihn als jede andere – –«
»Nein, nein, es war nur so eine Laune«, sagte Giulietta, die sich an der Verwirrung aller drei weidete. »Es ist besser, ihr geht allein. Ich habe mir's schon wieder anders überlegt!«
Der Graf hatte sich erhoben, um sich förmlich zu verabschieden. Zu Giulietta gewendet, sagte er: »Gräfin, wenn Sie den Rivalen vorziehen, dann werde ich ihn zum Duell herausfordern.«
Ganz bestürzt und erschrocken suchten die Schwestern den Grafen umzustimmen: »Wie, Sie wollen ihm ein Leid antun? Ja, warum denn eigentlich? Was hat er Ihnen denn getan? Weshalb wollen Sie ihn denn fordern?«
»Ich werde ihn fordern!« betonte der junge Graf und stellte sich in Positur. »Ich oder er!«
»Ach Sie!« sagte Giulietta wegwerfend. »Sie sind viel zu schwach, einen Säbel zu führen!«
»Ich sprach nicht von Säbeln, auch nicht von Pistolen«, erwiderte der Graf mit düsterer Entschlossenheit; »ich werde ihn zu einem Klavierwettkampf herausfordern und ihn besiegen. Und der Sieger wird Ihr Meister werden! Gilt es?«
»Es gilt!« rief Giulietta übermütig. »Ich schlage ein in die Wette und bin selbst der Kampfpreis!« Und sie schlug in die Hand ein, die ihr der Anbeter hinreichte.
»Ach so!« atmeten die Schwestern erleichtert auf, »wenn's das ist, dann ist uns nicht mehr bange!«
»Auf Wiedersehen also beim Grafen Fries!« Eine Verbeugung, und der Graf ging.
Der Graf gehörte zur Partei der Mozartianer, die sich gegen das Spiel der Neuerer verschworen hatten. Die Gegensätze unter den Virtuosen wurden durch Klavierwettkämpfe ausgetragen, das gehörte zur musikalischen Mode der Zeit. Das Palais des Grafen Fries war der Schauplatz, wo solche Kämpfe der Klaviermatadoren mit besonderer Vorliebe veranstaltet wurden und immer von einem großen Kreis von Kunstfreunden besucht waren.
Kaum war Gallenberg fort, kam Franz Graf von Brunszvik heim, der Bruder Theresas und Josephinens. Der stattliche Kavalier mit offenen sympathischen Gesichtszügen, in der kleidsamen ungarischen Attila prächtig anzusehen, war als guter Cellospieler in seinen Kreisen berühmt; er gehörte zu den stillen Verehrern des Meisters, ohne ihm noch persönlich näher getreten zu sein, und freute sich über die Absicht der Schwestern, bei dem Künstler Unterricht zu nehmen. Das Widerstreben der Mama, die wieder erschienen war, war bald besiegt; daß auch der Sohn dafür war, der alles bei ihr galt, hatte wenigstens ihren lauten Protest verstummen gemacht. Innerlich war sie nicht überzeugt, sie war zu adelsstolz, um an dem Gehaben des Meisters Gefallen zu finden; da sie nun Grund hatte zu zweifeln, ob das »van« wirklich Adelsprädikat war, wie viele stillschweigend annahmen, war sie erst recht in ihrem Widerwillen bestärkt.
»Er mag ja ein guter Künstler sein, das will ich nicht leugnen,« meinte sie, »aber er ist nicht ebenbürtig, und weil er so tut, ist er mir doppelt unangenehm.«
Als nun die Jugend um sie her hell auflachte, fügte sie seufzend hinzu: »Ich bin eine alte Frau und kann mich in den verkehrten Zeitgeist durchaus nicht finden; ich fürchte, die Welt steht nicht mehr lang, wenn es so fortgeht«, was neues Gelächter auslöste.
Natürlich wurde dem Bruder Franz brühwarm die Geschichte mit der beabsichtigten Herausforderung Beethovens durch Gallenberg zu einem Klavierwettkampf erzählt.
Franz meinte, Gallenberg sei ein nicht zu unterschätzender Virtuose, der Beethoven vielleicht an Präzision in der Wiedergabe gedruckter Noten überträfe, während der Meister eben Musik mache und durch das wundervolle Legato, den beseelten Ton, der seine besondere Stärke ist, alles Dagewesene überträfe. Aber das wichtigste bei solchem Klavierwettspiel sei eben das freie Phantasieren, und darin habe Beethoven überhaupt noch nicht seinesgleichen gefunden.
»Also mit dem neuen Löwenritter anzubandeln, der auf allen Turnierplätzen seine Gegner ausgestochen und zusammengedroschen, ist eine gewagte Sache«, fuhr Franz fort und gab das köstliche Stückchen mit dem Abbé Gelinek, einem der berühmtesten Klaviervirtuosen Wiens, zum Beweis, der auch einmal gemeint hatte, den »Neuling« Beethoven »zusammenhauen« zu können und am anderen Tage, als er befragt wurde, wie die Sache abgelaufen, trübselig zugab: »Der Kerl hat den Satan im Leib; so spielen hab ich noch nicht gehört – es ist einfach nicht aufzukommen dagegen!«
»So ist es bisher allen gegangen mit ihm«, schloß Franz; »nun, ich wünsche Gallenberg, daß er nicht mit einer tüchtigen Schlappe abzieht.«
Die schöne Kusine hatte währenddessen mit eigentümlichem Lächeln zur Decke geblickt, sie schien in Träumereien verloren, ihre Gedanken gingen geheime, ungewöhnliche, vielleicht gefährliche Wege, und sie wußte wohl, daß sie diesen Gedanken auf solchen Wegen nachziehen werde.
Nur auf die letzte Bemerkung Franz von Brunszviks gab sie ein Echo, indem sie, obschon halb im Selbstgespräch, plötzlich sagte:
»Nun, mir kann es ja recht sein!«
»Ist dir nichts aufgefallen an der Guicciardi«, fragte Josephine, als Giulietta fort war.
»Daß sie ihren Bräutigam schlecht behandelt«, erwiderte Theresa.
»Nein,« entrüstete sich Josephine, »daß sie neidisch und eifersüchtig ist auf uns!«
»Auf uns?!«
»Ja, auf uns! Beethoven wegen!«
»Aber Pepi!«
»Das laß ich mir nicht nehmen! Gefallsüchtig ist sie! Mannstoll! Die ist zu allem fähig! Du wirst sehen, mit der werden wir noch was erleben!«
»Du träumst, Pepi! Ein guter Kerl ist sie. Sie mag halt den faden Gallenberg nicht, das kann ich verstehen.«
»Nein, Theresa, das ist es nicht! Den möcht' ich auch nicht. Aber siehst du nicht, daß sie nach allem lüstern ist, was sie nicht hat? Auf Abenteuer ist sie erpicht; hast du das nicht bemerkt?«
»Ach, Kindereien!«
Theresa war an den Flügel herangetreten und blätterte in den Noten. Der lange Faltenwurf des blauen Gewandes, in der Mitte von einem breiten Silbergürtel umschlossen, ließ sie größer erscheinen, als sie war, und verhüllte den etwas verwachsenen Rücken, die Folge eines Sturzes vom Pferde, den sie als Kind erlitten, so vollkommen, daß nichts davon zu merken war. So bildete die Gestalt in dem weichen Spiel des Gewandes eine klingende Linie voll unbewußten Adels vom Fuß bis zum stolzen Nacken unter der dunklen Haarkrone. Die sanfte Schönheit der großen Gesichtszüge war trotz der heiteren Stirn von leiser Schwermut gehoben, die sinnend über den kühn zusammenschließenden Augenbrauen thronte. Melancholisch, fast schmerzlich war der Mund, der Schweigen verhieß und doch beredt war und nur das eine unausgesprochene Wort zu verraten schien: Entsagen. Man konnte sie nicht ansehen, ohne von Teilnahme und Rührung ergriffen zu sein.
Anders war Josephine. Beweglicher, lebensfroher, temperamentvoller. Sie konnte nicht leicht hinterm Berg halten, wenn sie etwas auf dem Herzen hatte. Sie war ganz Gefühl und sehr entschieden in ihren Zu- und Abneigungen. Auf die Guicciardi hatte sie nun einmal einen Pik. Ganz aufgeregt war sie mit einem Male.
»Falsch ist sie, sage ich dir! Oh, die ist falsch! Wir nehmen sie nicht mit, hörst du? Sie führt etwas im Schild, was sie natürlich nicht sagt. Oh, ich traue ihr nicht. Nimm dich nur in acht vor ihr. Sie ist gefährlich. Weißt du was?«
Sie trat nahe an Theresa heran, und im Ton eines großen Geheimnisses:
»Verliebt ist sie!«
»So,« sagte Theresa ziemlich gleichmütig, »verliebt ist sie? Etwa in Gallenberg?«
»Ach was, du bist aber fischblütig, Theresa, merkst du denn gar nichts?!« Ganz ärgerlich konnte Josephine über die allzu kühle Schwester werden. »Natürlich nicht in Gallenberg, den sie erbarmungslos zappeln läßt wie eine Fliege, die sich in einem Spinnennetz verfangen hat.«
»In wen denn sonst? Etwa in Franz?«
»Ganz gefehlt!« Und nun leise, ganz geheimnisvoll: »In Beethoven!« Jetzt mußte Theresa wirklich lachen.
»Ich glaube, du siehst Gespenster, Pepi! Den kennt sie ja gar nicht!«
»Nun eben drum!«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ach!« Ganz ungeduldig konnte Josephine werden. »Sie hat uns ausgefragt und sich ein Bild gemacht. Aber das allein ist es natürlich nicht. Die Wahrheit ist die: sie vergönnt uns ihn nicht!«
»Uns?!« Nein, die Pepi war wirklich drollig. Theresa traute ihren Ohren nicht. Und sie betonte nochmals: »Uns?! Ja, was geht er uns an? Wir kennen ihn doch selber kaum! Mir scheint, Pepi, du bist mehr eifersüchtig auf die Guicciardi, als sie auf uns, wenn sie es überhaupt ist!«
»Geh, du verstellst dich nur! Das ist nicht schön von dir, Theresa! Aber jetzt sag' ich dir auch nichts mehr!« Josephine konnte es nicht fassen: »Entweder bist du wirklich so ahnungslos, oder – – –«
Theresa streifte die Schwester mit einem raschen fragenden Blick, als wollte sie sagen: hat die wirklich auch Feuer gefangen – Liebe auf den ersten Blick? Sie schüttelte den Argwohn alsogleich ab und lächelte schon wieder:
»Kinder seid ihr, alle zwei! Närrische Kinder.«
»Kindische Narren, alle drei!« erwiderte Josephine und lachte.
Theresa hatte sich ans Klavier gesetzt und sang mit wohlklingender Stimme eine der beliebten Mode-Arien:
»Mich heute noch von dir zu trennen
Und dieses nicht verhindern können,
Ist zu empfindlich für mein Herz!«
IV. Kapitel.
Schon von frühem Morgen an war der Meister mit wahrem Bienenfleiß tätig; der Vormittag brachte allerlei Besuche, das Vorzimmer war von Menschen angefüllt, sechs bis acht Personen, die geduldig warteten, bis sie der alte Diener in das Allerheiligste vorließ, nachdem sie angemeldet waren: Orchesterdirektoren, der Mozartschüler Süßmayer, Schuppanzigh; mancher mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen, wenn der Meister nicht bei Laune war.
Nur der alte Krumpholz, Violinist im alten Hoftheater, hatte jederzeit Zutritt. Er hatte ein feines, richtiges Gefühl für Tonkunst, ein untrügliches Gehör; in der Lehrzeit bei Haydn war er der eigentliche heimliche Berater, dem Beethoven, der sonst sehr zurückhaltend war mit seinen neuen Schöpfungen, alles vorspielte und jede Idee mitteilte. Ihm war der Meister von Herzen zugetan als seinem musikalischen Intimus; wogegen er erklärte, daß er von Haydn eigentlich nichts lernen konnte, und daher den Wunsch Haydns, er möge auf seine durch Lichnowskys Vermittlung bei Artaria erschienenen Trios unter seinem Namen die Bemerkung »Schüler Haydns« setzen, rundweg ablehnte. Das war zugleich auch die Antwort auf den bekannten Vorbehalt des Altmeisters gegen das dritte Trio.
Krumpholz, sein Narr, wie ihn der Meister wegen seiner Verzückung und Anhänglichkeit nannte, war mit dem Musiker und Sänger Czerny erschienen, der seinen begabten Sohn Karl mitgebracht hatte; der Meister sollte diesen in die Lehre nehmen.
Als sie in das Zimmer eintraten, kam ihnen Beethoven entgegen, in langhaariges, dunkelgraues Zeug gehüllt, so daß der junge Karl Czerny glaubte, Robinson Crusoe vor sich zu sehen, der eben seine Knabenlektüre bildete und seine Phantasie mächtig anregte. Wattebauschen steckten in seinen Ohren, der Meister klagte über Sausen im Ohr, dann über Koliken, die ihm zusetzten. Die Kompositionen zu seiner ersten öffentlichen Akademie seien knapp vor der Aufführung fertig geworden, während er unter heftigen Leibschmerzen, seinem alten Übel, litt; ein Arzt habe ihm Landaufenthalt verschrieben, ein anderer Pillen; dieser kalte Bäder, jener lauwarme.
Nach den Klagen über die verschiedenen Miseren führte der Meister seine Besucher ans Klavier heran und bedeutete dem Vater Czerny, indem er ihm ein Manuskript reichte: »Ich hab's kürzlich niedergeschrieben – eben jetzt brennt ein lustiges Feuer im Ofen, sehen Sie, und da soll es hinein.«
»Nun wir wollen einmal sehen«, sagte Krumpholz, der Narr, und las mit dem alten Czerny das Blatt durch und las es immer wieder.
»Du gütiger Gott!« jammerte der Narr, »in den Ofen! Welche Sünde!«
»Ich will's mal probieren,« meinte Czerny, »wenn es der Meister hören will.«
»Nun, so probiert es, wenn Ihr wollt«, war die Antwort.
Der Sänger begann, und Beethoven, eben noch finster und unruhig, wurde ernst; als das Lied zu Ende war und Czerny mit Krumpholz vor Begeisterung überfloß, sagte er ganz heiter:
»Nein, nein, lieber Alter; die Adelaide werden wir schon nicht verbrennen!«
Der junge Czerny hatte unterdessen Zeit, sich in dem Zimmer umzusehen. Es kam ihm recht wüst und zyklopenhaft vor. Ein wunderliches Durcheinander von Büchern, Musikalien und Briefen in allen Ecken und Enden, auf dem Klavier, am Fußboden und in den Winkeln. In einer Zimmerecke war ein kleiner häßlicher, rothaariger Mensch beschäftigt, in das Chaos Ordnung zu bringen; kostbare Originalmanuskripte, flüchtige musikalische Notizen, die Niederschriften unsterblicher Gedanken, gedruckte Noten, Korrekturbogen, die der Erledigung harrten, lagen wirr durcheinander und waren nun halbwegs gesichtet; aber der Meister, der ein bestimmtes Manuskript suchte, warf wieder alles kunterbunt durcheinander, darüber der kleine rote Kerl in unbändige Wut geriet und schrie, daß alles vergebliche Arbeit sei, und daß er sich einen anderen suchen möge, der ihm den Narren abgebe. Der Meister wieder beschuldigte den Famulus, daß er alles Wichtige und Kostbare verräume, so daß sich überhaupt kein Mensch mehr auskenne, und daß die scheinbare Unordnung nur eine Art höhere Ordnung sei, die Karl eben durch seinen blinden Eifer gestört habe. Es gab heftige Worte auf beiden Seiten mit dem Resultat, daß der Rothaarige davonlief.
Aus dem Zusammenhang der Debatte und den aufklärenden Äußerungen des Meisters ging hervor, daß dieser Karl sein Bruder sei, Musiker und nun auch Beamter in der Staatsschuldenkassa; er habe ihn, ebenso wie den Bruder Johann, der in einer Apotheke untergekommen sei, nach Wien kommen lassen, um besser für beide sorgen zu können, nachdem er, der Meister, als der Älteste, schon in Bonn gleichsam die Vaterstelle an ihnen vertreten und für die Ausbildung und Erziehung sich bemüht habe. Aber es sei ein rechtes Kreuz mit den Brüdern. Er habe gehofft, dankbare Hilfe an ihnen zu finden, er brauche eben jemand zur Erledigung der Korrespondenz und der geschäftlichen Angelegenheiten, für die ihm weder Zeit noch Geduld bliebe, so wichtig sie auch sind; zuerst habe ihm Johann Sekretärsdienste geleistet, aber mit ihm ging's gar nicht, und jetzt sei Karl eingesprungen, dieser nervöse, aufgeregte Mensch, mit dem auf die Dauer ebensowenig auszukommen sei. Er müsse doch wieder selbst auf alle Dinge sehen, sonst ginge alles schief; das eine oder andere verschwindet, man wisse gar nicht wie – kurzum nichts als Ärger!
»Das hat man von den lieben Brüdern! Eigentlich kann ich keinem vertrauen.« Mit diesem bitteren Wort schloß der Meister seine Klage. »Und ich brauche doch jemanden; der Alltag zerstört mich!«
Der Meister, im übrigen wohl befriedigt von dem guten Eindruck, den »Adelaide« auf die begeisterten Zuhörer machte, war gnädig gestimmt und nahm den jungen Czerny als Schüler auf, obwohl er hinzufügte, daß der Unterricht für ihn eine harte Fron sei. »Was hat sich doch die gute Hofrätin Breuning in Bonn für redliche Mühe gegeben, mich in der Jugend bei der Stange zu halten,« äußerte er erinnerungsselig, »wenn ich beim Grafen Westphal, wo ich Stunden zu geben hatte, vor der Haustür wieder umkehrte, weil es eben manchmal beim besten Willen nicht ging. Aber sie beobachtete mich vom Fenster aus, und dann gab's immer eine Strafpredigt. Wenn aber manchmal gar nichts half, dann pflegte sie zu sagen: er hat eben heute wieder seinen Raptus! Das ist mir aus der Jugend geblieben, der Raptus; damit man es nur weiß, wenn ich ab und zu meinen Schüler unverrichteter Dinge wegschicken muß. Nun setz dich her, mein Junge!«
Der Knabe spielte etwas vor aus Mozarts großem D-Dur-Konzert; der Meister rückte näher, spielte mit der linken Hand bei den akkompagnierenden Passagen die Orchestermelodie mit und äußerte sich wohl zufrieden.
»Der Knabe hat Talent, schicken Sie ihn wöchentlich einigemal zu mir.«
Krumpholz, sein Narr, war entzückt über den Ausspruch: drei Beglückte verließen das Haus.
Nachmittags kam Bruder Karl wieder zurück, etwas kleinlaut. Aber es war schon Ferdinand Ries da und hatte sich, wie sooft schon, über den Haufen hergemacht, um halbwegs Ordnung zu schaffen, eine reine Sisyphusarbeit, denn alsbald war ja doch alles wieder durcheinandergeworfen. Meister Ludwig schickte den Bruder weg.
»Laß das; das macht jetzt schon ein anderer!«
Wieder ging Karl wütend davon.
»Du kommst schon wieder,« rief er unter der Tür, »wenn du mich brauchst, aber dann kannst lange warten, bis ich nochmals einen Narren abgebe.« Und schlug die Tür krachend hinter sich zu.
»Der betrügt mich doch nur, wie mich Johann betrogen hat«, äußerte der Meister mit schlimmem Verdacht; »nie mehr über meine Schwelle!« Er rang förmlich die Hände: »Ach wohin wird das noch führen, wenn man sich nicht einmal auf die eigenen Brüder verlassen darf!«
Der Meister tat sich wirklich schwer mit dem Alltag.
Einige Tage später war Bruder Karl wieder da. Ganz verändert; grinsend freundlich, schmeichlerisch.
»Lieber Ludwig, wie geht's dir? Ich hab's gar nicht mehr ausgehalten vor Sehnsucht, dich zu sehen!«
Gerührt über soviel Liebe, schloß Ludwig seinen Bruder in die Arme.
»Herzensbruder, daß du nur wieder da bist! Du siehst ganz schlecht aus; fehlt dir etwas?«
»Ach Ludwig, ich wollte dir eigentlich gar nichts sagen, um dir das Herz nicht unnötig schwer zu machen – aber, aufrichtig gestanden, freilich fehlt mir etwas: du weißt, der kleine Gehalt, und bis zum Monatsende ist weit; ich getraue mich gar nicht zu fragen: könntest du mir mit einer Kleinigkeit aushelfen?«
»Aber natürlich, Herzensbruder! Ich bin zwar gerade auch nicht bei Kasse, und siehe, der Hauswirt hat einen Zettel heraufgeschickt wegen der schuldigen Miete; die 600 Gulden Jahresrente, die mir Fürst Lichnowsky ausgeworfen, erlauben auch keine allzu großen Sprünge – aber das tut alles nichts; abends kommt Freund Amenda, da wollen wir sehen, was sich vorläufig tun läßt.«
Karl war schlau; er wußte, wie er den Bruder zu nehmen hatte, der dankbar war für ein bißchen Liebe, wenn es auch nur eine sehr interessierte Liebe war; er nahm sie für echt.
»Aber dem Johann geht's doch gut in seiner Apotheke; hat dir der nicht beispringen können?« fragte der Meister.
»Lieber Ludwig,« beteuerte Karl, »du weißt doch, was Johann für ein selbstsüchtiger, aufgeblasener Mensch ist. Dem um etwas zu kommen, da ist man schon beim Rechten!« Und nun legte er los und schimpfte in einem Atem über den abwesenden Bruder. Er wußte, daß auch Ludwig auf ihn nicht gut zu sprechen war, und redete dem Meister zu Gefallen.
»Ja, ja,« sagte Ludwig, »ich kenne ihn; und in einigem hast du recht. Ein undankbares Geschöpf ist er, und das kränkt mich!«
»Und gegen dich hat er es scharf,« schürte Karl, »daß du nichts Rechtes bist und auch nichts Rechtes werden wirst: er beurteilt eben alles vom Geldstandpunkt; wer nichts hat, der gilt ihm nichts!«
Das brachte Ludwig erst recht gegen Johann auf: »So, also das ist seine Meinung! Der Elende, der alles, was er ist, mir zu verdanken hat! Seine Stellung, sein Einkommen, alles, was er ist und hat! Oh, dieser Mißratene! Sei nur guten Muts, Karl, du brauchst dich nicht erniedrigen vor ihm, ich werde für dich sorgen, wie ich früher gesorgt habe für euch beide!«
Der Familiensinn und das Pflichtgefühl, ein großväterliches Erbe, waren stark in dem Meister, und Karl verstand es vortrefflich, diese Tugenden für sich auszubeuten.
Abends kam wirklich der junge kurländische Theologe Amenda, der in Wien einige Studienjahre verbrachte und im Hause des Fürsten Lobkowitz Vorleser war. Dort hatte ihn der Meister kennengelernt und sofort eine warme Freundschaft zu ihm gefaßt. Amenda begleitete ihn oft auf Spaziergängen, verbrachte halbe Nächte in seinem Quartier, wo gemeinschaftlich musiziert wurde, denn Amenda war auch ein guter Violin- und Cellospieler; nebstbei war er Lehrer bei Mozarts Kindern, nachdem die Witwe Mozarts wieder geheiratet hatte und sich in guten Verhältnissen befand.