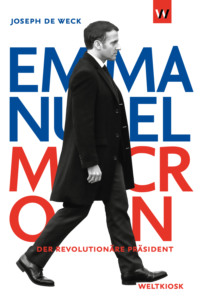Kitabı oku: «Emmanuel Macron», sayfa 3
DER 21. APRIL
So kam es 2002 zu dem Tag, der als le 21 avril in die Geschichtsbücher eingegangen ist: Der sozialistische Kandidat Jospin, der gegen Amtsinhaber Jacques Chirac antritt, erhält bei der Präsidentschaftswahl im ersten Durchgang lediglich 16 Prozent der Stimmen. Der Kandidat des rechtspopulistischen Front National, der rechtskräftig verurteilte Antisemit Jean-Marie Le Pen, zieht in den zweiten Wahlgang gegen Chirac, der mit knapp 20 Prozent selber ein lamentables Ergebnis erzielt hat. Viele Franzosen erleben den Tag als nationales Trauma. Zwei Wochen später gewinnt Chirac den zweiten Wahlgang mit 82 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung liegt bei fast 80 Prozent.
Romane, Filme und unzählige Sachbücher haben seither das «politische Erdbeben» vom 21 avril aufgegriffen und zu deuten versucht. Das einhellige Urteil: Es lag an der desolaten wirtschaftlichen Lage.
Das im deutschen Sprachraum meistgelesene (wiewohl in Frankreich kaum bekannte) Buch zu der These «Armut schafft Unmut» ist Didier Eribons halb autobiographische, halb soziologische Studie Rückkehr nach Reims, 2009 erschienen. Der Marxist Eribon, der wie Macron aus dem deindustrialisierten Norden stammt, erläutert anhand seiner Familiengeschichte, warum vormals links wählende Arbeiter zum Front National (heute Rassemblement National) gewechselt sind.
Die Erklärung des Soziologen: Die linken Parteien verstünden Politik nicht länger als Klassenkampf; sie verfolgten einen wirtschaftsliberalen Kurs, sie hätten die Arbeiter fallengelassen. Es gebe mehr Armut und darum mehr Front-National-Wähler, so die schlichte These, verkürzt sie doch den Rechtspopulismus auf eine rein ökonomische Frage. Liberale und Rechte bleiben ihrerseits in dieser Logik gefangen, wenn sie die Gegenthese vertreten und die missliche Lage am Arbeitsmarkt auf die «Reformblockade» der Linken zurückführen.
Doch wirtschaftliche Aspekte sind offensichtlich nur ein Teil der Erklärung. Von Dänemark über die Schweiz und Österreich bis nach Ungarn und Polen: In den wirtschaftlich erfolgreichsten und sozial mobilsten Ländern Europas sind Rechtspopulisten zum Teil noch erfolgreicher als in Frankreich. Autoritarismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit sind für viele Zeitgenossen auch dann attraktiv, wenn sie gute Chancen auf eine sichere Stelle und sozialen Aufstieg haben. Eribon lässt dies übrigens selbst anklingen. Das Arbeitermilieu, dem er als Homosexueller nach Paris entfloh, sei dem konservativen Gesellschaftsbild der Rechten schon immer nahe gewesen, schreibt er. In der patriarchalen Arbeiterwelt mit sexistischen und rassistischen Reflexen sei der Kampf der Linken für die Rechte von Ausländern oder sexuellen Minderheiten auf Unverständnis gestoßen.
Trotz des ganzen Kraftaktes einer Post-Rationalisierung des Aufstiegs des Front National durch Frankreichs Intellektuelle: Richtig verarbeitet haben sie das «Erdbeben» trotzdem nie. Chirac, Sarkozy und Hollande: Seit dem 21 avril agierten auch Frankreichs Präsidenten in steter Angst vor den Rechtspopulisten. Und viele Franzosen fühlen sich als Opfer einer nicht enden wollenden Farce. Präsidenten kommen und gehen. Doch egal, wen das Volk wählt, ob links oder rechts, jede Regierung sieht sich gezwungen, wegen des wachsenden Schuldenbergs und der anhaltenden Schwäche der Wirtschaft Einschnitte am Sozialstaat hier und Abstriche an den Arbeitnehmerrechten dort vorzunehmen.
Das gibt Nahrung für das in Frankreich sehr präsente Narrativ eines déclassement: eines französischen Abstiegs in die zweite oder dritte Liga. Frankreich werde abgehängt, dem Land gehe es schlecht, so die von Buch zu Buch und von Leitartikel zu Leitartikel bekräftigte Dauermeinung. Streitschriften wie Der französische Selbstmord: 40 Jahre, die Frankreich zerstört haben30 werden zu Bestsellern. Jede literarische Saison bringt immer neue Variationen des Themas: Das französische Malheur, Frankreich stürzt ab, Besessen vom Niedergang — die Liste ist endlos. Rundfunksendungen widmen sich Fragen wie: «Kann es einem gut gehen in einem Land, dem es schlecht geht?»
Deutschland kommt hier eine besondere Rolle zu. Permanent wird der Vergleich mit dem großen Nachbarn am anderen Ufer des Rheins gesucht, ob es denn um Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, die Zahl der jährlichen Streiktage oder die der Patentanmeldungen geht. Rundum scheint die Bundesrepublik besser abzuschneiden. Selbst bei den Geburtenziffern — lange Frankreichs Stolz — holt der Nachbar allmählich auf.
PERMANENTER AUSNAHMEZUSTAND
Das mediale Narrativ eines nationalen Versagens spiegelt die trübsinnige Grundstimmung in der Bevölkerung. Seit Jahrzehnten bestätigen Umfragen, dass die Franzosen die Zukunft besonders pessimistisch einschätzen.
2019 glaubten 73 Prozent, Frankreich sei im Niedergang begriffen (und historisch gesehen ist das ein eher tiefer Wert!).31 Nur gerade 34 Prozent der Franzosen befanden im Sommer 2020, die Lage im Land sei «gut»: In der Bundesrepublik waren es 73 Prozent. Und 76 Prozent der Franzosen, aber bloß 43 Prozent der Deutschen bezeichneten die wirtschaftliche Lage als schlecht.
Gefragt, ob ihre nationale Kultur anderen überlegen sei, stimmen in einer anderen Umfrage 36 Prozent der Franzosen zu — im Vergleich zu 45 Prozent der Deutschen und 50 Prozent der Schweizer.32 Sage noch einer, die stolzen Franzosen seien chauvinistisch! Sie gehen unbarmherzig mit sich selbst ins Gericht.
Das hat nicht nur mit dem Auf-der-Stelle-Treten der Wirtschaft zu tun. Frankreich kommt seit Jahren einfach nicht zur Ruhe. Zum einen sind da die Terror-Anschläge: die Bluttat in der Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo und die Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt am 7. Januar 2015; das Massaker im Pariser Konzerthaus Bataclan und auf zwei Barterrassen am 13. November 2015, während zur selben Zeit ein Anschlag auf das Freundschaftsspiel Deutschland–Frankreich im Stade de France fehlschlägt; die Lastwagen-Attacke am Nationalfeiertag 2016 auf der Promenade des Anglais in Nizza; die Attacke auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember 2018. Dazwischen traumatisieren immer wieder Messer-Attentate mit meist zufälligen Opfern — auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées, aber auch in mittleren Städten und kleinen Ortschaften in der Provinz. Schockierend sind auch die zielgerichteten Morde an Juden, Priestern und Soldaten. Einer der jüngsten Anschläge in dieser Reihe ist die Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty am 16. Oktober 2020. Er hatte in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt.
Seit 2015 hat die Republik 31 solcher Terroranschläge erlebt, zuzüglich einer Vielzahl verhinderter Attentate. Zehntausend Soldatinnen und Soldaten der «Opération Sentinelle» patrouillieren jahraus, jahrein in Frankreichs Bahnhöfen, Gotteshäusern und Einkaufsstraßen. Man hat sich vollkommen daran gewöhnt, am Eingang eines Einkaufszentrums einen in Camouflage gekleideten Soldaten mit Maschinengewehr im Anschlag zu sehen. Nicht nur die Straßen sind militarisiert: die Geheimdienste haben freie Hand, Anti-Terror-Gesetze werden laufend verschärft. Individuelle Freiheit hin oder her: In der Krise setzen die Franzosen auf den Staat und erwarten, dass er sie mit seiner geballten Kraft beschützt. Die Armee (85 Prozent), gefolgt von der ebenfalls militärischen Gendarmerie (81 Prozent) und der Polizei (69 Prozent) sind die Institutionen, die in der Bevölkerung das größte Vertrauen genießen.33
Dieser Widrigkeiten nicht genug: Macrons Wahlsieg befeuert sofort die sozialen Spannungen. Den Anfang machen die von «Schwarzen Blocks» vereinnahmten und außergewöhnlich gewalttätigen Kundgebungen gegen Macrons Arbeitsmarktreform im Herbst 2017. Im April 2018 beginnt der Streik der Bahnarbeiter gegen die Abschaffung ihres arbeitsrechtlichen Sonderstatus. Über einen Zeitraum von drei Monaten steht der Bahnverkehr ganze 36 Tage still: ein Rekord, und trotzdem erleiden die Gewerkschaften am Ende eine Niederlage. Dann entsteht, anscheinend aus dem Nichts, im Winter 2018–19 die Gelbwesten-Bewegung. Die Protestierenden legen Verkehrskreisel und Autobahnen lahm. Samstags nehmen sie jeweils Frankreichs Stadtzentren in Beschlag, eine spektakuläre Kulisse für heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Im Winter 2019–20 folgt dann eine breite Mobilisierung gegen die Rentenreform. Die Bahnarbeiter brechen mit 43 Streiktagen abermals den Rekord, und diesmal beteiligen sich auch die Angestellten der Pariser Metro, die Mitarbeiter des staatlichen Energielieferanten EDF und die Lehrer. Hinzu kommen die globalen Klimaproteste von Fridays for Future, die auch Frankreich erfassen. Und die Black-Lives-Matter-Bewegung geht nach dem Mord an George Floyd durch Polizeibeamte in Minneapolis auch in Frankreich auf die Straße und geißelt die systematische Polizeigewalt gegen die dunkelhäutige Minderheit.
Lang vor der Coronavirus-Pandemie haben sich die Franzosen damit abgefunden, dass «Normalität» nicht mehr die Norm ist. Freunde in einen anderen Landesteil mit der Bahn zu besuchen oder am Wochenende in die Stadt zum Einkaufen zu fahren: All das verhinderten oft genug die Streikwellen. Die nicht gerade sport-affinen Pariser steigen en masse aufs Fahrrad um, sie wollen die Proteste und die Terrorangst umfahren. Oder sie verwandeln sich in Fußgänger. Fitnesscentern und Damenschuhgeschäften laufen buchstäblich die Kunden davon: Wer braucht noch Kardio-Training oder hochhackige Schuhe, wenn der tägliche Fußweg zur Arbeit fünf Kilometer quer durch Paris führt? Und jeden zweiten Sommer überrollt eine Hitzewelle die Stadt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo ruft die älteren Pariser auf, in klimatisierte Bibliotheken, Supermärkte und Kinos zu gehen, sobald ihnen zu heiß ist. 2019 steigt das Thermometer in einer der am dichtesten besiedelten Metropolen Europas (Paris zählt 20 909 Menschen pro Quadratkilometer) mit wenig Grünflächen auf 42,6 Grad Celsius.
Den abendlichen Konzertbesuch überlegt man sich zweimal seit dem Bataclan-Massaker. Das Weintrinken im Straßenbistro feiert man schon lange nicht mehr als Akt des republikanischen Widerstands gegen die Terroristen. Als im Spätsommer 2020 die Restaurants und Bars eine Weile wieder öffneten, galt manchen die Push-Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon, es habe im Viertel eine Messerattacke gegeben, als definitives Anzeichen der Rückkehr zur «Normalität» des Pariser Lebens.
Die Fernsehserie In Therapie, die bei Arte läuft und sechs fiktive Französinnen und Franzosen beobachtet, wie sie beim Psychiater ihr Bataclan-Trauma zu bewältigen versuchen, wird zum Publikumshit. Ein ganzes Land schaut auf der Fernsehcouch dem Geschehen auf der Psychologencouch zu, irgendwo zwischen Panikattacke und Erschöpfungsdepression.
Am 15. April 2019 brennt auch noch Notre-Dame de Paris. Die nach fast 200-jähriger Bauzeit 1345 fertiggestellte Kathedrale, die Kriege und Revolutionen überlebt hat und 2016 Ziel eines missglückten islamistischen Bombenattentats war, steht im sonst versöhnlichen Pariser Feierabendhimmel in Flammen. Das Land bietet all den Zeitgenossen, die für Weltuntergangsstimmung anfällig sind, das volle Programm.
Selbst die kollektive Euphorie nach dem Sieg der équipe tricolore bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 unterstrich letztlich die gedrückte Stimmung. Die Mannschaft wollte der Nation einen seltenen Augenblick des Glücks, der Sorgenlosigkeit und der nationalen Einheit schenken, wie beim legendären ersten Weltmeistertitel 1998. Kylian Mbappé, geboren 1998 als Sohn eines Kameruners und einer Algerierin, aufgewachsen in Seine-Saint-Denis, einem der Schauplätze der Pariser Banlieue-Revolten von 2005, sagte vor dem Turnier: «Ich will Frankreich verkörpern, es repräsentieren, alles für Frankreich geben.» Denn «eine Weltmeisterschaft löst viele Probleme. Sie macht das Land glücklich. Ob die Kassiererin, der Bürgermeister oder der Präsident: Alle machen sich mit einem großen Lächeln wieder an die Arbeit.»34
Frankreichs individualistische Fußballstars bändigten ausnahmsweise ihre Egos. Die oft zerstrittenen Les Bleus fanden zueinander. Sie bildeten kein Team ziemlich bester Freunde. Aber die elf Franzosen, die am Tag des Finales in Moskau aus voller Kehle die Marseillaise sangen, stellten sich in den Dienst der gemeinsamen Sache. Mit wenig Glanz, aber dank ihrer Eintracht holen die Franzosen den zweiten Weltmeistertitel. Das Volk, das sich eigentlich nur lauwarm für den Fußball begeistert, tanzt in den Straßen. Frankreich feiert die Feste, wie sie fallen.
CANDIDE ODER DER OPTIMISMUS
Die kollektive Schwermut ist aber nicht nur der schwachen Wirtschaftsentwicklung, den gesellschaftlichen Spannungen und dem fundamentalistischen Terror geschuldet. Die Gedrücktheit ist auch Ausdruck der permanent praktizierten Introspektion der Franzosen.
Zu den erfolgreichsten Autorinnen und Autoren zählen Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Annie Ernaux und Édouard Louis. Sie porträtieren ihre Heimat als eine zerrüttete, gewalttätige Gesellschaft im Widerstreit mit der Modernität. Im Unterschied zu Deutschland scheint es in Frankreich sogar einen richtigen Nestbeschmutzer-Bonus zu geben. Der Schauspieler Gérard Depardieu beleidigt seine Landsleute als «Idioten» und nimmt die russische Staatsbürgerschaft an. An der Kinokasse wird Depardieu dennoch nur von Louis de Funès übertroffen, dessen Metier es war, sich meisterlich über seine Mitbürger lustig zu machen. Die Franzosen lieben diejenigen, die sie beschimpfen oder die ihnen den Spiegel vorhalten — sofern diese Störenfriede selbst Franzosen sind.
«Die Hölle, das sind die anderen.» Ganz wie in Jean-Paul Sartres Kammerspiel Geschlossene Gesellschaft beschäftigen sich die Franzosen hauptberuflich mit sich selber. Wer sich dessen vergewissern will, besuche eine private Feier in Paris. Zu hören gibt es dort hauptsächlich Chansons, French House und lokale Rap-Klassiker. Die Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens widmen im Schnitt 16 Prozent ihrer Sendezeit europäischen und internationalen Themen; in Deutschland liegt der Anteil bei fast 50 Prozent.35 In einer Umfrage gaben 53 Prozent der Franzosen an, oft oder gelegentlich mit Freunden und Verwandten auch über europapolitische Fragen zu diskutieren. In Deutschland sagen das 82 Prozent von sich.
Und die Franzosen reisen selten ins Ausland.36 Warum auch? Frankreich hat alles, was der europäische Kontinent an Natur zu bieten hat: schneebedeckte Berge, dichte Wälder und Kornfelder, die sich bis zum Horizont ziehen. Da sind die trockene Provence, nasse bretonische Mondlandschaften, windstille Seen, endlose Flüsse, eine große und viele kleine Inseln und natürlich das Meer in zweifacher Ausführung: Man kann unter Palmen am Mittelmeer flanieren oder den Wellenreitern auf dem Atlantik zusehen und dabei Austern schlürfen. Und kommt winters die Sehnsucht nach Sonne auf, locken die vielen Direktflüge nach La Réunion im Indischen Ozean oder auf die Karibikinsel Guadeloupe. Keine Frage: Die Franzosen genügen sich selbst. Unglücklich sind sie trotzdem.
Dass Frankreichs pessimistische Stimmung auch auf kulturelle Faktoren zurückzuführen ist, zeigt die Glücksforscherin Claudia Senik. Die Professorin an der Paris School of Economics hat Umfragedaten des European Social Survey aus vier Jahrzehnten durchforstet und ermittelt, dass die Bürgerinnen und Bürger anderer Länder mit ähnlichen sozio-ökonomischen Profilen im Schnitt eine um 20 Prozent höhere Lebenszufriedenheit bekunden.
Zugleich erstaunt, dass ein ganz anderes Bild entsteht, sobald man Französinnen und Franzosen nach der Zufriedenheit mit ihrem Einkommen oder ihrem Arbeitsplatz befragt. Im Sommer 2020 sagten 85 Prozent, sie seien zufrieden mit ihrem Job; lediglich 8 Prozent rechneten damit, dass sich ihre Situation in den kommenden zwölf Monaten verschlechtern werde. Diese Umfragewerte sind praktisch identisch mit denen aus Deutschland.
An der Forschung von Senik fällt ein weiterer Punkt auf. Auch im Ausland lebende Franzosen sind weniger zufrieden mit ihrem Leben als die Bevölkerung im Gastland und andere dort lebende Ausländer. Umgekehrt werden Zuzügler nach Frankreich mit der Zeit ähnlich verzagt wie die Einheimischen. Frankreichs «kulturelle Mentalität» und die Bildungstradition machten die Franzosen unglücklicher, als ihr materieller Wohlstand suggeriert, erklärt die Glücksprofessorin Senik. «Frankreich ist ein Paradies, das von Menschen bevölkert ist, die sich in der Hölle wähnen», brachte der Schriftsteller Sylvain Tesson dieses Phänomen auf den Punkt.
Woher rührt solche Lust an der Kritik und der Härte gegen sich selbst? «Wenn die Engländerinnen rothaarig sind, so sind die Franzosen Kartesianer», schrieb der Philosoph André Glucksmann 1987 selbstredend klischierend in seinem Buch Descartes, c’est la France.37 «Je pense, donc je suis» («Ich denke, also bin ich») lautet das berühmte Dictum des französischen Mathematikers und Philosophen des 17. Jahrhunderts, René Descartes.
Doch Descartes’ geradliniges Denken hat widersprüchliche Ideen in Frankreichs Wesen eingewoben, so Glucksmann, der 2015 verstorben ist. Zum einen hat es die Begeisterung für den Rationalismus geweckt. Als sich die — vor dem Zeitalter der Aufklärung undenkbare — Möglichkeit einer menschengemachten Welt eröffnete, ebnete dies Frankreichs Weg zur Revolution und zur voluntaristischen, träumerisch-idealistischen Nation. Immer wieder erklärt Emmanuel Macron, Frankreich müsse wieder an diesen «Geist des Wagnisses» («esprit de conquête») anknüpfen.
Doch zum anderen beruht Descartes’ Rationalismus auf der Fähigkeit des Menschen, zu zweifeln, etablierte Ordnungen zu hinterfragen und nicht alles zum Nennwert zu nehmen. Die Praxis des Zweifels mag Fortschritt und Veränderung antreiben. Die Skepsis geht aber einher mit einer Haltung des Argwohns. Wenn die Franzosen nicht erst seit dem Internet und Covid-19, sondern seit je eine Affinität zu kruden Verschwörungstheorien hegen, dann auch deswegen, weil das Land eine Misstrauensgesellschaft ist. Auf die Frage «Kann man anderen Menschen vertrauen?» antworten nicht einmal 30 Prozent der Franzosen mit «Ja». In Deutschland liegt der Wert bei fast 45 Prozent.38 Fast durchweg vermuten sie bei Politikern und zumal bei Macron mehr Machiavellismus, als vorhanden ist.
Eine weitere Folge des Je pense, donc je suis ist, dass in Frankreich nur derjenige etwas gilt, der etwas denkt; genau genommen, der sich etwas ausdenkt. Intelligenz samt ihren Insignien wie Bildung, Kultur und Sprache zählen mehr als das verpönte Geld. Deshalb veröffentlicht jeder Pariser, der etwas auf sich hält (böse Zungen würden sagen: eine Tautologie), und zumal jeder ambitionierte Politiker mindestens ein paar Seiten zwischen Pappdeckeln. Ein Buch belegt, dass man schreiben kann, und im besten Fall, dass man etwas zu sagen hat, das über einen Tweet hinausgeht.
(Es gibt natürlich in Paris eine florierende Industrie von Ghostwritern. Während sich das Deutsche für diese Berufsbezeichnung eines Anglizismus bedient, hat Frankreich passenderweise eine Vielzahl von Umschreibungen wie «prête plume» oder «écrivain fantôme», was mit «ausgeliehene Feder» oder «Phantomschreiber» zu übersetzen wäre. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Bezeichnung «nègre littéraire» verschwindet dagegen allmählich; sie legt offen, dass die Franzosen genau wussten, dass der von ihnen praktizierte Kolonialismus die Arbeit und die Talente anderer ausbeutete.)
Denken ist nicht unbedingt der Weg zum Glücklichsein. Denken mache traurig, meinte der immerzu von Macron zitierte, 2020 verstorbene Literaturwissenschaftler George Steiner. Aber wenn das viele Nachdenken eine ganze Nation verleitet, Trübsal zu blasen, liegt das auch an dem seltsamen Anpassungsdruck, der in diesem Volk der Individualisten herrscht. Zur Illustration: Wer verspätet zu einem Pariser Abendessen stößt und versucht, sich in die laufende Diskussion einzuklinken, der soll die Faustregel anwenden: Hauptsache, irgendetwas sagen, und im Zweifel etwas Kritisches. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Menschen ohne Meinung. Optimisten stehen unter Generalverdacht, naiv zu sein beziehungsweise irgendetwas nicht kapiert zu haben.
Intelligenz und Denkleistung wird mit dem Bezug einer klaren Position und Kritik «an der Macht» oder an den gerade angeblich herrschenden Diskursen gleichgesetzt. Anna Polonyi vom Paris Institute for Critical Thinking (!) vermutet, der französische Drang zur Kritik rühre aus einer «fundamentalen Angst», als Optimist und mithin als «Verlierer» dazustehen. Glücksforscherin Senik bekräftigt: «Es ist kulturell schlecht angesehen, zu optimistisch zu sein» — was Politiker jedoch sein müssen, einschließlich des Zweckoptimisten Macron. Der Franzose verspüre einen gewissen Stolz und fühle sich überlegen, wenn er eine kritische Distanz zu allem wahre — im Sinne von: «Ich habe mich nicht übers Ohr hauen lassen.»39 Descartes’ Losung ist abgewandelt ein «Ich kritisiere, also bin ich (intelligent)».
Bei aller Liebe zum Leiden verwundert es nicht, dass Paris schon immer ein Zufluchtsort derjenigen war, die das Rotweinglas halb leer sehen. Die Stadt war die zweite Heimat des Rumänen Emil Cioran, des schwermütigsten und stilistisch leichtfüßigsten aller Pariser Schriftsteller und Kulturkritiker. Zu seinen Sentenzen gehören Aussagen wie «Wäre Dante Franzose gewesen, er hätte nur das Fegefeuer beschrieben» oder «Ich verstehe Frankreich gut — durch alles, was faul in mir ist».40
Der im selbstgewählten Pariser Exil lebende Schweizer Schriftsteller Paul Nizon beobachtet: «Frankreich ist ein Land von zweckpessimistischen Individualisten. Sie gehen davon aus, dass das Leben hart ist, und sehen es als ihre Aufgabe, diesem etwas Positives abzuringen.»41 Paradoxerweise dient das negative Welt- und Lebensbild als Quelle der berühmten französischen joie de vivre, der Lebenslust. Das Schöne muss zelebriert, jede gute Nachricht mit Champagner gefeiert werden, denn frohgemute Erlebnisse werden als Ausnahmefälle betrachtet.
Das Bild des unzufriedenen Franzosen ist natürlich vor allem auch eine Pariser Impression. Im Süden des Landes ist man ausgeglichener, im Westen geschäftiger, im Osten gemütlicher. Aber wo auch immer im Lande, der Gutgläubige kommt in der französischen Kulturgeschichte schlecht weg. Jeder Jugendliche liest in der Schule Voltaires Candide oder der Optimismus, in dem sich der Nationalautor dauernd über die Naivität und den Optimismus der Hauptperson seiner Novelle mokiert. Versöhnlich gestimmte Autoren werden in die Gattung livres de plage (Strandbücher) einsortiert: eine schöne Ablenkung beim Sonnenbaden an der Küste, keine ernsthafte Literatur.
Pessimismus und Kritik sind nicht bloß ein Beiwerk der intellektuellen Eitelkeit; sie erlauben es den Franzosen auch, Nähe herzustellen und Solidarität mit weniger Glücklicheren zu zeigen, meint Polonyi. Wer im Gespräch mit anderen Kritik übe, sei es am Wetter, sei es am Staat, sei es am Nachbarn, der im Treppenhaus nicht mal «bonjour» zugerufen habe, gebe sich als vulnerabel zu erkennen.
Bereits die Begrüßung ist der Auftakt eines Klagelieds. Man fragt leicht besorgt «ça va?» und erwartet durchaus ein Seufzen oder Lamento — während in Deutschland und erst recht in Großbritannien auf ein «Wie geht’s?» das obligate, unverbindliche «gut» folgt und jede andere Antwort irritieren würde. So ist das französische «Ach und Weh» ein Türöffner für Komplizenschaft in diesem Land, in dem der erste Kontakt oft distanziert oder unbeholfen ist. Eine gemeinsam erlittene Misere wirkt als einigende Kraft.
«Unglücklich das Land, das Helden nötig hat», schrieb Bertolt Brecht. Frankreich glaubt noch immer, Helden nötig zu haben. Und in der Tat ist der reale und gefühlte Abstieg Frankreichs das lange Prélude zu dem schnellen Aufstieg des Emmanuel Macron.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.