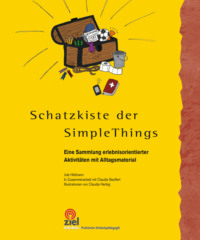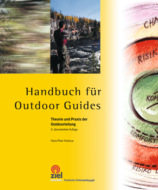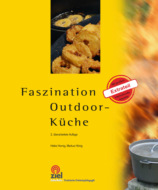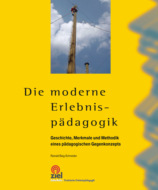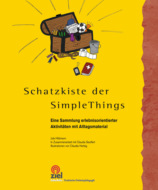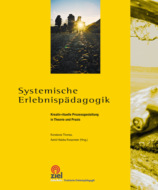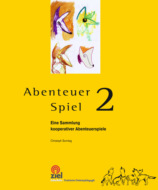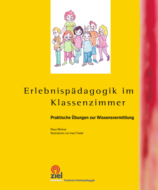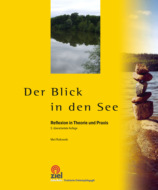Kitabı oku: «Schatzkiste der Simple Things», sayfa 2
Zu einem solchen Sicherheits- und Notfallmanagement gehören unter anderem:
Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug auf psychische Grenzerfahrungen und einer kompetenten Betreuung von Teilnehmern in Krisensituationen.
Ein Konzept, wie in Notfällen standardmäßig zu verfahren ist (Interaktion mit dem Veranstalter, Telefonlisten, Koordination der Gruppenbetreuung, etc.).
Eine systematische Risikoanalyse der geplanten Aktivitäten in Bezug auf Gruppe, Örtlichkeiten, Wetter, etc.
Eine angemessene Abfrage gesundheitlicher Einschränkungen bei den Teilnehmern.
Neben einem formellen Erste-Hilfe-Schein auch praktische Handlungskompetenzen. Wer draußen unterwegs ist, sollte zusätzlich Kompetenzen in Erste-Hilfe-Outdoor haben.
Ein für das jeweilige Programm angemessen ausgestattetes Erste-Hilfe-Set.
Eine gewissenhafte Aufarbeitung aller Unfälle, Beinahe-Unfälle, und relevanter Vorkommnisse, mit dem Ziel eines stetig ausgereifteren Präventions- und Sicherheitsmanagements.
Wer sich in diesen Bereichen noch nicht sicher fühlt, der ist dringend angehalten, sich entsprechend fortzubilden. In Hinblick auf SimpleThings ist unbedingt zu beachten, dass eine Begrenzung auf die Verwendung von Alltagsmaterialien körperliche und psychische Gefahren keinesfalls ausschließt!
In diesem Zusammenhang sei ebenfalls betont, dass man Übungen nicht einfach aus einem Buch o. Ä. übernehmen und unkritisch anwenden sollte (auch aus diesem nicht)! Stattdessen gilt der dringende Rat, sie entweder vorzutesten oder wirklich so viel Erfahrung mit Gruppen und erlebnispädagogischen Prozessen zu haben, dass man sich sicher fühlt, Abwandlungen und Experimente zu wagen, Gefahrenstellen zu antizipieren, und auch unvorhergesehene Wendungen in Lernsituationen zu einem positiven Lernzuwachs zu leiten.
Viel Erfolg!
Nach diesen wohl gemeinten Warnungen und Hinweisen wünschen wir allen Lesern nun viel Freude und Erfolg mit den in diesem Buch beschriebenen Übungen.
Wer Lust hat, auch selber Übungen zu entwickeln, der kann sich aus Leitfäden für Förster und Naturpädagogen, sowie aus Büchern mit einfachen Spielen (z.B. Hechenberger, Michaelis, & O’Connell, 2007; Frank & Eckers, 2007; Lehner, 2005; Mertens, 2005; Geissler & Butschkow, 2004; Köckenberger, 2004; Baer, 1997) Anregungen holen und oft durch einfache Veränderungen Kooperationsaufgaben und andere erlebnisorientierte Herausforderungen umwandeln lassen. Wie erlebnispädagogische Übungen systematisch und Ziel- bzw. Zielgruppen bezogen entwickelt werden können, ist an anderer Stelle ausführlich beschrieben (Hildmann, vorr. 2017; Hildmann & Moseley, 2012; Hildmann & Seuffert, 2010).
Rückmeldungen und Anregungen zur Verbesserung dieses Konzeptes sowie auch SimpleThings-Ideen oder Übungen, die Sie vielleicht kennen, sind jederzeit herzlich willkommen. Bitte an jule.hildmann@gmx.de.

Teil 1:
Naturnahe Räume

Park und Wiese
Park und Wiese
Einleitung
Parks sind großartige erlebnispädagogische Handlungsräume nahe oder gar inmitten der Stadt. Mit ihren Bäumen, Rasen- und Wiesenflächen, Wegen, Gebüschen und Gewässern sind sie äußerst vielseitig, bieten viele Vorzüge der Natur (Geräuscharmut, Naturmaterialien, etc.), und das alles ohne lange Anfahrtswege. Perfekt für SimpleThings.
Wiesen können als Teil von Parks oder davon unabhängig auftreten, z.B. als Obstwiese, Waldlichtung, Naturwiese, oder einfach unbestelltes Gelände mit Unkraut und Gestrüpp. Der Fokus liegt dabei auf der Vielfalt an Blumen und Gräsern, sowie ein relatives „Freisein“ von größeren Hindernissen wie Bäumen oder Gebäuden.
In diesem Kapitel gibt es für beide Räume etwas, und zudem vieles, was auch drinnen oder anderswo durchgeführt werden kann und im Park einfach ein schönes und wohltuendes Ambiente bekommt. Denn die gesundheitlichen und sozio-emotional positiven Auswirkungen eines Verweilens in der Natur und naturnaher Umgebung sind vielfach belegt (siehe z.B. Muñoz 2009). Im Park können wir davon gratis profitieren und dies als Bonus für den Lernerfolg verbuchen.
Spezielle Lernziele
Das schnelle Entfliehen aus einem städtischen Alltag fördert besonders Lernziele wie zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen. Außerdem bietet eine einfache Rasenfläche die Möglichkeit, nahezu alle Übungen aus dem Kapitel Seminar- und Gruppenräume anzuwenden, mit dem erwähnten Gratiseffekt der belebenden Grünfläche und frischen Luft.

Sicherheit und Rechtliches
In Parks ist neben der Parkordnung in erster Linie zu beachten, dass die Rechte anderer Nutzer gewahrt bleiben müssen. So sollten z.B. keine Fahrradwege mit Seilen überspannt werden, oder lebendige Gruppen-diskussionen am Zengarten stattfinden. Das Prinzip ist selbstverständlich und gerät doch manchmal im Trubel des Geschehens aus dem Blick.
Blumenwiesen im klassischen Sinne werden oft landwirtschaftlich genutzt und sollten daher nicht niedergetrampelt werden. Soweit sie nicht Teil von öffentlichen Parkanlagen sind, gehört es auch zum guten Ton, beim Besitzer vorab um Erlaubnis zu bitten. Sollte dieser schwierig ausfindig zu machen sein, können evtl. Forstamt oder Landratsamt weiter helfen.
Literaturempfehlung
Hechenberger, A., Michaelis, B., O’Connell, J.M. (2007). Bewegte Spiele für die Gruppe. Münster: Ökotopia.
Kaderli, M. Et al. (1998). Geländespiele. Spielprojekte für Stadt, Wald und Wiese. (2. Auflage) Luzern: Rex.
Muñoz, S.-A. (2009). Children in the outdoors. A literature review. Forres: Sustainable Development Research Centre.
Robra, A. (2001). Zauberstein und Riesenstab. Abenteuer-Rallyes für Kinder und Jugendliche. Seelze/Velber: Kallmeyer.
Siehe auch die Literaturhinweise in den Kapiteln Wald und Innenstadt.
Wiesenfenster
Kleingruppen bilden sich aus Stöcken ein Fenster auf dem Boden, suchen darin Details und entwicke ln damit eine Fantasiegeschichte.
Altersgruppe
Kinder, Erwachsene.
Gruppengröße
4 bis 12 Personen. Auch mit großen Gruppen durchführbar, dann die Geschichte (s. Schritt 6) mit jeweils maximal 3 Kleingruppen austauschen.
Material
Pro Teilnehmer eine leere Klopapierrolle als Fernrohr.
Raum
Wiese, Park, Wald, Waldrand. Stöcke sollten in der Nähe zu finden sein.
Themen
Natur erfahren, Gemeinsam kreativ sein, Wahrnehmung mit allen Sinnen, Aufmerksamkeitsfokussierung aufs Detail.
Ablauf und Regeln
Die Teilnehmer bilden Kleingruppen von 2 bis 4 Personen.
Jede Kleingruppe sammelt vier Stöcke mit je einem halben Meter Länge.
Anschließend markiert sich die Kleingruppe mit den 4 Stöcken je ein Wiesenfenster, an einer Stelle, die ihnen gefällt.
1 Wahrnehmungsanregung (Der Trainer geht jeweils von Gruppe zu Gruppe): Die Teilnehmer sollen sehend durch das Fernrohr ihr Wiesenfenster erkunden und ihre Beobachtungen mit der Kleingruppe teilen.
2 Wahrnehmungsanregung: Vorsichtig tastend, riechend und hörend das eigene Wiesenfenster erkunden und die Wahrnehmungen miteinander teilen.
3 Bewegungen aller Art im Wiesenfenster suchen und benennen.
4 10 „Dingen“ (Pflanzen, Tiere, etc.) im Fenster einen phantasievollen Namen geben.
5 Gemeinsam in der Kleingruppe eine (Helden-)Geschichte erfinden, in der die 10 Dinge vorkommen.
6 Präsentation der Geschichte für die anderen Kleingruppen.
Vorbereitung
Benutzung der Wiese klären und kurz vorher sichten.
Sicherheit
Teilnehmer-Gesundheitscheck (Pollen-/Gräserallergie und Umgang damit). Auf Zecken sowie auf Schutzmöglichkeiten davor und Umgang damit hinweisen.
Varianten
Wahrnehmungsanregungen variieren, z.B. mit dem Rohr hin horchen.
Die Dramaturgie der Geschichte vorgeben, z.B. ein Märchen erfinden, eine Tragödie, eine Liebesgeschichte, eine Fabel, eine spirituelle Weisheit, etc.
Auswertung
Würdigung der erfundenen Geschichten.
Was habe ich in der Wahrnehmung als besonders beeindruckend erlebt?
Was hat die Geschichte mit uns/unserem Thema zu tun?
Wie schenke ich den „kleinen Dingen im Leben“ Beachtung?

Der längste Grashalm
In diesem einfachen Wettkampf(spiel) versucht jeder, den längsten Grashalm der Welt zu finden.
Altersgruppe
Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
2 bis beliebig viele Personen.
Material
–
Raum
Wiese, Park, Waldrand, Bachufer, etc.
Themen
Bewusste Wahrnehmung der Natur, Achtsamkeit, Wahrnehmung schärfen, in Kontakt kommen, Warm-up, miteinander ins Gespräch kommen.
Ablauf und Regeln
Auf ein Kommando schwärmen alle aus und suchen sich einen Grashalm aus, von dem sie meinen, dass es der längste ist.
Jeder darf nur einen Grashalm ausreißen!
Wenn alle zurück sind, wird verglichen, indem sich die Teilnehmer in Reihenfolge der Länge ihrer Grashalme im Halbkreis aufstellen sollen.
Dem Sieger wird gratuliert. Als Preis bekommt er einen „Grashalmstrauß“ (natürlich aus den Gräsern der anderen Teilnehmer.
Vorbereitung
Keine.
Sicherheit
Gelände auf Gefahrenquellen (Verkehr, Gewässer, Abhänge, etc.) überprüfen, Handlungsradius entsprechend abgrenzen.
Varianten
Der kleinste Stein.
Das längste Schilf (am Wasser).
Den längsten und den kürzesten Grashalm finden.
Auswertung
Was hat dich erstaunt?
Was hast du während deiner Suche noch entdeckt?
In welcher Situation warst du schon mal der Größte?
In Kleingruppen mit den Grashalmen Bilder legen oder Antworten auf Impulsfragen geben.

Flugsimulator
Flugzeuge im Blindflug müssen von ihren Lotsen möglichst schnell und sicher zum Flughafen gelenkt werden.
Altersgruppe
Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
8 bis 16 Personen.
Material
Papier (z.B. Moderationskarten), Schals/ Tücher/Augenbinden, Seile o. Kreide, vier dicke Stifte in verschiedenen Farben (z.B. rot, gelb, grün, blau).
Raum
Park, freie Fläche, drinnen oder draußen. Platzbedarf ca. 10x10m.
Themen
Effektive Kommunikation organisieren, Störfaktoren in der Kommunikation, Strategien abstimmen.
Ablauf und Regeln
Die Flugsicherung muss wegen dichten Nebels die Flugzeuge über Funk zum Boden steuern. Jede Fluggesellschaft versucht ihr Flugzeug am schnellsten am Boden zu haben.
Kleingruppen bilden und Fluggesellschaften (= Farben) zuteilen, z.B. gelb = Lufthansa, blau = Asia Airlines, rot = Air Canada, grün = New Zealand Wings.
Nur die Flugzeuge/blinden Piloten befinden sich in der Einflugschneise. Die Fluglotsen müssen außerhalb der Markierungen bleiben.
Die Piloten fliegen während der gesamten Zeit im Blindflug (= Augenbinden auf).
Die Flugzeuge dürfen nur über Koordinaten ihrer eigenen Fluggesellschaft (s. Farbe) vorrücken.
Flugzeuge, die die letzte Koordinate erreichen, sind gelandet und dürfen aussteigen (= die Augenbinde abnehmen).
Kollisionen sind von allen Beteiligten zu vermeiden. Flugsicherheit geht vor!
Die Flugzeuge befinden sich noch X Minuten in der Warteschleife (= Beratungszeit), danach beginnt der Landeanflug.
Vorbereitung
Mit Seilen oder Kreide wird die Einflugschneise (= rechteckiges Spielfeld) markieren.
Die Moderationskarten (= Koordinaten) werden farblich und/oder mit Zahlen gekennzeichnet und in Reihen auf der Flugschneise ausgelegt (siehe Abb.). Die Farbwege sollen sich dabei etwa gleichmäßig kreuzen.
Sicherheit
Auf ebenen Untergrund achten, etwaige Stolperfallen wegräumen.
Freiwilligkeit bei der Bestimmung der (blinden) Piloten beachten.
Die sehenden Fluglotsen greifen im Bedarfsfall ein, z.B. wenn ein irrgeleitetes Flugzeug (= blinder Teilnehmer) ein Hindernis ansteuert.
Varianten
Jede Fluggesellschaft hat zwei oder drei Flugzeuge, die möglichst schnell und sicher gelandet werden sollen.
Piloten sehen die Einflugschneise vor der Übung nicht, d.h. werden blind in den Raum geführt. Dies erschwert die Übung.
Mit Zeitvorgabe. Wem der Treibstoff (= Zeit) ausgeht, muss in der Einflugschneise notlanden. („Dank Einsatzbereitschaft und Kompetenz der Piloten sind alle Passagiere unverletzt“).
Zur Vereinfachung Landebahn verkürzen.
Auswertung
Einflugschneise zur Skalierung verwenden.
Wo brauche ich/brauchen wir manchmal Lotsen, weil ich irgendwie blind bin?
Welchen Hafen steuere ich an in nächster Zeit? Was oder wer kann mir helfen, dieses Ziel zu erreichen?
Idee
Teilnehmer eines SimpleThings-Seminars, 2011 an der Landjugendakademie Altenkirchen.

7 up
Im Sekundentakt werden Gegenstände in die Luft geworfen. Die Gruppe muss sich schnell und gut absprechen, damit nichts auf den Boden fällt.
Altersgruppe
Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
5 bis 15 Personen.
Material
Sieben Gegenstände, die man fangen kann ohne sich zu verletzen. Je skurriler die Gegenstände sind, desto lustiger wird die Übung. Es geht aber auch mit sieben gleichen Gegenständen, wie z.B. Tennisbällen.
Raum
Rasenfläche, Parkplatz, Seminarraum, Schulhof, Turnhalle, etc. Ausreichend freie Fläche, damit die Gruppe im Kreis stehen kann und jeder noch mindestens einen großen Schritt nach hinten Platz hat.
Themen
Schnell Absprachen erzielen, gut aufeinander eingespielt sein, Hand in Hand arbeiten, unter Zeitdruck Qualität erzeugen.
Ablauf und Regeln
Ziel ist es, alle sieben Gegenstände zu fangen, ohne dass einer auf den Boden fällt.
Ein Trainer hat die sieben Gegenstände bei sich und wirft im Sekundentakt einen nach dem anderen möglichst gleichmäßig in die Luft. Je nach Lernziel kann dies nach einer Beratungszeit oder unmittelbar nach der einleitenden Erklärung geschehen, um Zeitdruck zu erzeugen und Absprachen zu verkürzen.
Der Trainer zählt dabei laut mit: 1, 2, 3, …, 7!
Bei jeder neuen Zahl müssen alle vorherigen Gegenstände ebenso wieder in die Luft geworfen werden. Es wird also mit jeder Zahl und Sekunde ein Flugobjekt mehr.
Die Teilnehmer versuchen die Gegenstände zu fangen, und sie kontrolliert wieder hoch zu werfen.
Wenn ein Gegenstand herunter fällt, werden alle Flugobjekte eingesammelt. Das Team darf sich absprechen, falls es möchte, und es geht von vorne los.
Ein Gegenstand darf nicht zwei Mal hintereinander von der gleichen Person gefangen werden.
Vorbereitung
Material bereitstellen, Platz frei räumen.
Flugobjekte zum werfen könnten sein: Stofftier, Rolle Toilettenpapier, Hundespielzeug, Ball, Handschuh, Luftballon mit Gewicht drin, Päckchen Pasta, Kulturbeutel, verknotetes Handtuch usw…
Sicherheit
Möbelstücke, Rucksäcke, und ähnliches sollten weit genug aus dem Weg geräumt werden, damit niemand darüber stolpern oder sich daran stoßen kann.
Varianten
Bei Gruppen mit mehr als sieben Teilnehmern gilt zusätzlich, dass jeder Mitspieler mindestens einen Gegenstand gefangen (und ggf. geworfen) haben muss.
Als Gegenstände nur Wasserbomben nehmen – plus reichlich Vorrat haben. Dies ist natürlich nur wetterbedingt geeignet, dann aber ein Mordsspaß mit erhöhtem Ernstcharakter.
Nicht ein Trainer, sondern ein Teilnehmer wirft die Gegenstände. Dies lässt sich gut kombinieren mit:
Das Ziel ist, eine möglichst niedrige Gesamtzeit zu erzielen. D.h. die Gegenstände werden nicht mehr im Sekundentakt geworfen, sondern möglichst schnell hintereinander. Hierfür sollte „werfen“ verstanden werden als „in der Luft sein, ohne von jemand berührt zu werden“. Dies eröffnet völlig neue und kreative Lösungswege, z.B. einen sehr engen Kreis aus Akteuren, die sich die Gegenstände gegenseitig in die Hände fallen lassen. Der Trainer sollte dabei möglichst nur Zeitstopper und -ansager sein.
Auswertung
Wann funktioniert Zusammenarbeit am besten? (aufeinander achten, für den anderen denken, …)
Wie gut ist die Gruppe darin, schnelle Absprachen zu treffen? Wie wirkt sich Zeitdruck auf die Stimmung und den Handlungserfolg aus?
Was lässt sich aus dieser Erfahrung lernen?
Idee
Karl Rohnke. Vermutlich in einem seiner Bücher aus der Steinzeit der Kooperationsspiele zu finden. Siehe Literaturliste am Ende des Buches.
Weiterentwicklung: Jule Hildmann.

Papierthron
Aus nichts anderem als Toilettenpapier wird eine Konstruktion gebaut, die stabil genug ist, dass eine Person darin oder darauf sitzen kann.
Altersgruppe
Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
3 bis beliebig viele Personen.
Gut geeignet für Großgruppen.
Material
Mindestens 8 Rollen Toilettenpapier pro Kleingruppe. Gerne mehr!
Raum
Beliebig draußen oder drinnen. Im Freien sollte es trocken und nicht zu windig sein. Platzbedarf: ca. 10 m2 für jede Kleingruppe zum Arbeiten. Diese Arbeitsbereiche dürfen gerne auf dem Gelände verstreut sein, so dass die Gruppen sich während der Arbeitsphase nicht gegenseitig sehen.
Themen
Kooperation, logisches Denken, Hand in Hand arbeiten.
Ablauf und Regeln
Rahmengeschichte: Das Oberhaupt eines fernen Volkes kommt zu Besuch. Um ihn zu ehren, soll ein Thron für ihn gebaut werden. Da sein Volk sehr naturnah ist, dürfen nur die Blätter dieser bei ihm heimischen Pflanze (= Toilettenpapierrollen) verwendet werden.
Das Toilettenpapier darf beliebig eingesetzt und verarbeitet werden.
Keine weiteren Hilfsmittel sind erlaubt.
Diese Konstruktion darf zwischen zwei Stühle gebaut, von Teilnehmern gehalten werden, o. Ä., je nach Wunsch der Gruppe.
Vorbereitung
Ab 6 Teilnehmer Unterteilung in Kleingruppen.
Sicherheit
Die Thronbesteiger sollen ihre Ergebnisse vorsichtig testen und sich nicht hinein werfen und ggf. auf den Boden fallen. Gesunder Menschenverstand.
Varianten
Bei Großgruppen: Designwettbewerb für moderne Sitzmöbel. Ergebnisse werden in einer Ausstellung präsentiert.
Jede Kleingruppe darf sich ein zusätzliches Hilfsmittel von maximal Faustgröße (damit nicht einfach ein Stuhl, Stock, etc. genommen wird) suchen und einsetzen.
Auswertung
Würdigung kreativer Ideen.
Was war in Bezug auf Strategien, Kommunikation, Zusammenarbeit, etc. hilfreich, was nicht?
Erkenntnisse über Materialeigenschaften; Steigerung der Stabilität durch flechten, verknoten, usw.; Parallelen suchen zu Architektur, Natur, Ingenieurswesen.

Flitzebogen blind
Kleingruppen bauen zunächst Pfeil und Bogen, und versuchen danach einen blinden Teilnehmer darin anzuweisen, auf ein Zielfeld zu schießen.
Altersgruppe
Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
3 bis 20 Personen.
Material
Reißfeste Schnur, ein o. mehrere (Schnitz)Messer, Büsche o. Bäume mit geeigneten Ästen (z.B. Haselnuss), die abgeschnitten werden dürfen! Seile o. Ä. zur Markierung der Abschusslinie und des Zielfeldes.
Raum
Park, (Laub)Wald mit reichlichem Angebot an frischen Ästen.
Themen
Klare Kommunikation, Verantwortliches Handeln, Kreativität und Problemlösung, Physik.
Ablauf und Regeln
Die Kleingruppen schwärmen aus und suchen sich zwei Äste, die sie für Pfeil und Bogen für geeignet halten. Diese werden abgeschnitten und nach Bedarf Kerben, Muster, etc. hinein geschnitzt.
Mit der Schnur wird einer der Äste zu einem Bogen gespannt. Die Kleingruppen können dies selbst ausprobieren oder unter Anweisung der Trainer tun.
Währenddessen wird eine Abschusslinie markiert, sowie im Schussbereich ein Zielfeld, das die Schützen dann zu treffen versuchen.
Den Schussbereich darf (zunächst) niemand betreten.
Ein Teilnehmer pro Kleingruppe wird zum Schützen ernannt. Er/sie erhält eine Augenbinde. Nur diese blinden Schützen dürfen Pfeil und Bogen anfassen. Die sehenden Kollegen dürfen sie allerdings (verbal) lenken.
Alle Schützen schießen gleichzeitig oder nacheinander, und erst dann, und nach einem verabredeten Signal der Trainer (z.B. Trillerpfeife) betreten alle Kleingruppen das Schussfeld und sammeln ihre Pfeile ein.
Vorbereitung
Einweisung oder Voreinheit zum sicheren Umgang mit Schnitzmessern.
Sicherheit
Die Sicherheitsregeln müssen ganz klar erklärt und umgesetzt werden. Eine Visualisierung der Regeln (aufschreiben, Symbole, o. Ä.) empfiehlt sich.
Entweder Voreinheit zu sicherem Schnitzen, oder nur die Trainer benutzen das Schnitzmesser, und schneiden Kerben o. Ä. auf Anfrage der Kleingruppen.
Ggf. bleiben die Pfeilspitzen stumpf und dürfen nicht extra angespitzt werden.
Probeschießen ist nur im markierten Bereich, und nur in die vorgegebene Richtung erlaubt!
Niemand betritt den Sperrbereich ohne ein verabredetes Signal (z.B. Trillerpfeife) der Trainer.
Ggf. extra Wächter einführen, die das Schussfeld überwachen.
Bei größeren Gruppen ggf. zusätzliche Sicherheitswächter einsetzen.
Varianten
Äste sind bereits frisch geschnitten und liegen bereit.
Eine inhaltliche Einheit über Bau und Handhabung von Pfeil und Bogen wird vorgeschoben.
Einbau in eine Rahmengeschichte oder größere thematische Einheit zu Indianern, Robin Hood, diversen Physikthemen, etc.
Auswertung
Was war besonders spannend und weshalb? Wie gut wurden die Regeln eingehalten? Umgang mit Gefahr und Verantwortung, Berechnung der Flugbahnen etc.
Idee
Michael Varelmann, Anette Ulland, Martin Kotzarek, 2012 im SimpleThings-Seminar an der Landjugendakademie Altenkirchen.