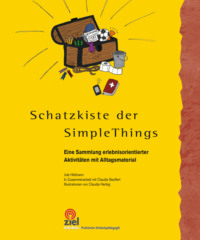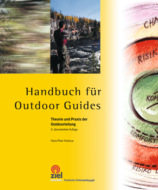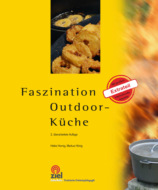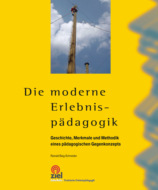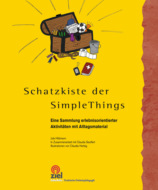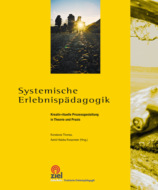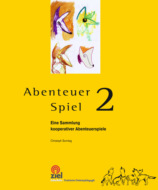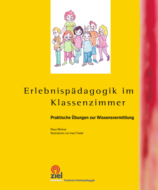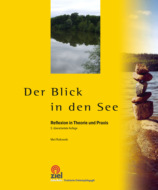Kitabı oku: «Schatzkiste der Simple Things», sayfa 3
Stocktanz
Die Teilnehmer werfen sich gegenseitig Stöcke so kontrolliert und achtsam zu, dass sie vom Partner gefangen werden können.
Altersgruppe
Kinder ab acht Jahre, Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
2 bis beliebig.
Material
Stöcke.
Raum
Park, Wald, überall soweit Stöcke verfügbar sind.
Themen
Nonverbale Kommunikation, Hand in Hand arbeiten, einen gemeinsamen Rhythmus und Handlungsfluss oder „Flow“ finden, Achtsamkeit, Geschicklichkeit.
Ablauf und Regeln
Die Teilnehmer stellen sich einige Meter voneinander entfernt auf.
Zunächst wird in Paaren gearbeitet. Es sollte reichlich Abstand zum nächsten Paar bestehen.
Die Partner werfen sich ihre Stöcke gleichzeitig gegenseitig zu und versuchen sie zu fangen.
Dazu gibt es mehrere Variationen, die in der Schwierigkeit ansteigen:
Stöcke senkrecht halten und werfen, so dass sie in dieser Position durch die Luft fliegen und gefangen werden können.
Stöcke so werfen, dass sie bis zum Partner genau eine halbe Drehung machen, der Partner also das Ende fängt, das vorher der Werfende in der Hand hielt.
Mit der rechten Hand werfen, mit der linken auffangen.
Usw.
Vorbereitung
Jeder Teilnehmer sucht sich einen armlangen Stock.
Sicherheit
Im Wald: Vorsicht bei unebenem Waldboden, dass niemand stolpert und stürzt.
Die Teilnehmer müssen ausreichend Verantwortungs- und Risikobewusstsein haben, um derart mit Stöcken zu hantieren.
Varianten
Weitere Steigerungsmöglichkeiten, sobald eine Variante gut (d.h. zielsicher) klappt:
Statt in Paaren zu dritt in einer Flechtbewegung oder in größeren Kreisen reihum werfen.
Die Teilnehmer stehen nicht, sondern bewegen sich im Raum umher, während sie die Stöcke einander zuwerfen.
Auswertung
Wie hat sich eure Aufmerksamkeit im Laufe der Übung verändert? Wie euer Verhalten? Woran liegt das?
Was sind die zentralen Punkte bei dieser Übung, damit sie funktioniert?
Wie lässt sich das auf eure sonstige Zusammenarbeit übertragen?
Idee
Jochem X.

Kopfüber kopfunter
Eine Person wird von den anderen einmal kopfüber um die eigene Achse gedreht.
Altersgruppe
ugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
8 bis 15 Personen.
Material
–
Raum
eliebig, drinnen oder draußen.
Themen
Getragen sein von den anderen, Vertrauen, Verantwortung übernehmen, klare Absprachen treffen und sich daran halten.
Ablauf und Regeln
Eine Person wird nach hinten kopfüber einmal um die eigene Achse gedreht, bis sie wieder aufrecht steht.
Dazu stellt sich eine Person in die Mitte der Gruppe, spannt den Körper an und macht sich komplett steif. Die Beine sind gerade und Füße zusammen.
Die Arme werden vor der Brust verschränkt, d.h. linke Hand auf rechte Schulter und umgedreht.
Es wird abgesprochen, welche Teilnehmer welche Hebe- und Stützposition einnehmen (s.u.), und jeder nimmt seine Position ein. Je mehr Teilnehmer beteiligt sind und mit anpacken, umso besser.
Auf ein Kommando lehnt sich die Person nach hinten, wo sie sofort von Händen berührt wird. Diese übernehmen mit zunehmender Schräglage eine Hebefunktion, bis die Füße der Person in der Luft schweben und sie waagrecht auf dem Rücken und auf/in den Armen der anderen liegt.
Dann wird ruhig und in kontrollierten Schritten (s.u.) die weitere Drehung vollzogen. Die Teilnehmer können zwischendurch ihre Positionen wechseln, sobald eine Position oder Funktion durch die Drehung nicht mehr erforderlich ist.
Empfindet die gedrehte Person Unbehagen, darf und sollte sie dies äußern und angemessen darauf reagiert werden (z.B. zusätzliche Teilnehmer als Stützen einbauen).
Ist die Drehung vollzogen und die Person nun waagrecht auf dem Bauch (in der Luft), werden ihre Füße langsam abgesetzt und der Oberkörper aufgerichtet, bis sie wieder von alleine steht.
Dann dürfen alle einmal verschnaufen, bevor die nächste Person an die Reihe kommt.
Stütz-/Hebepositionen und Abfolge der Drehung:Mind. zwei am Rücken und jeweils zwei, die am Gesäß und an den Beinen anheben, sobald sich die Person nach hinten lehnt.Möglichst eine am Kopf zur Stabilisation.Zwei, die unter die Schultern greifen, sobald die Person kopfüber gedreht wird.Zwei, die die Person im kopfüber-Moment stabilisieren und dann – beim vornüber absenken – die Beine in Empfang nehmen.Zwei, die den Bauch abfedern und heben.Zwei für den Oberkörper.Soweit weitere Teilnehmer vorhanden sind, werden diese außen herum positioniert und „spotten“, d.h. stehen in Schrittstellung und mit ausgestreckten Händen (Volleyballstellung) dicht an der Person bereit, um einen etwaigen Sturz abzufedern.

Vorbereitung
Evtl. Vorübungen zu Körperspannung, Körperkontakt, Vertrauen.
Sicherheit
Die Teilnehmer müssen wirklich konzentriert sein, sich ihrer Verantwortung bewusst sein, und bereit (kognitiv und von der Körperkraft her in der Lage) sein, diese wahrzunehmen.
Jeder Trainer sollte dies unbedingt zunächst selbst ausprobiert haben, bevor er es mit anderen durchführt.
Varianten
Rahmengeschichte: Neu entwickelte Raumanzüge müssen auf ihre Tauglichkeit in der Schwerelosigkeit getestet werden.
Auswertung
Wann hattest du ein gutes, wann ein mulmiges Gefühl? Was hat dir geholfen, dich sicher zu fühlen?
Wie war das Hand-in-Hand arbeiten? In wie weit fühlt sich das genauso oder anders an als euer sonstiges Miteinander?
Welche 10 Dinge haben in der Zusammenarbeit bereits sehr gut funktioniert?
Welcher Aspekt könnte noch verbessert werden?
Lobbyarbeit
Die Teilnehmer übernehmen die Rollen verschiedener Interessensgruppen, die über die Verwendung eines Naturraumes verhandeln.
Altersgruppe
Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
4 bis beliebig viele Personen.
Material
Requisiten nach Belieben, um Interessensgruppen zu symbolisieren (s.u.).
Raum
Beliebig in der Natur oder einem naturnahen Raum, z.B. Park. Eignet sich besonders für Orte mit einem Naturdenkmal.
Themen
Eigene Ziele und Prioritäten reflektieren, Meinungen anderen gegenüber vertreten, Meinungen anderer anhören und aushalten, Umgang mit Interessenskonflikten, Kompromisse und Synergien aushandeln.
Ablauf und Regeln
Die Stadt hat das Gebiet, auf dem die Gruppe sich befindet, zur Bebauung freigegeben.
Nun gibt es verschiedene Interessensgruppen, die über die Nutzung und ggf. Veränderung des Gebietet verhandeln.
Es werden (z.B. durch Verteilen symbolischer Utensilien wie Warnwesten, Fahrradhelm, etc.) verschiedene Rollen verteilt: z.B. Bund Naturschutz, Fahrradfahrer, Eltern, Senioren, Biologielehrer, Erlebnispädagogen, Politiker, sowie Gruppen mit passenden kommerziellen Interessen (je nach Gebiet).
Jeweils zwei Teilnehmer stellen gemeinsam eine Interessensgruppe dar.
Diese Paare überlegen sich, welche Wünsche und Argumente sie für die Nutzung des ausgeschriebenen Bereiches haben (z.B. Erholung, Naturschutz, Profit, Bildung) und wie sie diese am besten gegenüber den anderen vertreten können.
In Minikonferenzen treffen jeweils zwei Interessensgruppen, also vier Teilnehmer, aufeinander und diskutieren über die Zukunft des ausgeschriebenen Gebiets.
Nach ca. fünf Minuten gibt es eine kurze Pause, bevor neue Interessenskonstellationen aufeinander treffen.
Je nach Anzahl der Teilnehmer und Interessensgruppen werden zwei bis drei Runden von Minikonferenzen durchgeführt.
In einer abschließenden Plenumsrunde, dem „Stadtrat“, dürfen die Paare kurz ihre ursprünglichen und ggf. aktuellen Nutzungsanträge zusammenfassen. Dabei wird besonders auf Synergieeffekte und gemeinsame Nutzungskonzepte geachtet. Es erfolgt eine Abstimmung oder Vertagung des Beschlusses.
Vorbereitung
Requisiten für verschiedene Rollen beschaffen.
Sicherheit
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Varianten
Die Übung findet komplett im Plenum statt. Die Interessenspaare besprechen ihre Wünsche und Argumente, und tragen diese in einer zwei minütigen Rede oder Präsentation im „Stadtrat“ vor. Anschließend kann offen diskutiert oder in Einzelgesprächen nach Allianzen gesucht werden, bevor ein Beschluss mittels Abstimmung angestrebt wird.
Auswertung
Haben bzw. wie haben die Minikonferenzen eure Meinungen, Wünsche und Prioritäten verändert?
Welche Verhandlungs- und Gesprächsstrategien habt ihr verwendet, und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Welche grundlegenden Einsichten über den Umgang mit Interessenskonflikten könnt ihr – (a) allgemein und (b) für eure Gruppe – ableiten?

Frösche und Schlangen
Schnelles Fangenspiel, das zur Zusammenfassung und Wissensabfrage eines Themenblocks eingesetzt werden kann.
Altersgruppe
Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
4 bis beliebig viele Personen.
Ab 20 Teilnehmer sollten es mehrere Trainer sein, um den Überblick zu behalten.
Material
Spielfeldmarkierungen, Fragen.
Raum
Rasenfläche, Fußballfeld, Parkplatz oder sonstige freie Fläche, Turnhalle, breiter Gang, breiter Feld-/Waldweg. Platzbedarf: Ebene Fläche, ca. 20 m lang und 10 m breit, Mittellinie und Seitenlinien (mittels Seil, Blätter, Kreide, Stock, Bäume, Weg, etc.)
Platz zum Rennen, Fangen und Auslaufen.
Themen
Auswertung einer Aktion, miteinander in Kontakt treten, Bewegung, spielerisches Abfragen von Wissen.
Ablauf und Regeln
Zwei Gruppen stehen sich im Abstand von 1,5 bis 2 m in zwei Reihen gegenüber: Schlagen und Frösche.
Ein paar Meter hinter ihnen sind parallel zur Personenreihe Außenlinien markiert. Es gibt also vier parallele Linien: zwei in der Mitte mit den Schlangen auf der einen und den Fröschen auf der anderen, die sich ansehen. Und nach hinten die Außenlinien.
Der Spielleiter macht Aussagen, die teils richtig, teils falsch sind.
Ist eine Aussage richtig, so fangen die Schlangen die Frösche (wie im richtigen Schlangen-Frösche-Leben auch). Ist sie falsch, fangen die Frösche die Schlangen.
Wer vor der jeweiligen Außenlinie gefangen wird, wechselt zur anderen Tiergruppe. Die Übung endet, wenn die gesamte Art eines Tieres gefangen wurde oder wenn eine bestimmte Anzahl von Fragen gestellt wurde.
Als Abschluss der Übung kann der Trainer eine doppeldeutige Frage stellen, so dass die Antwort richtig oder falsch sein kann und Frösche und Schlangen sich mit großem Gelächter beide fangen, z.B. „Frösche und Schlangen bewegen sich gerne“.
Vorbereitung
Spielfeld markieren: zwei Mittellinien und zwei Außenlinien
Markierung mit Seilen, Steinen als Eckpunkte, etc.
Sicherheit
Der Auslauf der Teilnehmer muss ermöglicht werden (keine Abgründe oder Mauern).
Stolperfallen wie Stöcke, Steine, etc. sind zu entfernen.
Vorsicht bei rutschigem Gras oder Laub.
Varianten
Je nach Zielgruppe und Thema anderen Übungsnamen verwenden, z.B. Frösche und Störche. Fuchs und Hase, David und Goliath, etc. Wortpaare wählen, mit denen die Teilnehmer sich eher identifizieren oder die zum momentanen Thema gut passen.
Fragen stellen, die Wissen abfragen, das vorab behandelt wurde. Fragen stellen, die auf ein kommendes Thema vorbereiten, den Einstieg schaffen.
Den Spielleiter durch die Person ersetzen, die zuerst gefangen wurde.
Jeden Teilnehmer eine Frage stellen lassen (z.B. ähnlich einer Morgenrunde).
Auswertung
In welcher Rolle hast du dich wohler gefühlt? (Frosch, Schlange, Fangen, Gefangen werden, Fragen stellen, …)
Wie zufrieden warst du mit dir?
Welche Metaphern oder Vergleiche fallen dir zu deinem eigenen Leben ein?
Eine Übung, die als Warm up oder Reflexionsmethode verwendet wird und dann eher keine
separate Reflektion mehr braucht.


Wald
Wald
Einleitung
Wälder sind insofern genial für erlebnispädagogisches Arbeiten, weil sie in Deutschland nie weit weg sind und mit einfachen Mitteln das Gefühl von Wildnis bieten können, das in der Forschung über Erlebnispädagogik als entscheidender Faktor für den Lernzuwachs der Teilnehmer betont wird (Hattie et al., 1997; Ewert & Sibthorp, 2014). Denn die Natur bietet dem Menschen seit Beginn unserer Zeit Herausforderungen. Früher waren diese entscheidend für das Überleben, z.B. Schutz vor Kälte und Unwettern zu finden, Feuer zu machen oder Nahrung zu beschaffen. Die Anfänge der Erlebnispädagogik haben stark auf diese ursprünglichen Herausforderungen zurückgegriffen. Selbst heute gibt es noch Überlebens- und Wildnistrainings, aber die meisten erlebnispädagogischen Outdoorkurse haben nicht mehr viel damit zu tun. Die Wachstums- und Lernchancen in der Natur, und eben auch schon im heimischen Wald, sind allerdings immer noch grenzenlos. Allein sich in der Natur aufzuhalten – inklusive städtischer Grünflächen übrigens – hat bereits gesundheitsund wachstumsfördernde Wirkung (Muñoz 2009, Becker 2014; Mygind 2007; O’Brien & Murray 2005), derer wir uns – sozusagen als Bonuseffekt – erfreuen können.
Neben der Begegnung mit der Natur als urtümlichem Bewährungsfeld und den vielschichtigen Metaphern, die uns der Wald zur Reflexion über das Leben und alltägliche wie kosmischen Zusammenhänge bietet, sind in diesem Kapitel auch Aktivitäten beschrieben, bei denen – in Abgrenzung zu Park und Wiese – vornehmlich Bäume, Blätter und Waldboden als Arbeitsmaterial genutzt werden.
Josepf Cornell (Cornell, 2006) entwickelte ein inzwischen weit verbreitetes und bewährtes Modell für die Naturpädagogik mit vier Phasen: (1) Begeisterung wecken, (2) konzentriert wahrnehmen, (3) unmittelbare Erfahrung, und (4) andere teilhaben lassen. Anhand dieser können selbst nicht für die Natur Begeisterte schrittweise in einen Sog der Faszination und bewussten Wahrnehmung hin zu unmittelbaren und tiefgreifenden Naturerlebnissen geführt werden. Eine Verbindung mit erlebnispädagogischen Lernzielen erfolgt nahezu automatisch. Die Auswahl der hier vorgestellten Übungen deckt alle vier Phasen ab.
Spezielle Lernziele
Wie bereits angeklungen, können im Wald die ursprünglichen Herausforderung des alltäglichen Lebens wie Nahrungsbeschaffung, kochen, ein Lager bauen, schlafen oder Hygiene genutzt werden, und zwar vornehmlich zur Förderung von Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Problemlösekompetenz, Kooperation und Umgang mit eigenen Grenzen. Die stille Betrachtung der Natur bietet Gelegenheit zur intensiven Auseinandersetzung mit persönlichen Themen wie z.B. dem eigenen Lebensweg, Entscheidungs- und Sinnfragen oder der Suche nach inneren und äußeren Ressourcen. Auch LandArt-Aktivitäten (d.h. Kunst in und mit der Natur bzw. Naturmaterialien) haben Potenzial für vielfältige Lernziele. Für Literaturanregungen zum Thema LandArt siehe Bestle-Körfer und Stollenwerk (2010), sowie Eckmann et al. (2003), Goldsworthy (1995), Günthler et al. (2001), Güthler und Lacher (2007), Jagenlauf und Michl (1997), Kahtke (2014), Mertz und Kleinhanß (1999a und b) und Pouyet (2008) im Literaturverzeichnis am Ende dieses Buches.

Sicherheit und Rechtliches
Die meisten Wälder in Deutschland sind der Öffentlichkeit frei zugänglich, und wir alle haben das gleiche Recht, uns darin zu bewegen und zu erholen. Dennoch gibt es Regeln und Vorschriften, die aus Rücksicht und zu unserer eigenen Sicherheit einzuhalten sind.
Soweit möglich, sollte das Waldstück, in dem Sie sich mit ihren Teilnehmern aufhalten wollen, vorab einmal begangen und dahingehend geprüft werden, ob von der Bodenbeschaffenheit (Löcher, über die man stolpern könnte, Abhänge, etc.), der Vegetation (giftige Pflanzen, Dornen, tief hängende oder spitze Äste, Wurzeln, etc.) oder aus anderen Gründen (Hinweise auf Schutzräume für Tiere, Waldarbeiten, etc.) Gefahren bestehen, die Schutzmaßnahmen oder Planänderungen erfordern.
Aktivitäten, bei denen wir still im Wald sitzen oder liegen, sollten mit Warnwesten durchgeführt werden, besonders, wenn sie in die Dämmerung und Dunkelheit hinein gehen. Auch sollte unbedingt vorher Kontakt mit dem zuständigen Förster bzw. Jagdpächter aufgenommen werden. Zum einen, um Schon- und Brutzeiten zu respektieren, zum anderen aber auch zur eigenen Sicherheit.
Solide Outdoor-Erste-Hilfe Kompetenzen und ein entsprechender Notfallplan gehören zu einem guten Sicherheitsmanagement bei erlebnispädagogischen Veranstaltungen im Wald.
Zur Trainerausrüstung für solche Maßnahmen gehören unter anderem ein outdoortaugliches Erste-Hilfe Set, ein aufgeladenes Handy (mit eingespeicherten Notrufnummern), Trillerpfeife, je nach Witterung Wärmequellen wie Decke und/oder Tee, eine Stirnlampe oder andere Lichtquelle, ggf. Karte und Kompass und bei Bedarf Warnwesten.
Sicherheit bezieht sich nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Umwelt. Daher sollte vorab ermittelt werden, ob für das Gelände besondere rechtliche Vorgaben gelten (Naturschutzgebiet, Fledermausschutz, Jagdvorgaben, etc.). Soweit dies der Fall ist, sind entsprechende Genehmigungen einzuholen (bei Förster, Gemeinde, Naturschutzbehörde, Veterinäramt, etc.) und ist sich mit dem zuständigen Besitzer oder Pächter des Geländes in Verbindung zu setzen.
Wer eine ungekennzeichnete Feuerstelle einrichten möchte, braucht dafür vielerorts eine Erlaubnis (z.B. vom Landratsamt, der oberen bzw. unteren Naturschutzbehörde, und dem Grundstückseigentümer oder Pächter) und muss entsprechende Vorgaben einhalten. Im Wald ist mit Fackeln, Zigaretten und sonstigen Feuerquellen wegen Waldbrandgefahr besondere Vorsicht geboten und bei entsprechenden Warnstufen komplett darauf zu verzichten.
Literaturempfehlung
Berthold, M. & Ziegenspeck, J. W. (2002). Der Wald als erlebnispädagogischer Lernort für Kinder. Lüneburg: Verlag Edition Erlebnispädagogik.
Bestle-Körfer, R., Geißelbrecht-Taferner, L., et al. (2012). Naturspiele-Hits. Münster: Ökotopia.
Cornell, J. (2006). Mit Cornell die Natur erleben. Der Sammelband. Naturerfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche. Mühlheim: Verlag an der Ruhr.
Güthler, A. & Lacher, K. (2007). Naturwerkstatt Landart – Ideen für kleine und große Naturkünstler. (4. Auflage) Baden, München: AT Verlag.
Hemming, A. & Heinlein, K. (2015). Sternstunden im Wald: Den Wald von Frühling bis Winter mit Kindern fantasievoll erleben und erkunden. (4. Auflage) Münster: Ökotopia.
Saudhof, K. & Stumpf, B. (2009). Mit Kindern in den Wald. Wald-Erlebnis-Handbuch. Planung, Organisation und Gestaltung. (14. Auflage) Münster: Ökotopia Verlag.
Spaziergang in drei Schritten
Beim Laufen werden drei Impulse an die Gruppe gegeben, um die bewusste Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der Umgebung/Natur anzuregen.
Altersgruppe
Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
Gruppengröße
2 bis 30 Personen.
Material
Keines.
Raum
Waldweg, Pfad, o. ä. Diese Übung ist gut geeignet für den Weg zum Veranstaltungsort hin.
Themen
Einstieg, Ankommen, warm werden mit der Umgebung/Natur, erstes Kennenlernen, Wahrnehmungsübung, Gedankenaustausch, Selbsterfahrung.
Ablauf und Regeln
Die Teilnehmer werden zu einem kleinen Spaziergang eingeladen. Für jeweils etwa ein Drittel der Strecke erhalten sie einen Impuls. Nach jedem Wegdrittel findet eine kurze Austauschrunde statt, bevor für den nächsten Wegabschnitt ein neuer Impuls gegeben wird:
1 Schweigend gehen und die Farben und Farbspiele auf sich wirken lassen. Austauschrunde: Welche Farbe ist mir besonders aufgefallen/ins Auge gestochen/ fand ich besonders schön?
2 Schweigend gehen und nach Geräuschen und evtl. deren Geschichten lauschen. Austauschrunde: Welches Geräusch hat mich am meisten bewegt/war mir am vertrautesten? Welche „Geschichten“ hast du gehört?
3 Mit einem Partner beim Laufen über die Frage sprechen: Was bedeutet Natur für mich? Austauschrunde: Einen Gedanken vom Partner, der mir besonders im Gedächtnis ist/ bei mir etwas ausgelöst hat, mit der Gruppe teilen.
Vorbereitung
Geeignete Wegstrecke und zwei Haltepunkten unterwegs auswählen. Sollte der Weg Gefahrenstellen aufweisen, müssen in der Vorbereitung oder Anmoderation entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, z.B. eine gute Beschilderung oder Unterstützung durch weitere Trainer.
Sicherheit
Die Teilnehmer müssen wetterentsprechend gekleidet sein und festes Schuhwerk tragen.
Soweit möglich, den Treffpunkt klar absprechen.
Gesundheitliche Einschränkungen der Teilnehmer abfragen.
Varianten
Als Themeneinstieg eine Textstelle einbinden, z.B. im spirituellen Kontext für den ersten Wegabschnitt die Bibelstelle Gen1,11f: „Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war“. Auswertungsfrage: Was hast du Gutes gesehen?
Zu zweien gehen und dabei austauschen über die Frage: Was bewegt dich in der Natur?
Auswertung
Die Auswertung findet in den Austauschpausen während des Spaziergangs statt.
Idee
Roger Greenaway, Claudia Seuffert.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.