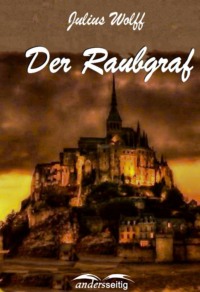Kitabı oku: «Der Raubgraf», sayfa 5
Sechstes Kapitel.
An demselben Tage waren die sechs Brüder Grafen von Regenstein alle beieinander versammelt. Ulrich, der dritte in der Reihe und Domherr zu Hildesheim, war bei Bernhard, dem einzigen Verheirateten, auf der Heimburg abgestiegen; Poppo, der in dem für unüberwindlich geltenden Crottorf befehligte, hatte sich mit Günther auf dem Regenstein einquartiert, wo auch der Jüngst, Siegfried, noch sein heimatliches Obdach hatte.
Wohl hatten sie über die kürzlich im Harzgau vorgefallenen Ereignisse schon gesprochen, aber das war es nicht, was die getrennt hausenden Brüder heute vereinigte. Das Friedvollste, was es auf Erden gibt, eine Totenfeier, führte sie zusammen. Sie wollten den Todestag ihres Vaters, des Grafen Ulrich, der ihnen allen ein Vorbild ritterlicher Tugend und Tapferkeit gewesen war, zu seinem ehrenden Gedächtnis festlich begehen, wie sie es alljährlich auch zum Andenken der früher verstorbenen Mutter zu tun pflegten.
Ziemlich in der Mitte zwischen der gewaltigen, steil aufragenden Felsmasse des Regensteins und dem die Heimburg tragenden Bergkegel, aber seitwärts als dritter Punkt eines fast gleichseitigen Dreiecks lag in einem stillen, lieblichen Waldtal lauschig und versteckt Kloster Michaelstein. Es war von der Äbtissin Beatrix von Quedlinburg vor zweihundert Jahren gegründet, und vor etwa sechzig Jahren war ein Graf Ulrich von Regenstein Abt des Klosters gewesen, in dessen gottgeweihtem Frieden schon ganze Geschlechter dieses edlen Grafenhauses im ewigen Schlafe ruhten.
Dort in dem steingrauen Kirchlein hatte der würdige Abt heut eine feierliche Seelenmesse für den seligen Grafen gelesen, und nun knieten die sechs Brüder mit Reginhild, Bernhards Gemahlin und Tochter des Grafen Burchard von Mansfeld, im Kreuzgang vor den Grabsteinen ihrer Eltern. Hinter ihren Herren, in gebührlichem Abstand, lagen die vertrautesten ihrer Dienstmannen auf den Knien, und weit zurück stand der greise Abt vor der Schar seiner Mönche, mit gefalteten Händen der stillen Andacht der kleinen ritterlichen Gemeinde regungslos zuschauend.
Die beiden Grabsteine des gräflichen Elternpaares standen über der Gruft aufrecht an der Mauer nebeneinander, mit dem ihres jungen Sohnes Otto die letzten in der Reihe von zahlreichen ähnlichen ihrer Ahnen. Jeder zeigte das in Stein gehauene Lebensgroße Bild des Abgeschiedenen, eingefasst von einer am Rande hinlaufenden Inschrift.
Graf Ulrich war in voller Rüstung mit Wehr und Waffen dargestellt, im rechten Arme den hohen Stechhelm mit Kleinod und Helmdecke, zur Linken den kleinen dreieckigen Schild mit der vierendigen Hirschstange, und ebenso wie seine Gemahlin auf einem Hunde stehend. Gräfin Bia, eine geborene Gräfin von Kefernburg, war in ein lang herabfließendes Gewand und einen weiten, faltigen Mantel gehüllt, trug um Haupt und Kinn das Gebände geschlungen und hielt in den auf der Brust zusammengelegten, mit den Fingern nach oben gekehrten Händen einen Rosenkranz.
Der stille Klostergarten, mit Kreuzen bepflanzte Friedhof der Mönche, lag halb noch im Schatten, halb schon in der Morgensonne, die mit ihrem goldenen Lichte die Säulen und Säulchen der Hälfte des Kreuzganges beschien, schräge und rundbogige Schatten auf seinen Steinboden werfend. Aus dem Garten duftete der Frühling in die kühle Wölbung hinein, die Sträucher hatten junge Blätter, und zwischen den Gräbern blühten die Veilchen. Tiefes Schweigen herrschte; man hörte nichts als dann und wann das leise Klirren einer Schwertfessel oder eiserner Sporen eines der Betenden.
Endlich machte Graf Albrecht eine Bewegung. Er bot der neben ihm knieenden Reginhild die Hand, und sich darauf stützend erhob sich die Gräfin von dem ausgebreiteten Teppich, welchem Beispiel alle übrigen folgten. Die Mönche stimmten einen Gesang an und geleiteten mit dessen sanften Klängen die den Kreuzgang langsam hinabschreitenden Herren und Mannen mit vor die Pforte des Klosters. Dort wurden die von Knechten gehaltenen Rosse bestiegen, und der Reiterzug begab sich auf den Regenstein, wo die Familie den Feiertag mit einem gemeinschaftlichen Mahle würdig beschließen wollte.
Als mittags die sieben den gastlichen Tisch des Ältesten von ihnen umringten, erhob sich dieser und weihte dem Andenken des geliebten Vaters einen Minnetrunk in Sankt Johannis Segen. Dann sprachen sie von dem Geschiedenen und wurden seines Ruhmes nicht müde, wie sie sich einzelne Züge seines tatenreichen Lebens erzählten und sich von ihm gesprochener Worte erinnerten. Dabei gelobten sie sich laut und leise, in seinen Fußstapfen zu wandeln, die von ihm hinterlassene Macht zu verteidigen und zu halten und in Lust und Leid zusammen zu stehen bis in den Tod.
Die kleine Tafelrunde in dem gepflasterten Saale, dessen Wände Hirschgeweihe und andere Jagdstücke, Waffengehänge und Rüstungen verstorbener Ahnherren schmückten, bot ein herzerfreuendes Bild. Da saßen um eine einzige, vornehme und liebliche Frau sechs hochgewachsene, heldenkühne Männer, denen ein wagelustiger Sinn auf der Stirn geschrieben stand und aus deren Blicken eine selbstbewusste, trotzige Kraft sprach. Bernhard, der Zweitälteste, stand dem Erstgeborenen in der Regierung der Grafschaft treu zur Seite, und seine zügelnde Gemessenheit, sein stets bedachtsamer Rat war dem ungestümen Tatendrang des Ältesten gegenüber von großem Wert. Auch der Dritte, Ulrich, der nicht aus freier Wahl in den geistlichen Stand getreten, sondern nur der frommen Meinung der Mutter, von sieben Söhnen wenigstens einen dem Dienste der Kirche widmen zu sollen, gefolgt war, konnte in dem Gewande des Domherrn doch nicht das Blut des Ritters verleugnen, wie er denn auch den von Jugend auf gewöhnten und geliebten ritterlichen Übungen nicht ganz zu entsagen vermochte. Die drei Jüngsten, Poppo, Günther und Siegfried, waren junge Reckengestalten, denen die Kämpfe, die sie schon gesehen oder selber mitgeführt, eine früh ausgeprägte Selbständigkeit und Reife verliehen hatten. Nur Siegfried war mit seinen zwanzig Jahren fast noch ein Jüngling, blühend schön, stark und feurig, der Liebling aller, die ihn kannten, insonderheit der Frauen. Ein warmer, sonniger Glanz lag auf seiner ganzen Erscheinung; wen er nur anblickte, und zu wem er sprach, der fühlte unwillkürlich, dass in dieser jungen Brust ein tapferes, stürmisches, kühn hoffendes Herz schlug.
Nach beendetem Mahle griffen Poppo und Günther zum Schachbrett, während sich Reginhild und Siegfried zu einem heiteren Geplauder in die tiefe Fensternische zurückzogen und die drei ältesten Brüder noch bei einem Nachtrunk am Tische sitzen blieben und über ernste Dinge sprachen.
Ulrich berichtete, dass ihm kürzlich bei einem Besuch in Halberstadt von einem befreundeten Domherrn eine Warnung vor der Rachsucht des Bischofs zugegangen sei, der zum Dompropste bedrohliche Äußerungen getan und weitgehende Pläne zur Bekämpfung der Regenstein'schen Macht verraten habe.
»Das glaub' ich wohl,« sprach Albrecht. »Der Handel mit Emersleben liegt ihm im Magen. Hast du etwas Näheres darüber erfahren?«
»Nein,« erwiderte Ulrich, »mehr war aus meinem Freunde nicht herauszubekommen. Mir wollte es scheinen, als wenn zwischen dem Bischof und der Stadt Quedlinburg irgend etwas im Gange wäre.«
»Wundern sollte es mich nicht, wenn sich die zwei gegen uns verbündeten,« sagte Albrecht. »Der Bischof sucht überall seine Macht zu stärken, nur um sie gegen uns zu brauchen.«
»Sollte man nicht vielleicht durch eine scharfe Frage von den beiden Quedlinburgern etwa herausbekommen, die du in den Felsenkammern liegen hast?« meinte Bernhard.
»Ich habe sie diesen Morgen freigelassen, dem heutigen Tage zu Ehren,« entgegnete Albrecht. »Die hätten auch nichts gewusst.«
»Was willst du aber tun angesichts der starken Befestigungen, die der Bischof in Wegeleben aufführen lässt?« frug Bernhard.
Graf Albrecht schwieg.
»Wollt Ihr nicht Harsleben und Ditfurt befestigen, um Wegeleben in die Mitte zu nehmen und unschädlich zu machen?« frug auch der Domherr.
»Nein,« sprach Albrecht, »ich weiß Besseres.« Die Brüder blickten ihn erwartungsvoll an, und er fuhr fort: »Wir müssen die Lauenburg haben!«
»Die Lauenburg!« wiederholte Bernhard erstaunt, »Albrecht! wir haben kaum Burg Gersdorf an uns gebracht! Und die schon gönnen sie uns nicht!«
»Lass doch die Neidlinge sich boßen!« lachte der Ältere. »Geschenkt kriegen wir nichts; wir müssen zugreifen, wenn wir etwas haben wollen.«
»Und – die Äbtissin?« frug Ulrich.
»Sie hat mir versprochen, die Lauenburg nicht hinter meinem Rücken zu vergeben.«
»Und wenn sie nicht Wort hält?« wandte Bernhard ein.
»Jutta hält Wort,« sagte Graf Albrecht sehr bestimmt.
»Er muss es ja wissen, Bernhard, wie er mit seiner schönen Freundin steht,« lächelte der Domherr. »Ich sehe Jutta doch noch als gebietende Herrin auf dem Regenstein.«
»Dränge mich nicht, Ulrich! Ich tauge schlecht zum Werben und Freien,« sprach Albrecht. »Lasst mich unsere Grenzen noch tüchtig ausrecken im Lande und für den Besitz sorgen, für unseres Stammes Blüte sorgt Bernhard schon, und da sind noch drei, die unseren Namen längern werden,« fuhr er fort, auf die drei jüngeren Brüder deutend.
Die Grafen Ulrich und Bernhard blickten sich lächelnd an, schwiegen aber, und Albrecht entwickelte ihnen nun die Bedeutung der Lauenburg und die Notwendigkeit, sie als Lehen zu besitzen.
Einen von dem dieses Gespräches sehr verschiedenen Inhalt hatte die Unterhaltung Reginhilds mit Siegfried in der Fensternische.
Die junge Frau bog ihr blühendes Antlitz mit einem schalkhaften Lächeln zu ihrem noch jüngeren Schwager hinüber und lauschte aufmerkend, als wenn sie sie zum ersten Male hörte, seiner begeisterten Schilderung eines Turniers in Ballenstedt, bei dem er vom Fürsten Bernhard zum Ritter geschlagen war, an dem aber Reginhild nicht teilgenommen hatte, weil sie damals Wichtigeres zu tun hatte, nämlich ihrem Gatten das zweite Söhnchen zu schenken.
Seine Erzählung spitzte sich auf einen Glanzpunkt, auf den Augenblick zu, wo ihm eine zarte, jungfräuliche Hand einen Turnierdank gereicht hatte. Es war ein grüner Kranz von Eichenlaub und Efeu gewesen, von einem goldgestickten Bande umschlungen, den diese Hand selber gewunden und auf das blondgelockte Haupt des glückselig Knieenden gedrückt hatte. Jetzt hing er welk und braun in Siegfrieds Schlafkammer zu Häupten seines Lagers, und wenn der junge Ritter die Augen aufschlug, so fiel sein erster Blick auf dieses bescheidene Siegeszeichen. Aber dann erwachte auch eine heiße Sehnsucht in ihm, die wiederzusehen, die ihn mit dem Kranze geschmückt hatte.
»Dunkelbraunes Haar und hellblaue Augen! Reginhild, ich frage dich, hast und schon je etwas so wunderbar Schönes gesehen?« schwärmte Siegfried.
Und Reginhild beteuerte halb lachend, halb ernsthaft: »Niemals, Siegfried, habe ich das gesehen noch je davon gehört. Und du hast das Fräulein seitdem nicht wiedergesehen?«
»Nein,« seufzte der Jüngling und blickte die Schwägerin wehmütig an.
»Aber warum bist du nicht längst einmal hinübergeritten?«
»Wohin soll ich denn reiten? ich weiß ja nicht Namen, nicht die Burg der Vielholden!«
»Hast du denn niemand gefragt?«
»Nein; aber weißt du, was ich möchte, Reginhild?«
»Nun?«
»Satteln, aufsitzen und das ganze Harzland abreiten von Burg zu Burg, bis ich sie gefunden hätte,« rief Siegfried leuchtenden Blickes.
»Und dann?«
»Und dann? nun – dann wieder vor ihr knien und in die hellblauen Augen, in die wunderbaren Augen meiner Lilie schauen, was sonst?«
»Deiner Lilie?«
»So nenne ich sie,« sagte der Jüngling errötend, »um ihr doch einen Namen zu geben, und weil sie Wangen wie die Lilie hat.«
»Wie alt ist sie denn wohl?« frug Reginhild, um einen Anhaltspunkt mehr zur Ermittlung der Unbekannten zu gewinnen.
»Ein bis zwei Jahr jünger als ich,« erwiderte Siegfried, »mir ist, als sähe ich sie vor mir, – aber mich wird sie wohl längst vergessen haben.«
»Wer weiß, Siegfried! wer weiß!« lächelte die Burgfrau. »Wir müssen suchen, bis wir sie gefunden haben.«
Nun rieten sie die Adelsfamilien der nächsten Gaue durch. Aber umsonst; Reginhilds Beschreibung dieses oder jenes Fräuleins wollte immer nicht recht mit dem Bilde stimmen, das Siegfried so lebendig im Herzen trug. Besonders die hellblauen Augen zu dunkelbraunem Haar machten Schwierigkeiten, und Reginhild musste lachend eingestehen, dass sie nicht einmal die Farbe der Augen ihrer besten Freundinnen angeben konnte.
»Schach! Schach und matt!« rief plötzlich Günther so überlaut, dass die beiden in der Fensternische erschreckt auseinander fuhren und auch die älteren Grafen sich nach den Hitzköpfen am Schachbrett umschauten.
»Matt, matt! hilft nichts!« wiederholte der Sieger dem immer noch auf das fast gänzlich entvölkerte Schlachtfeld starrenden Bruder. »Nur her mit dem Sperber! ich kann ihn brauchen in Gersdorf!«
»Sollst ihn haben!« lachte Poppo und befreite seinen gefangenen elfenbeinernen König aus der grausen Verstrickung.
Da trat Ritter Bock von Schlanstedt in den Saal.
Siebentes Kapitel.
»Nun, Bock, wo steckst du denn?« redete Graf Albrecht den Eintretenden an.
»War auf Burg Gersdorf zur Nacht, Herr Graf,« entgegnete der Ritter, »kam an Quedlinburg vorüber und bringe zwei Gefangene mit sechs Gäulen ein.«
»Gefangene? heute?« Der Graf schüttelte. »Lass die laufen! ich will heute keine Gefangenen.«
»Herr, es sind Damen.«
»Nun gar!« lachte der Graf. »Bist du bei Sinnen, Bock, uns hier Frauenzimmer auf den Hals zu laden?«
»Es ist ein vornehmes Fräulein mit ihrer Zofe, Herr Graf,« erwiderte Bock, »und es gibt ein reiches Lösegeld von Quedlinburg, sagte mir unterwegs Hinze Habernacks, der sie wohl kennen musste.«
»Wie heißt das Fräulein?«
»Sie wollen ihren Namen nur Euch selber sagen.«
»Wird wohl kaum der Mühe wert sein, ihn zu hören,« versetzte der Graf verdrießlich. »Bringe sie mal her!«
Der Ritter öffnete die Tür und winkte nach dem Gange hinaus.
Die junge Herrin erschien. Bock wollte ihr den Weg vertreten; aber sie schritt ohne ihn eines Blickes zu würdigen so stolz an ihm vorüber, dass er sie nicht zu hindern wagte. Sein Gesicht wurde etwas lang.
Eine anmutige Mädchengestalt verneigte sich errötend vor all den Männern und blickte hilfesuchend zu der einzigen anwesenden Frau hin.
Da packte Siegfried die Hand Reginhilds und drückte sie so stark, dass es Reginhild schmerzte. Mit offenem Munde und starrenden Augen stand er, bebend, doch ohne sich vom Fleck zu rühren.
Wangen wie Lilien, dunkelbraunes Haar und hellblaue Augen hatte die Liebliche.
Graf Albrecht erhob sich und sagte höflich: »Fräulein, Ihr seid ohne mein Wissen und Willen gefangen. Darum ängstigt Euch nicht; Euch soll hier jede Rücksicht zuteil werden. Doch wie nenn' ich Euch?«
»Gräfin Oda von Falkenstein, die Schwester des Grafen Hoyer,« erwiderte das Fräulein nun mit einer gewissen Hoheit im Ausdruck.
In Bewegung und halblauten Ausrufen der Anwesenden gab sich die größte Überraschung kund; auch Bock war sichtlich erschrocken.
Graf Albrecht streifte den Ritter mit einem finsteren Blicke und sprach: »Die Gräfin von Falkenstein meine Gefangene? Das kann nicht sein! das heißt, ich zweifle nicht –«
Aber schon war Siegfried herzugesprungen und sagte schnell mit erglühendem Antlitz: »Albrecht, ich kenne das gnädigste Fräulein; sie war es, die mir in Ballenstedt den Kranz aufs Haupt setzte.«
Oda nickte ihm leise zu.
»Wirklich? Nun, so mache ich dich zu ihrem Ritter und Beschützer,« erwiderte Albrecht. »Du stehst für sie ein!«
Ein Freudenstrahl aus den Augen des Jüngsten dankte dem Bruder.
»Nehmt Platz, edle Gräfin,« fuhr Albrecht fort, »und verzeiht den groben Irrtum meines Lehensmannes. Die Ihr hier seht, sind meine Brüder, und dies ist Gräfin Reginhild, meines Bruders Bernhard Frau. Siegfried soll Euch morgen sicher geleiten, wohin Ihr begehrt.«
Reginhild schritt auf Oda zu, reichte ihr die Hand, sprach freundliche Worte zu ihr und setzte sich neben sie, ihr Wein und Backwerk darbietend. »Wir sprachen eben von Euch,« sagte Reginhild, »wie seltsam!«
»Von mir?« frug Oda.
»Ja,« fiel Siegfried ein, »ich erzählte Gräfin Reginhild von dem Turnier, und da ich Euren Namen nicht wusste, so nannte ich Euch nur die Lilie.«
»Die Lilie!« wiederholten lächelnd Siegfrieds Brüder und gaben dem Worte Beifall, weil es Odas Erscheinung so treffend bezeichnete.
»Seid Ihr auf der Reise, Fräulein?« frug Albrecht.
»Ich war auf dem Wege zur Äbtissin von Quedlinburg,« sprach Oda, allmählich Vertrauen fassend, »als mir der höfliche Ritter begegnete und –«
»Zur Äbtissin wollt Ihr?« unterbrach sie der Graf. »Dann steht Ihr doppelt unter meinem Schutz, denn ich bin ihr Schirmvogt, wenn Ihr es nicht wisst.«
»Wer wüsste das nicht, Herr Graf?« lächelte Oda bescheiden.
»Erwartet Euch die gnädige Frau?«
»Ja, – für immer.«
»Für immer? Wollt Ihr Konventualin werden?«
»Mein Bruder ließ mir die Wahl zwischen dem Kloster Walbeck und dem Stifte Quedlinburg.«
»Euer Bruder ließ Euch die Wahl? nur diese Wahl?« frug Albrecht höchst erstaunt. »Graf Hoyer ist doch, soviel ich weiß, kinderlos, und Ihr seid die Erbin der Grafschaft Falkenstein.«
»Ich sollte es nach Recht und Billigkeit wohl sein,« erwiderte Oda, »allein –; mögt Ihr es wissen, Herr Graf, was ja nicht lange mehr Geheimnis bleiben wird. Mein Bruder steht im Begriffe, die Grafschaft für ewige Zeiten an den Bischof von Halberstadt abzutreten.«
»Was?! an den Bischof –? Bernhard! Hast du's gehört?« rief der Graf außer sich vor Staunen und Unwillen, der sich auch in den Mienen der anderen malte. Er war aufgestanden und machte einige Schritte hin und her im Saale.
»Habt Ihr freiwillig verzichtet?« frug er dann.
Oda schüttelte das Haupt und seufzte.
»Gräfin Oda,« sagte nun Albrecht nach kurzem Besinnen, »dann geb' ich Euch nicht frei! Aber ich, Albrecht von Regenstein, und wir alle wollen Euch zu Eurem Rechte verhelfen. Dem Bischof die Grafschaft Falkenstein? Nun und nimmermehr, solange ich ein Schwert heben kann!«
Die Brüder stimmten ihm alle laut und entschlossen bei.
»Bock, jetzt dank' ich dir für deinen Fang!« fuhr Albrecht fort. »Sage der Ursula, sie solle Gemach und Kammer unserer seligen Mutter für Gräfin Oda und ihre Gürtelmagd rüsten.«
»Halt! Das ist mein Geschäft!« rief Siegfried überglücklich und eilte hinaus, der Schaffnerin den Befehl des Bruders zu bestellen. –
Gräfin Oda blieb auf dem Regenstein. Allerdings hatte Reginhild ihrem Schwager zu bedenken gegeben, ob es für die junge Gräfin nicht angenehmer und vor allem schicklicher wäre, wenn sie bei ihr auf der Heimburg wohnte statt hier bei den unverheirateten Männern. Aber er hatte darauf erwidert, dass er in dieser ihm ganz unerwartet kommenden Angelegenheit, die ihm wegen seiner Machtstellung dem Bischof gegenüber von großer Wichtigkeit wäre, auf ernste Verwicklungen und vielleicht harte Kämpfe gefasst sein müsste. Denn wenn sich auch Graf Hoyer nicht viel darum kümmern würde, wo die von ihm verstoßene Schwester geblieben wäre, so würde doch sicher der Bischof alles daran setzen, die Gräfin Oda in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu einem Verzicht auf ihr Erbe zu zwingen. Gegen diese Gefahr wäre sie aber auf dem uneinnehmbaren Regenstein weit besser geschützt als auf der nicht so stark verteidigten Heimburg, und er hätte mit ihr ein Recht in Händen, dem habgierigen Bischof die Grafschaft streitig zu machen. Und das würde er tun, möchte der Bischof auch in eine noch so maßlose Wut darüber geraten. Der Kampf mit demselben wäre ohnehin unvermeidlich, und je früher der zum Austrag käme, je lieber wäre es ihm.
Das mussten Reginhild und ihr Gatte nicht nur vollkommen einsehen, sondern die erstere stand auch schon Siegfrieds wegen von jeder weiteren Einrede ab.
Graf Albrecht ließ seiner Gefangenen einige Tage Zeit, sich bei ihm einzuwohnen, und erst als er zu bemerken glaubte, dass sie sich in ihr Schicksal gefunden hatte, suchte er eine Unterredung mit ihr und erfuhr dabei, soweit er es nicht schon wusste das Folgende.
Bereits Odas ältester Bruder war kinderlos dahin geschieden, und darauf hatte der zweite, Graf Hoyer, der schon Domherr in Halberstadt war, die Regierung der Grafschaft angetreten und sich ein Weib genommen, die ihm aber auch keinen Erben schenkte. Darin erblickte der frommgläubige Mann und noch mehr seine Gemahlin Margarete, eine herbe, zu tiefsinnigem Grübeln geneigte Natur, einen Wink, vielleicht eine Strafe des Himmels, der sie sich in Demut beugen müssten. Oda ließ sogar die Vermutung durchblicken, dass ihren Bruder eine heimliche Schuld drücken müsse, für die Gott der Allmächtige und seine heilige Kirche eine hohe Sühne verlange. Darum hatte er beschlossen, die Grafschaft nicht in weltlichem Besitz zu lassen, sondern sie zum Troste seiner Seele einer geistlichen Herrschaft einzuverleiben. Er hatte sie daher dem Bischof von Halberstadt gegen Verschreibung einer Leibrente und einer Kurie in Halberstadt angeboten, und der Bischof hatte natürlich mit beiden Händen zugegriffen und drängte nun zur sofortigen Übergabe, in welche Graf Hoyer jedoch erst nach dem Ableben seiner Gemahlin willigen wollte. Darüber schwebten nun die Verhandlungen, welche mit ebenso großem Eifer auf seiten des Bischof wie ablehnender Zähigkeit auf seiten des Grafen Hoyer geführt wurden. Aber nur über den Zeitpunkt konnte man sich nicht einigen, die Übergabe selbst war ein unwiderruflich gefasster Beschloss.
Im übrigen konnte sich Oda über ihren Bruder nicht groß beklagen; er hatte sie stets freundlich behandelt und ihr auch seinen Schmerz darüber nicht verhehlt, dass ihn sein gottesfürchtiges Gewissen zur Enterbung der viel jüngeren Schwester zwang. Zu ihrer Schwägerin konnte Oda niemals in ein rechtes Verhältnis kommen; das kalt abweisende Wesen Margaretens schreckte sie zurück, und sie fühlte wohl, dass sie der liebelosen Frau im Wege war.
Darum hatte der Abschied von der Burg ihrer Väter, der hoch und herrlich über dem wiesengrünen, waldumrauschten Selketale gelegenen Feste Falkenstein Oda nicht zu heiße Tränen gekostet, obschon ihr bewusst war, was sie verließ und für immer aufgab. Den Schleier zu nehmen hatte sie sich jedoch nicht entschließen können, hatte daher der einsamen Zelle im Kloster Walbeck das glänzende Schloss des freiweltlichen Stiftes Quedlinburg zum dauernden Aufenthalt vorgezogen, um doch nicht ein für allemal den Freuden des Lebens entsagen zu müssen.
Es war in Graf Albrechts Gemach auf der oberen Burg, wo ihm Oda diese Mitteilungen machte. Dasselbe war mit einem großen Kamin versehen und hatte verglaste Fenster, aber nur sehr spärlichen Hausrat. In einem grobgezimmerten Armstuhl aus Eichenholz mit hoher, steiler Lehne, einem Throne vergleichbar, saß Albrecht und ihm gegenüber in einem ähnlichen, etwas kleineren Gräfin Oda. Er hatte ihr ein zottiges Bärenfell unter die Füße geschoben, das sonst vor seinem Sessel lag als einzige Bedeckung des steinernen Fußbodens. Kahl und schmucklos starrten die getünchten Wände; nur ein roh bemalter Heiland am Kreuz mit einem dahinter gesteckten längst verdorrten Zweige hing über einem großen eichenen Tische, auf dem ein kleines irdenes Gefäß mit schwarzer Tinte und ein Wasserkrug nebst Becher standen. Weiter lagen darauf eine Rohrfeder, einige Pergamente, ein Paar Sporen, ein Jagdhorn und endlich ein in Holzdeckel gebundener Sachsenspiegel, der auf Odas väterlicher Burg verfasst war, und den der Graf von Regenstein als Gerichtsherr besaß und besitzen musste. Ein alter Schrein, eine mit erhabenem Schnitzwerk verzierte Truhe und zwei hölzerne Schemel, auf denen allen auch noch mancherlei Gebrauchsgegenstände, Jagdzeug und Gewaffen lagen, vollendeten die einfache Ausstattung. In einer Ecke lehnte ein langes Schwert.
Von den Fenstern konnte der Graf weit in das Land schauen und auch das Schloss der Äbtissin von Quedlinburg sehen, zu dem er oftmals hinüberblickte, als müsste er es nicht bloß mit der Wucht seines Schwertes und seines Namens schützen und schirmen, sondern selbst aus der Ferne noch mit sorgenden Augen bewachen. Dann sah er auch Jutta dort wandeln und walten, und ihr Bild stand mit all ihrer verführerischen Schönheit und berückenden Huld vor seiner Seele und verdrängte in ihm die Erinnerung an ihren launenhaften Eigensinn, mit dem sie ihn schon so manches Mal geärgert hatte.
Nun aber kam es ihm selber etwas sonderbar vor, wie er hier in dem einsamen Gemache seiner unnahbaren Felsenburg einem jungen Mädchen gegenübersaß und mit gespannter Aufmerksamkeit dessen Erzählung lauschte, die ihm den Zornmut im Busen erregte. Er versprach der jungen Gräfin, es bei ihrem Bruder zunächst mit Vorstellungen und Warnungen zu versuchen, ob er nicht zu einer Sinnesänderung zu bewegen wäre, wozu sie hoffnungslos das Haupt schüttelte.
Sie hatte sich ihre nächste Zukunft schon ganz anders zurechtgelegt, hatte sich damit beschieden, auf dem Schloss zu Quedlinburg bei der selbst noch jugendlichen Äbtissin und im Kreise der Konventualinnen ein neues Heim zu finden und dort ihr Verlassensein zu vergessen, und statt dessen sah sie sich nun mit einem Male ihrer Freiheit beraubt, entführt und gefangen auf dem Regenstein bei dem mächtigen Grafen, der ihr mit der zartesten Rücksicht begegnete und sogar Schritte für sie zur Erhaltung ihres Erbes tun wollte. Noch kam ihr das alles wie ein Traum vor, noch konnte sie ein unbestimmtes Gefühl von Furcht nicht ganz aus ihrem Herzen verbannen. Wenn sie aber dem hohen, willensstarken Manne in die klaren Augen blickte und seine ruhige, ernst tönende Stimme hörte, so überkam sie ein beschwichtigendes, wachsendes Vertrauen zu dem ritterlichen Burgherrn, an den sie bisher nur mit scheuer Bewunderung zu denken gewohnt war.
Denn sie kannte ihn längst. Vor ein paar Jahren war er einmal zu einem großen Jagen auf dem Falkenstein gewesen, und das Bild seiner gebietenden, alle anderen Gäste überstrahlenden Erscheinung hatte sich ihr so unauslöschlich eingeprägt, dass er seitdem wie ein Heros durch ihre Gedanken und Träume schritt. Sie sah ihn bis zu dem Turnier in Ballenstedt nicht wieder, hörte aber desto mehr von ihm, denn immer und überall klang seines Namens Ruf. Die Männer sprachen von ihm wie von einem Fürsten, den die einen fürchteten, die anderen beneideten, alle aber achteten und seines Mutes wegen rühmten. Auch auf dem Turniere war Graf Albrecht der Held und erste Sieger geblieben, von Tausenden umjubelt. Sie hatte er unter der Menge natürlich nicht bemerkt, so wenig wie er ihr in der Jagdgesellschaft auf dem Falkenstein Beachtung geschenkt hatte. Darum hatte er sie auch jetzt nicht wiedererkannt, als sie gefangen vor ihm erschien. Und wie sollte er auch, er, der große Graf von Regenstein! und sie, ein in der Zurückgezogenheit und Einsamkeit aufgewachsenes Burgfräulein, für das noch kein Ritter eine Lanze gebrochen hatte!
Und nun war sie seine Gefangene, vielleicht auf lange Zeit, und konnte nicht einmal wünschen, dass es nicht so wäre. Das war kein Abenteuer, in das sie ein Spiel des Zufalls verwickelte, das war Schicksalsfügung, der sie sich mit stiller Erwartung des Kommenden willenlos ergab.