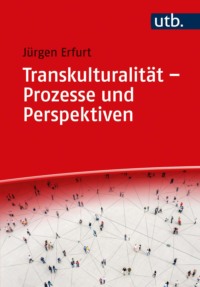Kitabı oku: «Transkulturalität - Prozesse und Perspektiven», sayfa 11
3.7 Transkulturalität im Paradigma des Spatial turnSpatial turn
TransnationalismusTransnationalismus, TransstaatlichkeitTransstaatlichkeit, TransregionalitätTransregionalität, Translokalität, und eben auch Transkulturalität, TransmedialitätTransmedialität, TransgenderTransgender: ganz offensichtlich hat das Präfix trans- Konjunktur. Dabei fällt auf, dass sich die Wortbildungen mit trans- heute auf andere Bedeutungsfelder erstrecken, als wir sie aus älteren Bezeichnungen wie Transsibirische Eisenbahn, Transcanada-Highway oder aus Adjektiven wie transalpin oder transgalaktisch kennen, in denen sich trans- auf mehr oder weniger umgrenzte topographische oder physikalische Räume bezieht, entweder im Sinne von ‚hindurch‘ oder ‚jenseits von‘. In Transnationalismus, Transkulturalität, Transgender, Transmedialität ist die Bedeutung von trans- eine andere: trans- konnotiert sowohl eine GrenzeGrenze(n) zwischen Entitäten, die überschritten oder überquert wird, als auch die Umformung oder Gestaltveränderung der jeweiligen Entitäten. Diese Bedeutungsveränderung ist maßgeblich, um die gewachsene Komplexität und Mehrdimensionalität des sozialen Wandels zu verstehen. Wie gleich noch zu zeigen sein wird, erklärt sich die Konjunktur von ‚Trans’-Begriffen aus dem, was seit etwa zwei Jahrzehnten als Spatial turnSpatial turn bezeichnet wird.
Unter Spatial turnSpatial turn verstehen die KulturKultur- und Sozialwissenschaften einen Paradigmenwechsel, der ‚Raum’ – anders als in geographischen oder physikalischen Zusammenhängen – als kulturelle, sozial konstruierte Größe wahrnimmt (vgl. Middell 2005). Zugleich drückt Spatial turn aus, dass nicht mehr allein die ‚Zeit’, wie dies in der Moderne der Fall war und geradezu exemplarisch von F. Braudel (1958) in der longue durée beschrieben wurde, im Zentrum kulturwissenschaftlicher Betrachtungen steht. Um zu illustrieren‚ was es bedeutet, Raum als eine kulturelle Größe zu verstehen, lässt sich beispielsweise fragen, ob ein kulturelles Phänomen wie Sprache einen Raum oder ein TerritoriumTerritorium hat. Sibille (2013, 53) gibt auf diese Frage zwei Antworten. Sprache hätte a priori kein Territorium; der einzige Ort, den sie habe, sei das Gehirn des Menschen. Die andere Antwort sagt genau das Gegenteil: Sprachen haben notwendig ein Territorium, allerdings vermittelt über ihre SprecherInnen, die SchreiberInnen und LeserInnen eingeschlossen: Das Territorium einer Sprache ist jener Raum, in welchem die Menschen leben, die ihre Sprachen sprechen. Aber auch diese Antwort kann noch nicht befriedigen. Seit es den Buchdruck, seit es den Tonfilm, das Radio, das Fernsehen und – in qualitativ und quantitativ völlig neuer Weise – das InternetInternet als einen virtuellen Raum gibt, sind Sprachen im wachsenden Maße entterritorialisiert. Sprachliche Artefakte wie Bücher, Zeitungen und andere Schriften zirkulieren über GrenzenGrenze(n) hinweg und werden selbst in entlegenen Räumen gelesen; Rundfunk und Fernsehen, die zunächst nur eine lokale ReichweiteReichweite hatten, sind heute via Internet global präsent. KommunikationKommunikation in Echtzeit rund um den Globus ist inzwischen Realität geworden.
Das Internetzeitalter seinerseits hat nicht nur neue und den Informationsaustausch immens beschleunigende Kommunikationsformen wie Email, Chat, Blog, soziale Netzwerke etc. hervorgebracht, sondern auch die Verbreitung von Sprachen befördert, sofern die jeweiligen Sprechergruppen die Mittel zur Partizipation an dieser KommunikationKommunikation haben. Analog zur medialen Entgrenzung der Sprachen und zur VernetzungVernetzung ihrer SprecherInnen haben MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und MobilitäMobilitätt unter den Menschen enorm zugenommen, was nach Giddens (1990), Massey (1994, 2005) u.a. einen „high degree of space-time compression“ zu Folge hätte.
This compression has transformed the geography of social relations and communication, leading many scholars to focus their studies on the transnational nature of late-modern communicative environments. This studies have linked the emergence of transnationalism with the post-industrial wave of migration, a wave characterized by people able to forge and sustain multistranded social relations across geographic, cultural, and political borders. (Jacquemet 2010, 50)
Mit dem Spatial turnSpatial turn wird der Raum vor allem als ‚Beziehungsraum‘ wahrgenommen, der in besonderer Weise von MobilitätMobilität – von Personen, Waren, Ideen, Dienstleistungen etc. – und der Dynamik von Be-/Ent-/Aus-/Ab-/Eingrenzungsprozessen bestimmt wird, und somit von einer Dynamik, die nicht im Selbstlauf, einfach so, passiert. Diese Dynamik wird angetrieben von Akteuren, die ihrerseits die Beziehungsräume nach ihren Interessen, mit ihren kulturellen Mustern und Formen, in Reaktion auf geographische, ökologische, politische und andere Gegebenheiten auszugestalten versuchen. In einer transkulturellen Perspektive sind diese Beziehungsräume die Orte transkultureller VerflechtungenVerflechtungen.
Die Frage, um die es hier geht, ist also die nach dem Verhältnis von Transkulturalität und jenen anderen oben genannten ‚Trans’-Begriffen, insbesondere zu Transnationalität bzw. TransnationalismusTransnationalismus und zu dem bislang noch nicht eingeführten Konzept des TransfersTransfer, der im folgenden Kapitel behandelt wird.
Mit der begrifflichen Neufassung von ‚Raum’, wie sie mit dem Spatial turnSpatial turn einhergeht, schlagen die Kulturwissenschaften eine Brücke zu jener ebenfalls in den 1980er Jahren aufkommenden Betrachtung von sozialen Prozessen, die die GrenzenGrenze(n) von Nationen bzw. Nationalstaaten überschreiten, somit trans-national oder trans-staatlich sind und seither unter dem Label des TransnationalismusTransnationalismus erforscht werden. SoziologieSoziologie, Geschichtswissenschaften, MigrationsforschungMigrationsforschung und Politikwissenschaften, für die die NationNation bzw. der NationalstaatNationalstaat eine zentrale KategorieKategorie, Kategorisierung darstellt, verwenden den Terminus ‚transnational’ häufig synonym zu ‚grenzüberschreitend’ und sehen Transnationalisierung nicht selten als „eine Art ‚GlobalisierungGlobalisierung von unten von unten’, als Entwicklung zunehmender grenzüberschreitender sozialweltlicher Beziehungsnetzwerke und bewegungsorientierter Aktionsbündnisse“ (Pries 2013, 881). Einer noch engeren Definition von Transnationalismus zufolge geht es um eine spezifische Form der Internationalisierung von Vergesellschaftungsprozessen im Sinne von relativ dauerhaften sozialen Beziehungen, sozialen Netzwerken und Sozialräumen, die lokal in verschiedenen Nationalstaaten verankert sind und kein einheitliches organisierendes Zentrum aufweisen (vgl. ebd., 882).
In diesem Sinne soll das Konzept der Transnationalisierung von anderen Formen grenzüberschreitender Phänomene und Prozesse abgrenzt werden, die mit Termini wie GlobalisierungGlobalisierung, Mondialisation, KosmopolitismusKosmopolitismus, DiasporaDiaspora-BildungBildung, Supranationalisierung oder GlokalisierungGlokalisierung charakterisiert werden. (ebd.)
Aber so einfach scheint diese Abgrenzung nicht zu sein, zumindest nicht, wenn es um Transkulturalität geht. Wie empirische Studien aus der transnationalen MigrationsforschungMigrationsforschung zeigen, die sich mit grenzüberschreitenden Kommunikationspraktiken und Lebensorientierungen befassen, z. B. von polnischen MigrantInnen in den USAUSA oder von türkischen Familien in DeutschlandDeutschland, greifen transnationaletransnationale Migration und transkulturelle Fragestellungen kaum trennbar ineinander und stellen komplementäre, manchmal auch identische Betrachtungsweisen dar. Für beide Ansätze zentral ist die MobilitätMobilität der Akteure. In der Tendenz scheint es jedoch so zu sein, dass unter dem Etikett der Transnationalisierung ein viel breiteres Spektrum sozialer Prozesse der ökonomischen, politischen, kulturellen und sozialen VerflechtungVerflechtung von Menschen auf lokaler, regionaler, nationaler, glokaler, globaler Ebene betrachtet werden und von transnationalen Arbeitsprozessen bis zu transnationaler Kriminalität von Steuerflucht, Menschen- und Waffenschmuggel reicht, während es bei Transkulturalität mehr um die Transformationen kultureller Praktiken und ihren Zuschreibungen sowie um das Zurechtfinden der Menschen in einer immer komplexer werdenden Welt geht.
3.8 Transkulturalität als Bedrohung?
Bereits im Jahre 2006 warf der Soziologe Hartmut Griese die Frage auf, ob es sich bei dem Konzept des ‚Transkulturalität‘ nicht um ein HerrschaftHerrschaftsinstrument handele, das „globale IntegrationIntegration“ unter dem Aspekt der Transkulturalität meint (Griese 2006, 22). Weiter müsse gefragt werden:
Was ist mit jenen Menschen, die nicht zu transkulturellen Transformationsleistungen befähigt sind, keine „Transkulturalitätskompetenz“ haben und keine transkulturellen Identitäten ausbilden (können)? In anderen Worten: Ist das Konzept der Transkulturalität und damit einer transkulturellen PädagogikPädagogik nicht ein elitäres (bildungsbürgerlich-kosmopolitisches) neues Herrschaftsinstrument – gut gemeint, aber die Realität der sozialen Ungleichheiten negierend? Werden in diesem Konzept gesellschaftliche Konflikte und Probleme, wird „strukturelle GewaltGewaltsymbolische –“ (als soziale UngleichheitUngleichheitsoziale und Ungerechtigkeit) ausgeklammert, werden (subkulturelle) Heterogenitäten und soziale Minderheiten nach dem Maßstab der Transkulturalität exkludiert? (ebd.)
Dass diese Fragen keineswegs von der Hand zu weisen sind, ergibt sich auch aus den Befunden anderer Beobachter gesellschaftlichen Wandels und kultureller KonfliktKonflikte. Zumal wir über Transkulturalität in einer Zeit reden, in der die allgemeinen Verunsicherungen ökologischer, sozialer, sanitärer und wirtschaftlicher Art, die Schere von Arm und Reich, der Statusverlust von Teilen der Mittelschichten und insgesamt „die Fliehkräfte des Sozialen“ (Mau 2017) seit Ende der 1980er Jahre größer geworden sind denn je. Zugleich sind sie sozial sehr unterschiedlich verteilt. Jene sozialen Milieus, die sich kosmopolitisch orientieren können, die hohes BildungBildungskapital haben, sehen in Transkulturalität kaum etwas „Angstbesetztes“, sehen darin Chancen, während andere Milieus, und keineswegs nur die „Verlierer der GlobalisierungGlobalisierung“, einen „national-identitären Anker“ suchen, wie sich am Zulauf zu rechtspopulistischen Parteien zeigt.
Deren Vorstellungen des Nationalen sind ein Angebot der gesellschaftlichen Selbstaufwertung, das ein kollektives Wir erhöht und ihm eine neue Bühne bietet. Diese Art der KulturalisierungKulturalisierung arbeitet oftmals mit einem essentialistischen Kulturbegriff, der auf den Ausschluss und die Abwertung der „Anderen“ zielt oder bewusst in Kauf nimmt. (Mau 2017, 302)
Transkulturalität als Bedrohung? – ja, durchaus, doch für wen und in welcher Form? Als erkenntnisleitendes Konzept, als Perspektive auf geschichtliche Vorgänge der VerflechtungVerflechtung und des Austauschs, als …. – in dieser Hinsicht sind die Gedanken frei, wenn es darum geht, Transkulturalität als Perspektive auf die allgegenwärtigen Prozesse und Formen kulturellen Wandels zu verstehen. Doch zugleich sensibilisiert die Transkulturalitätsperspektive dafür, welche Prozesse mit GlobalisierungGlobalisierung verbunden sind, welche Dynamiken mit transarealen MigrationMigrationsprozessen in Gang kommen und welche KonfliktKonflikte mit der wachsenden globalen VernetzungVernetzung und Verflechtung und zugleich mit den globalen Verteilungskämpfen verbunden sind. Denn wenn das Konzept in der Weise verstanden wird, wie es Mary L. Pratt (vgl. 3.3) vorgezeichnet hat, dann kommen gerade jene Personen, Verhältnisse und Prozesse „on the receiving end of empire“ in den Blick, zu denen wohl auch diejenigen gehören, welche H. Griese im obigen Zitat im Auge gehabt haben könnte. Aber auch noch andere, zumal Prozesse der Globalisierung, anders als manche glauben mögen, keineswegs nur Chancen und erweiterte Aktionsräume bieten. Denn der Strukturwandel und die Vernetzungen und VerflechtungVerflechtungen in der glokalisierten Welt, die De-Nationalisierung und die wachsenden sozioökonomischen Ungleichheiten erfolgen ja nicht im Selbstlauf, sondern sie haben vielfältige Akteure, zumal der gesellschaftliche Umbau zur postindustriellen Ökonomie eine rapide ErosionErosion der klassischen Angestelltenkultur und der Industriearbeiterschaft zur Folge haben. Gleichzeitig differenziert sich die MittelschichtMittelschicht weiter aus, es wächst die IndividualisierungIndividualisierung und bilden sich Gruppen von hochqualifizierten urbanen Akteuren, die ihre Bildungs- und Wissensanstrengungen durch die Wahrnehmung exklusiver Bildungsangebote weiter intensivieren, was die Kluft zu Gruppen der alten Mittelschicht immer größer werden lässt (vgl. Mau 2012, 47ff., zu sozialen Ungleichheiten auf globaler Ebene, vgl. Weiß 2017). Transkulturalität steht in diesem Kontext für Vergesellschaftungsdynamiken, die um einiges komplexer sind als jene, die im NationalstaatNationalstaat als Auseinandersetzung um das Primat von PolitikPolitikKultur-, Sprachpolitik, Sozial- gegenüber Ökonomie oder von Ökonomie gegenüber Politik geführt wurden und die den vielfältigen Prozessen der KulturalisierungKulturalisierung und der Diversifizierung der individuellen kulturellen Praktiken Rechnung tragen.
Kapitel 4: Konzepte und Felder transkultureller Forschung
4.1 Gegenstand und Einordnung
Zu Beginn des Buchs, in Abschnitt 1.3, wurde Transkulturation als Prozess des kulturellen Wandels und die Transkulturalität als der Strukturaspekt dieses Prozesses eingeführt. Ziel des vierten Kapitels ist es, diese Struktur genauer auszuleuchten. In diesem Sinne sollen im Weiteren jene Eigenschaften und Elemente von Transkulturalität eingeführt und diskutiert werden, die in prominenter Weise Gegenstand der transkulturell orientierten philologisch-kulturwissenschaftlichen Forschung sind: HybriditätHybridität, DiasporaDiaspora und diasporischediasporische Lesart Lesart, ErinnerungErinnerung, – in Bewegung in Bewegung, migrantisches SchreibenSchreiben, Schreibung, SprachbiografieSprachbiografie, GenerationGeneration und TranslatioTranslatio. Andere Felder als die der philologisch-kulturwissenschaftlichen Forschung bleiben in diesem Kapitel weitgehend unberücksichtigt, so etwa die transkulturell inspirierten Untersuchungen auf Feldern wie der DenkmalpflegeDenkmalpflege (vgl. Falser/Juneja 2013), der Religion (Juneja/Pernau 2008) oder auch von Medizin, Gesundheit und Pflege, wie sie in NordamerikaNordamerika breit entfaltet sind und bei Recherchen zum Stichwort transcultur* eine hohe Trefferzahl ergeben. Das Sprachliche in seinen transkulturellen Bezügen wird ausführlich im Kapitel 5 behandelt.
Die genannten Konzepte haben als Gemeinsamkeit, dass sie auf Prozesse und Strukturen kultureller Praktiken verweisen, die sich aus den Verflechtungen, Querungen und Neuordnungen kultureller Ausdrucksformen im Zuge von KontaktKontakt, MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und MobilitätMobilität ergeben. Die gegenwärtige Phase der Globalisierung ist dafür der Ausgangspunkt. Die Chiffre für diesen Wandel des Kulturellen besteht in der wachsenden und sich beschleunigenden VerflechtungVerflechtung von Akteuren und letztlich in der Neudimensionierung des Kulturellen, wie sie den Prozess des Übergangs von KulturKultur zu KulturalitätKulturalität (vgl. Kap. 2) bestimmt. Aufgabe des vierten Kapitels ist es zu zeigen, welche Zugänge speziell die Sprach-, Literatur-, Translations- und Kulturwissenschaften zum FeldFeld, Feldtheorie transkultureller Prozesse und Praktiken wählen.
Wenn im Weiteren von ‚FeldFeld, Feldtheorie’ oder von ‚Feldern’ die Rede ist, dann schließt die Darstellung an den Feldbegriff des französischen Soziologen Pierre Bourdieu an. Die TheorieTheorie der unsichtbaren Hand des Feldes hat Bourdieu in seiner ganzen Komplexität insbesondere im Hinblick auf das kulturelle bzw. literarische Feld entwickelt. Anhand von Flauberts Roman „L’éducation sentimentale“ arbeitet er in „Les reglès de l’art. Genèse et structure du champ littéraire“ von 1992 (erweiterte Fassung 1998a) die Theorie des Feldes zu einem analytischen Instrument der Produktion und Reproduktion kultureller Verhältnisse und Produkte aus, indem er der Frage nachgeht: „En quoi Flaubert écrivain est produit par ce qu’il contribue à produire?“, frei übersetzt: in welcher Weise ist Flaubert als Schriftsteller ein Produkt dessen, was er selbst mit produziert? Bourdieus Begriff des ‚Feldes’ und hier speziell des kulturellen Feldes bezieht sich auf die Produktion und Zirkulation kultureller Güter und auf die Herstellung kultureller Verhältnisse, die auch Machtverhältnisse sind. Die Beziehungen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die in einem Feld herrschen, sind veränderlich und zeitlich und räumlich beschränkt. Bestimmend für ein Feld ist die Verfügungsmacht, mit der die AkteurInnen auf dem jeweiligen Feld ausgestattet sind. Bourdieu spricht von verschiedenen Feldern, in denen sich die Gesellschaft organisiert: das ökonomische Feld, das politische, das kulturelle, das künstlerische, das literarische oder das religiöse. Die GrenzenGrenze(n) zwischen den einzelnen Feldern stehen nicht von vornherein fest. Die entscheidenden Trennlinien, und so auch die Trennlinien von MachtMacht, -verhältnisse und Einfluss, verlaufen nach Bourdieu nicht zwischen diesen Feldern, sondern innerhalb der einzelnen Felder selbst, so z. B. zwischen der production de masse (Massenproduktion) und der production restreinte (elitäre Produktion), die sich vor allem durch ein unterschiedliches Maß an symbolischem Kapital unterscheiden. Indem Bourdieus kultursoziologischer Feldbegriff die Aufmerksamkeit auf Genese und Struktur des Kulturellen lenkt, stellt er somit auch einen zentralen Bezugspunkt für die Untersuchung transkultureller Prozesse und Strukturen dar.
Die Reihenfolge der Abschnitte dieses Kapitels ergibt sich aus Überlegungen zur Struktur von Transkulturalität im Kontext philologisch-kulturwissenschaftlicher Forschungen. Am Anfang steht der Abschnitt über MischungMischung und HybriditätHybridität (4.2). Mischungen und Mischungsprozesse als Folge von KontaktKontakt sind – wie Transkulturation insgesamt – allgegenwärtig. Sie erfolgen oft unbewusst, wie sie auch, von den AkteurInnen unbemerkt, Teil der gegebenen und vorgefundenen kulturellen Verhältnisse sind. In anderen Fällen wiederum sind sie umkämpft und konfliktKonfliktgeladen, je nachdem, ob und wie sich in ihnen Machtverhältnisse repräsentieren oder ggf. auch reproduzieren. Innerhalb der Elemente der Struktur von Transkulturalität stellt ‚Hybridität‘ den Gegenpol zu ‚TranslatioTranslatio‘ (4.8) dar. Translatio als Oberbegriff für Prozesse des TransferTransfers und der TranslationTranslation steht als Konzept für den kontrollierten und meist auch professionalisierten Umgang mit differenten kulturellen Formen und für bewusste und gezielte grenzüberschreitende Vermittlungs- und ÜbertragungsprozesseVermittlungs- und Übertragungsprozesse zwischen AkteurInnen. Dies zeigt sich auch in den Tätigkeiten der Translation, des Übersetzens und des Dolmetschens als Praktiken des kontrollierten Umgangs mit sprachlicher und kultureller Diversität, wobei Transkulturalität weniger auf der Ebene der Formen, sondern vor allem auf der Ebene des WissenWissens anzunehmen ist. Diese beiden Konzepte – Hybridität und Translatio – bilden eine Klammer für die Anordnung der übrigen Strukturelemente.
Auf die Ausführungen zu MischungMischung und HybriditätHybridität folgt der Abschnitt über ‚DiasporaDiaspora‘ und ‚diasporischediasporische Lesart Lesart‘ (4.3). Diaspora als spezieller Fall steht pars pro toto für die allgemeinen Prozesse von MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und MobilitätMobilität, die zugleich der Motor von Transkulturalität sind. Ansonsten sind Migration und Mobilität eine Konstituente von allen der in diesem Kapitel dargestellten Elementen der Struktur von Transkulturalität.
Im Kontext von MigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und DiasporaDiaspora nehmen Positionierungsaktivitäten von Gruppen und IndividuenIndividuum, Individuen einen zentralen Platz ein, die mit dem Konzept von ‚ErinnerungErinnerung, – in Bewegung in Bewegung‘ (4.4) gefasst und als transkulturelles GedächtnisGedächtnistranskulturelles beschrieben werden. Erinnerung in Bewegung ist ihrerseits konstitutiv für die Probleme, die in den beiden folgenden Abschnitten behandelt werden. Da in diesem Buch sprachliche, literarische und mediale Phänomene von Transkulturalität im Mittelpunkt stehen, bilden die beiden Abschnitte über ‚migrantisches SchreibenSchreiben, Schreibung‘ (4.5) und ‚SprachbiografieSprachbiografie‘ (4.6) auch das Zentrum dieses Kapitels, ohne allerdings auf diese Weise eine Priorisierung der Gegenstände zu suggerieren, denn das Hauptanliegen ist und bleibt, VerflechtungenVerflechtungen und Querungen so gut wie möglich sichtbar zu machen, auch anhand der Beispiele, die in allen Abschnitten den Bereichen von Sprachen, Literaturen und Medien entnommen sind.
Der Abschnitt über ‚GenerationGeneration‘ (4.7) steht im engen Zusammenhang nicht nur mit dem vorausgehenden Abschnitt zu SprachbiografieSprachbiografie, sondern auch mit dem zu ‚ErinnerungErinnerung, – in Bewegung in Bewegung‘. ‚Generation‘ ist hier nicht primär als biologisches Konzept, sondern vielmehr als Ort, MilieuMilieu oder Diskursraum der Auseinandersetzung über Tradierung, ReichweiteReichweite oder Verwerfung von kulturellen Praktiken, Werten und Anschauungen zu verstehen. Der Begriff ist auf diese Weise auch als Strukturelement von Transkulturalität zu betrachten, das auf vielfältige Weise in Diskursen, Literaturen und Medien reflektiert wird.