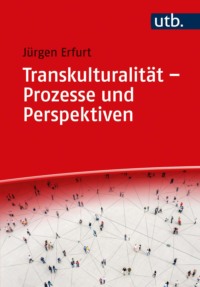Kitabı oku: «Transkulturalität - Prozesse und Perspektiven», sayfa 2
Von den griechischen Kürschnereien im „Pelzdreieck“ des Bahnhofsviertels, den türkischen und marokkanischen Supermärkten sowie den über das gesamte Viertel verteilten chinesischen, italienischen, polnischen oder spanischen Unternehmen lässt sich ein Bogen schlagen zu Fragen der EthnoökonomieEthnoökonomie, des transnationalen Unternehmertums oder auch des „Immigrant Business“, wie Pütz (2004) es nennt. Und letztlich auch zu den global agierenden Unternehmen der Finanz- und Dienstleistungsökonomie, die sich in großer Zahl am Rande des Bahnhofsviertels etabliert haben. Transnationale Unternehmer sind nach Ebner/Wösten (2015, 6) solche mit Migrationshintergrund, die grenzüberschreitend agieren und strategischen Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen im Herkunfts- und Ankunftsland wie auch in Drittländern haben. Transnationales Unternehmertum verbindet sich zugleich mit der wirtschaftlichen und sozialen IntegrationIntegration von MigrantInnen und der unternehmerischen Verwertung von kultureller DiversitätDiversitätkulturelle.15 Die das Straßenbild prägenden Supermärkte, Bazare und Reiseagenturen in der Münchener Straße, um nur dies als Beispiel zu nehmen, deren Inhaber transnational tätig sind, werden flankiert von auch im BahnhofsviertelBahnhofsviertel ansässigen transnational tätigen Buchhaltungs- und Steuerberatungsgesellschaften, von Anwaltskanzleien, Übersetzungsbüros, Informations-, Kommunikations- und Marketingagenturen, Softwareentwicklern usw., deren Geschäftsmodell ebenfalls auf transnationalem WissenWissentransnationales und transkulturellen VerflechtungenVerflechtungen aufbaut. Meist in kleinbetrieblichen Strukturen organisiert, schließen sie an lokale Gemeinschaften wie Familien, ethnische Milieus, Verbände und Vereine an und stellen eine migrantischemigrantisches Schreiben „GlobalisierungGlobalisierung von unten von unten“ dar. Nach Ebner/Wösten (2015, 9) sind sie als Pendant zu den am Rande des Bahnhofsviertels angesiedelten multinational verflochtenen Großunternehmen einer „Globalisierung von obenGlobalisierung von oben“ zu betrachten.
1.2 Transkulturalität als Prozess und als Perspektive
Welche Anhaltspunkte lassen sich aus dieser Ortsbegehung gewinnen, um den Gegenstand des vorliegenden Buchs über Transkulturalität zu umreißen? Der Hauptbahnhof als Ausgangspunkt der Ortsbegehung, zugleich als ein Denkmal der Verkehrs-, KulturKultur- und Stadtgeschichte, verweist als konkreter Raum auf die MobilitätMobilität von Menschen. In seiner Funktion als Verkehrsknotenpunkt repräsentiert er zudem die vielfältigen Vernetzungen und Kontakte zwischen Stadt, Umland, Region, anderen Städten und anderen Ländern. Damit wäre bereits ein erster Anhaltspunkt gegeben, indem Stichwörter wie Mobilität, KontaktKontakt und VernetzungVernetzung von Akteuren und ihren sozialen Milieus, etwa so wie in Abb. 1 schematisch gekennzeichnet, genannt werden. Mobilität, Kontakt und Vernetzung treten ebenso deutlich in den Straßen des Bahnhofsviertels zu Tage. Sich hier zu bewegen, auf die Namen an den Klingelschildern der Haustüren zu schauen, die Sprachenvielfalt unter den Passanten und in den Graffitis und Inschriften zu beobachten, lenkt unweigerlich die Aufmerksamkeit auf die im Viertel allgegenwärtige MigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel-, sei es in Form der EthnoökonomieEthnoökonomie des migrantischen Unternehmertums, der jungen KünstlerInnen und Kreativen in der „Basis“ oder der kulturellen und sprachlichen DiversitätDiversitätsprachliche unter der SchülerInnen der Karmeliterschule, die im BahnhofsviertelBahnhofsviertel ebenso alltäglich sind wie es die pendelnden anzug- und kostümtragenden Angestellten der Banken und Dienstleistungsunternehmen, die Junkies und Dealer, die Kunden der Laufhäuser oder die MitarbeiterInnen der Kanzleien, Praxen, Geschäfte oder Gaststätten sind.
Doch die Ortsbegehung lenkt die Aufmerksamkeit nicht nur auf MobilitätMobilität und MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und ihre Begleitumstände, sondern auch auf eine sehr viel allgemeinere und auf eine jeder Gesellschaft inhärenten Dynamik, die wir mit Begriffen wie UngleichheitUngleichheitsozioökonomische, kulturelle, sprachliche, soziale, DifferenzDifferenz, DiversitätDiversitätkulturelle, DistinktionDistinktion und HeterogenitätHeterogenität fassen und die in den folgenden Kapiteln noch genauer ausgeführt wird. Die Vielfalt, wie wir sie im Viertel und darüber hinaus überall in der Stadt beobachten können, stellt sich aus der Sicht der Akteure als Spannungsverhältnis dar, das von der Ähnlichkeit und GleichheitGleichheit (IdentitätIdentität und HomogenitätHomogenität) über Verschiedenheit im Sinne von Distinktion, DiversitätDiversitätkulturelle oder Differenz bis hin zu Heterogenität reicht, bis zu Phänomenen und Wahrnehmungen also, die nicht nur auf Verschiedenheit, sondern auch auf das hinweisen, was sich nicht zueinander fügt und was nicht zusammenpasst.
Somit erweitert sich die Reihe der bereits erwähnten Stichwörter von Mobilität, MigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel-, Kontakt, VernetzungVernetzung und VerflechtungVerflechtung um weitere: erstens, um das Alltägliche bzw. das alltäglich Gewordene an Vielfalt der Lebenspraxen; zweitens, um das Entstehen oder die Herausbildung von Neuem, das mit dem Begriff der EmergenzEmergenz zu fassen wäre. Letzteres zeigt sich bei der Ortsbegehung in der Herausbildung eines neuen Verständnisses von Schule, von neuen Schulkonzepten und Lernarrangements, in der Ausarbeitung von neuen Wegen in der Drogenpolitik und Kriminalitätsprävention, in neuen Fertigungsweisen in den Pelzunternehmen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und -praktiken in einer auf kultureller Differenz basierenden Wertschöpfung. Drittens sind es die Begriffe der UngleichheitUngleichheitsozioökonomische, kulturelle, sprachliche, soziale, Differenz, DistinktionDistinktion, DiversitätDiversitätkulturelle und HeterogenitätHeterogenität, mit denen die Aufmerksamkeit auf Eigenschaften von Systemen, Akteuren und Phänomenen gerichtet wird. Und viertens stoßen wir fortwährend auf die Dimensionen des Wandels in der Zeit. Verweise auf die Bebauung der Kaiserstraße und die Entstehungszeit des Hauptbahnhofs als einem Großprojekt der ModernisierungModernisierung von Verkehrs- und Stadtinfrastruktur Ende des 19. Jahrhunderts, die Zerstörung weiter Teile der Stadt im Zweiten WeltkriegWeltkriegZweiter, dann in der Nachkriegszeit die Ansiedlung von Pelz- und Rauchwarenindustrie einerseits und des Rotlichtmilieus andererseits, seit den 1980er Jahren die Errichtung orientalischer Supermärkte in der Münchner Straße, 2006 die Gründung der „Basis“ und anderes mehr – all dies lenkt den Blick auf historisch Gewordenes, auf Initialakte und vor allem auf Prozesse vielfältigen Wandels.
HistorikerInnen haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Forschungen zu Transkulturalität auch Bohrungen in tieferen Schichten aushalten. In den Untersuchungen von von Borgolte/Schneidmüller (2010), Borgolte/Tischler (2012), Drews/Scholl (2016) und des Netzwerks „Transkulturelle Verflechtungen“ (2016) bieten das Mittelalter und die frühe Neuzeit zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert ein fruchtbares Terrain für die Erforschung transkultureller Verflechtungsprozesse1, während Osterhammel (2001) vor dem Hintergrund der Herausbildung von Weltreichen, von Kolonialismen und Nationalismen methodologische Fragen der transkulturell vergleichenden GeschichtswissenschaftGeschichtswissenschaft diskutiert. Besonders einprägsam führt Ette (2005, 2012, 2017) als Literaturhistoriker vor, was es heißt, Prozesse von Transkulturalität auch schon in den frühen Phasen der GlobalisierungGlobalisierung, d.h. seit Beginn der kolonialen Eroberungen freizulegen. Und mehr denn je sind diese Prozesse eingebettet in die „progressive SchrumpfungSchrumpfung des Raums des Raums“ (Rosa 2005, 62), womit der Soziologe Hartmut Rosa die Auflösung des traditionellen Raum-Zeit-Verhältnisses benennt, die mit dem Industriezeitalter einsetzt und die mit der Wende zum 21. Jahrhundert nochmals einen immensen Beschleunigungsschub erfährt.2 In Bruchteilen von Sekunden erfahren wir heute von einem Ereignis wie dem Erdbeben und der Havarie des Atomreaktors in Fukushima und sehen, wie darauf fast gleichzeitig die Börsen in Sidney, New York, Paris oder Frankfurt am MainFrankfurt am Main mit Panikverkäufen oder Kurssprüngen reagieren.
Und schließlich liefert die Ortsbegehung einige Anhaltspunkte dafür, was es mit KulturKultur auf sich hat, wenn im Weiteren von Transkulturalität die Rede sein wird. Beginnend beim Hauptbahnhof, über das türkische Bistro mit der kleinen Galerie, die Karmeliterschule, die „Basis“, die muslimischen Gebetshäuser in den Hinterhöfen bis zu den Laufhäusern in Taunus- und Elbestraße und den griechischen Kürschnereien im „Pelzdreieck“ haben sich Menschen soziale Räume, Gebäude und Institutionen geschaffen, die nach bestimmten Regeln funktionieren, die für sie einen Zweck – oder auch verschiedene Zwecke – erfüllen und mit Werten, Vorstellungen und Anschauungen verbunden sind. Mal sind es IndividuenIndividuum, Individuen, wie der Besitzer des Bistros, der seine Galerie für die Bilder der Frauen aus Syrien und Afghanistan öffnet, mal sind es Familien und ihre Angestellten, die einen Supermarkt bewirtschaften und mit den von ihnen angebotenen Lebensmitteln die Bedürfnisse ihrer Kundschaft decken, oder es sind komplexe Körperschaften, die eine Vorstellung davon umsetzen, wie ein Bahnhof aussehen und beschaffen sein soll, die aushandeln, was für seinen Bau und für seinen späteren Betrieb an Vorkehrungen und Entscheidungen zu treffen sind. Gemeinsam ist all diesen Akteuren, dass sie nach mehr oder weniger erkennbaren Vorstellungen handeln, dass sie Regeln und Normen erlernen, verfolgen, verinnerlichen oder auch in Frage stellen, dass sie im wechselseitigen Umgang miteinander Routinen ausbilden, sie ihr HandelnHandeln gegebenenfalls auch mit anderen verhandeln und gegen konkurrierendes Handeln absichern oder durchsetzen. In diesem Sinne soll Kultur, übergreifend zu Kultur einer Gemeinschaft, einer GruppeGruppe, EthnieEthnie oder NationNation, als das Aushandeln von Bedeutungen3 verstanden werden und je nachdem, wie sich dieser Prozess materialisiert, in die Errichtung eines Bahnhofs, in das Singen einer Hymne oder in die Veranstaltung eines Stadtteilfests mündet. In Kapitel 2 wird dieses hier noch provisorische Verständnis von Kultur als AushandlungAushandlung von Bedeutung wieder aufgenommen.
Schließlich Transkulturalität. Auch dieser Begriff soll, ebenfalls noch provisorisch, anhand der Erfahrungen aus der Ortsbegehung bestimmt werden. Der Begriff der Transkulturalität schließt selbstverständlich an den Begriff der KulturKultur im gerade erwähnten Sinne an. Auch bei Transkulturalität liegt der Akzent auf den Prozessen des Aushandelns. Aber weitergehend als bei Kultur liegt der spezifische Akzent von Transkulturalität auf dem WandelWandel des Kulturellen, auf den aus der InteraktionInteraktion resultierenden Veränderungen und Brüchen, auf den Dynamiken der Auf-, Ab- und Umwertung, wie sie sich im Zusammenhang mit – und nun einige der schon mehrfach erwähnten Stichwörter – Mobilität und MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel-, KontaktKontakt, VernetzungVernetzung und VerflechtungVerflechtung, DistinktionDistinktion, Differenz und HeterogenitätHeterogenität usw. manifestieren.
Die Diskussion über Transkulturalität hat ihren Platz da, wo es um kulturelle Verhältnisse, um Kontakte zwischen und Dynamiken innerhalb von Kulturen – hier nun im Plural – und insbesondere um die damit einhergehenden Prozesse des Wandels von kulturellen Praxen und Formen geht. Überall da, wo Menschen als Agenten und Produzenten von KulturKultur und kulturellen Verhältnissen in Kontakt stehen, stellen sich Fragen danach, wie sich die kulturellen Beziehungen, Produkte und letztlich, wie sie selbst sich verändern. Diese Prozesse sind nicht abstrakt, sondern sie ereignen sich in Zeit und Raum, in MachtMacht, -verhältnisse- und Hierarchieverhältnissen und in den konkreten Formen der Artikulation dieser Verhältnisse: in AlltagsritenAlltagsriten und HabitusHabitus, bei der ArbeitArbeit und in Arbeitsverhältnissen, in der BildungBildung, in den Wissenschaften, in den Literaturen, Religionen, Sprachen, Künsten, in den Anschauungen über Ernährung, Gesundheit, Kindererziehung, in der Nutzung von Technologien und nicht zuletzt in der Konstruktion von Geschichte und im Umgang mit ihren Artefakten. Insoweit versteht es sich von selbst, dass sich viele Disziplinen und Forschungsfelder für ‚Transkulturalität’ interessieren: AnthropologieAnthropologie, ArbeitswissenschaftenArbeitswissenschaften, DenkmalpflegeDenkmalpflege, EthnologieEthnologie, ErziehungswissenschaftenErziehungswissenschaften, GenderforschungGender Studies, Genderforschung, Geschichte, Gesundheits- und PflegewissenschaftenGesundheits- und Pflegewissenschaften, prominent die Kommunikations-, Kultur- und Literaturwissenschaften, Medienwissenschaften, MigrationsforschungMigrationsforschung, MusikwissenschaftMusikwissenschaft, PhilosophiePhilosophie, PolitikwissenschaftPolitikwissenschaft, PsychologiePsychologie, ReligionswissenschaftReligionswissenschaft, SoziologieSoziologie, SprachwissenschaftLinguistik, TranslationswissenschaftTranslationswissenschaft und andere.
Es sieht ganz danach aus, dass in diesen Disziplinen ‚Transkulturalität’ hauptsächlich als ein deskriptiver Begriff verstanden wird, um KulturKultur und Kulturen in ihrer Prozesshaftigkeit zu erschließen, sie in ihrer EmergenzEmergenz, in ihrer (selektiven) AneignungAneignung, in ihrer MediationMediation und ÜbersetzungÜbersetzungmaschinelle -, ihrer Umdeutung, Neukonfiguration und nicht zuletzt auch in dem zu verstehen, wie sie erinnert und im kulturellen GedächtnisGedächtniskulturelles für die Gestaltung aktueller Prozesse verfügbar gehalten werden.
Erkennbar ist weiterhin, dass heute die Kulturkontakte und Wandelprozesse im Kontext von MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und GlobalisierungGlobalisierung im Zentrum stehen und sie hier eine breite empirische Basis finden. Relativ selten wird ‚Transkulturalität’ als ein normativer Begriff in Stellung gebracht, um mit ihm verwandte Konzepte, insbesondere den MultikulturalismusMultikulturalismus als ein Konzept des politischen HandelnHandelnpolitisches –s und der GesellschaftstheorieGesellschaftstheorie, zu kritisieren, wenn nicht gar zu denunzieren.4
Komplementär zu den Prozessen transkulturellen Wandels geht es in der Forschung immer wieder auch darum, durch eine Veränderung der Blickrichtung, der Theorien und Methoden neue Erkenntnisse zu „alten Gegenständen“ zu erlangen. So werden unhinterfragte Ausgangsthesen auf den Prüfstand gestellt, der Erkenntnisrahmen verändert, andere Zusammenhänge hergestellt oder bisher Unberücksichtigtes erhält Bedeutung. Transkulturalität als Perspektive der Forschung stellt somit nicht nur ein Korrektiv zu Betrachtungsweisen dar, die von Annahmen der HomogenitätHomogenität, der Abgeschlossenheit, der Stase oder der Fixiertheit des Kulturellen geleitet sind. Transkulturalität als Perspektive bedeutet somit im Umkehrschluss, kulturell eingeübte und verfestigte Betrachtungsweisen und stehende Weisheiten gegen den Strich zu bürsten, um Anderes und Neues entdecken zu können. Ganz in diesem Sinne forderte ein Soziologe wie Ulrich Beck seine Zunft auf, den „methodologischen NationalismusNationalismusmethodologischer –“ (vgl. Beck/Grande 2010, Wimmer/Glick Schiller 2002) aufzubrechen, der es bewirke, Gesellschaft und PolitikPolitikKultur-, Sprachpolitik, Sozial-, das Kulturelle darin eingeschlossen, in einer nationalen Begrifflichkeit zu denken, so als wäre es die natürlichste Sache der Welt.
1.3 Gegenstand und Ziele des Buchs
Forschungen zur Transkulturalität untersuchen den WandelWandel des Kulturellen im Zeitalter von GlobalisierungGlobalisierung, verstanden als eine lange Periode der Geschichte der Menschheit, die mit der Herausbildung von Groß- und Kolonialreichen einsetzt, die eine Zäsur mit der Herausbildung nationalstaatlichen Denkens und Handelns erfährt und ihren vorläufigen Höhepunkt in der globalen VernetzungVernetzung und in der ErosionErosion eindeutiger GrenzenGrenze(n) erreicht, die zuvor Staaten, Märkte, Zivilisationen, Kulturen, Lebenswelten und Menschen trennten.1 Die Chiffre für diesen Wandel des Kulturellen besteht in der wachsenden und sich weiter beschleunigenden Vernetzung und VerflechtungVerflechtung der Akteure und zugleich in den dabei entstehenden existentiellen globalen Konfrontationen und Verstrickungen. Seine Resultante stellt das Aushandeln von DifferenzDifferenz, Prozesse der Öffnung und SchließungSchließungProzess der sozialen – sowie die EmergenzEmergenz neuer kultureller Formen und Praktiken dar. Die Corona-Pandemie einerseits und die sogenannte „Flüchtlingskrise“ andererseits führen diese Dynamiken nachdrücklich vor Augen. Mit deren Analyse befassen sich vorzugsweise PolitikwissenschaftPolitikwissenschaft, SoziologieSoziologie, Gesundheitswissenschaften, MigrationsforschungMigrationsforschung, KonfliktforschungKonfliktforschung und andere. Der Gegenstand des vorliegenden Buchs ist jedoch ein wenig anders kalibriert, vor allem weniger breit. Der Band widmet sich dem Forschungsfeld der Transkulturalität aus einer kulturwissenschaftlichen und philologischen Perspektive. Er geht davon aus, dass
1 Gemeinschaften wie IndividuenIndividuum, Individuen mit ihren Sprachen, Literaturen, Medien und anderen kulturellen Manifestationen sich nicht in ethnisch abgeschlossenen, sprachlich homogenen und territorial abgegrenzten Räumen konstituieren, sondern durch (grenzüberschreitende) VerflechtungenVerflechtungen, die sich im Wesentlichen aus Kontakt, MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und MobilitätMobilität ergeben;
2 Kulturen sich in ihrer Verschiedenheit begegnen und der KontaktKontakt zwischen ihnen auf AushandlungenAushandlungen angewiesen ist. Damit kommen vielfältige Prozesse der MischungMischung, der Vermittlung und ÜbersetzungÜbersetzungmaschinelle -, der ErosionErosion von GrenzenGrenze(n), der ErinnerungErinnerung, – in Bewegung, der Umwertung und der Dynamisierung in Gang, die wiederum in MachtMacht, -verhältnisse-, Hegemonie- und Verwertungsprozesse eingebunden sind;
3 ein Perspektivenwechsel erfolgt: von den Kulturen von Gemeinschaften zu den IndividuenIndividuum, Individuen und ihren kulturellen Praktiken. Dieser Perspektivenwechsel bedeutet zugleich, anstelle der den Gemeinschaften unterstellten HomogenitätHomogenität den Akzent auf DistinktionDistinktion, DifferenzDifferenz und HeterogenitätHeterogenität innerhalb und zwischen Individuen und Gruppen zu verlagern.
4 in diesen Verflechtungs- und Austauschbeziehungen immer auch unerwartete, unbeabsichtigte und neue kulturelle Formen und Praktiken entstehen. In theoretischer Hinsicht bedeutet das, dass Transkulturalität nicht nur differenztheoretischdifferenztheoretisch (wie bei Bi-, Multi- und InterkulturalitätInterkulturalität), sondern auch emergenztheoretischemergenztheoretisch zu modellieren ist.
5 unter Rückgriff auf den Begriff der ‚Transkulturation‘, wie ihn der kubanische Anthropologe Fernando Ortiz (1940) – er spricht von ‚transculturación‘ – für den Prozess des Wandels von Kulturen und kulturellen Verhältnissen eingeführt hat, ‚Transkulturalität‘ als Strukturaspekt dieses Prozesses zu verstehen ist;
6 Transkulturalität als Konzept somit auf die rasant anwachsende Vielfalt in den Sozialisationsformen im Zeitalter von GlobalisierungGlobalisierung, InternetInternet und Computertechnologien einerseits und den „Kulturalisierungsregimes“ (Reckwitz 2016) im SpätkapitalismusSpätkapitalismus andererseits reagiert und sich in individuellen Mobilitätsprofilen und individuellen Ausdrucks- und Aneignungsformen kultureller Praktiken niederschlägt – zugespitzt formuliert: jedes IndividuumIndividuum, Individuen hat (s)eine KulturKultur.
Im Zuge der Globalisierungsdiskussion der späten 1990er und der 2000er Jahre gewinnt der Begriff der Transkulturalität rasch an Attraktivität in EthnologieEthnologie und AnthropologieAnthropologie, den ErziehungswissenschaftenErziehungswissenschaften, der GenderforschungGender Studies, Genderforschung, PhilosophiePhilosophie, Geschichte, MusikwissenschaftMusikwissenschaft, PolitikwissenschaftPolitikwissenschaft, SoziologieSoziologie und anderen Disziplinen, um die kulturellen Vernetzungs- und Austauschbeziehungen nicht nur im SpätkapitalismusSpätkapitalismus, sondern auch in den verschiedenen Phasen der GlobalisierungGlobalisierung zu erforschen, die mit der Entstehung von Großreichen2 und den kolonialen Eroberungen einsetzt. Dafür zentral sind durch die Geschichte hindurch Prozesse des Kulturkontakts, der MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- und MobilitätMobilität, die nun, im Spätkapitalismus, vom technologischen WandelWandel des Internetzeitalters und seiner Kommunikationsformen nicht nur flankiert, sondern potenziert werden.
Das Ziel des Buchs besteht darin zu zeigen, was die sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen dafür sind, dass transkulturelle Betrachtungsweisen heute einen prominenten Platz in der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung einnehmen. Dies schließt ein, die Herausbildung und den WandelWandel des Konzepts der Transkulturalität seit den 1940er Jahren zu rekonstruieren und es im Verhältnis zu anderen Konzepten des Kulturkontakts und den Strategien des Managements kultureller KonflikteKonflikt wie BikulturalitätBikulturalismus, Bikulturalität, Multikulturali-tät/-ismus und InterkulturalitätInterkulturalität zu betrachten. Einen Referenzpunkt – und dies gleich in zweifacher Hinsicht – stellt hierbei der Kulturbegriff dar, wie er anlässlich der zweiten Weltkonferenz der UNESCOWeltkonferenz der UNESCO 1982 zwischen 129 Staaten ausgehandelt wurde: einerseits im Hinblick darauf, wie zum damaligen Zeitpunkt KulturKultur und Kulturen definiert wurden, und andererseits, wie sich seither – nach dem Ende des Kalten Krieges (1989/90), mit dem NeoliberalismusNeoliberalismus, der weiteren Beschleunigung der GlobalisierungGlobalisierung, der wachsenden MigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel-, dem InternetInternet – die kulturellen Verhältnisse verändert haben und neue Sichtweisen auf Kultur(en) erfordern. Wenn ein Kultursoziologe wie Reckwitz (2016) die Aufmerksamkeit auf die „Kulturalisierungsregimes“ im SpätkapitalismusSpätkapitalismus lenkt, geht es für Sprach-, Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen darum, die dabei in Gang kommenden transkulturellen Prozesse und Praktiken eingehend zu untersuchen.
In diesem Sinne ist es ein weiteres Anliegen des Buchs, einige der für Transkulturalität zentralen Forschungsfelder und Konzepte wie HybriditätHybridität, DiasporaDiaspora, TranslatioTranslatio, migrantisches SchreibenSchreiben, Schreibung, ErinnerungErinnerung, – in Bewegung, Sprachbiografien, GenerationGeneration, KosmopolitismusKosmopolitismus u.a. zu diskutieren, bevor der Frage nachgegangen wird, welche Bedeutung Sprache, Sprachen und MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit im Kontext von Transkulturalität haben.
In struktureller Hinsicht besteht der Band aus sechs Kapiteln. Im Anschluss an Kapitel 1, in welchem ein Bogen von einer ethnografisch angelegten Ortsbegehung des Bahnhofsviertels in Frankfurt am MainFrankfurt am Main zu Gegenstand und Zielen des Buchs geschlagen wird, steht in Kapitel 2 die Problematik von KulturKultur und Kulturen im KonfliktmanagementKonfliktmanagement im Mittelpunkt. Es knüpft, wie das Buch insgesamt, an die Forschungserfahrungen des Autors in KanadaKanada/Canada, FrankreichFrankreich, DeutschlandDeutschland, in Teilen AfrikasAfrika und in der Republik MoldauMoldau, Republik Moldau, Moldova bezüglich des MultikulturalismusMultikulturalismus, der InterkulturalitätInterkulturalität und der Transkulturalität an, um anschließend die mit Transkulturalität verbundenen Sichtweisen und Handlungsformen – auch im Unterschied zu Multi- und zu Interkulturalität – herauszuarbeiten. Aufgabe dieses Kapitels ist dabei auch, zum theoretischen Kern der Problematik von Kultur und Transkulturalität vorzustoßen. Er besteht darin, anhand der Konzepte von UngleichheitUngleichheit, Differenz und EmergenzEmergenz sowohl die differenztheoretischedifferenztheoretisch als auch die emergenztheoretischeemergenztheoretisch Dimension von Transkulturalität herauszuarbeiten. Kapitel 3 rekonstruiert die Begriffsgeschichte von Transkulturalität seit den 1940er Jahren unter der Fragestellung, ob es sich dabei um MigrationMigrationMigrationArbeits-, Bildungs-, Heirats-, Pendel- oder um mehrfache Neuerfindung eines Konzepts handelt. In Kapitel 4 werden ausgewählte Schlüsselbegriffe und Forschungsfelder diskutiert, die zum Verständnis transkultureller Prozesse und Perspektiven erforderlich sind: HybriditätHybridität, DiasporaDiaspora, KulturtransferKulturtransfer, Erinnerungskulturen, ÜbersetzungÜbersetzungmaschinelle - etc. Schließlich geht es in Kapitel 5 um die Beziehung von Transkulturalität und Sprache, indem danach gefragt wird, wie die sprachwissenschaftlichen Zugriffe auf Phänomene der Transkulturalität im Sinne von Kontakt und MischungMischung, von Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit in Migrationsgesellschaften aussehen. Abgeschlossen wird der Band mit einer erneuten Perspektivenumkehr und mit Überlegungen dazu, wie sich die Forschung auf dem Feld der Transkulturalität operationalisieren lässt. Standen bisher die Prozesse der Verflechtung im Zentrum, so lenkt Kapitel 6 die Aufmerksamkeit auf methodische Prozeduren der Entflechtung, um auf diese Weise die Elemente der Struktur von Transkulturalität freizulegen und analytisch zugänglich zu machen.