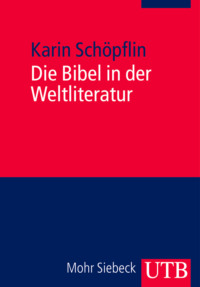Kitabı oku: «Die Bibel in der Weltliteratur», sayfa 3
Deutung der Schlange und weitere FragenWirkungsgeschichtlich ist neben der Frage von Sünde und Tod eine Fülle weiterer Aspekte mit dieser Erzählung verbunden: Die Schlange wurde als Verkörperung des Bösen, als Gegenspieler |30|Gottes verstanden und somit als Satan, Luzifer oder Teufel, der als Versucher auftritt. Versteht man die Schlange als Erscheinungsform Satans, drängt sich als nächstes die Frage nach dem Verhältnis des Versuchers zu Gott auf und damit nach Ursprung und Ursache des Bösen. Mit der Versuchung Evas durch die Schlange ist die Frage nach der Rolle der Frau verknüpft: Warum wendet sich die Schlange an die Frau? Ist sie zugänglicher oder anfälliger als der Mann? Tritt Eva dem Mann gegenüber ihrerseits als Versucherin auf? Setzt sie dabei erotische Reize als Verlockung ein? Welche Rolle spielt Sexualität im Paradiesgarten – wird sie praktiziert oder nicht, ändert sich durch den Sündenfall ihre Wertigkeit? Will die Art (Eva als „Adams Rippe“) und Reihenfolge der Erschaffung der Geschlechter etwas über eine Rangordnung von Mann und Frau aussagen? Wie ist es generell um die Entscheidungsfreiheit des Menschen bestellt?
Erklärende HerleitungenDeutlich ist, dass diese Erzählung bekannte Gegebenheiten als Veränderungen gegenüber einem früheren Zustand erklären will: Vor allem leitet sie harte Existenzbedingungen – Mühsal des Broterwerbs, der Geburt, des Getrennt-Seins von Gott – von menschlichem Ungehorsam her. Weitere Herleitungen betreffen Namen und Bezeichnungen, die Stellung des Menschen zum Tier, menschliches Schamgefühl und Bekleidung. Während die Schöpfung nach Gen 1 vollkommen gut ist, bezieht Gen 2–3 auch den Gegensatz von gut und böse ein. Wissenschaftlich betrachtet galt Gen 2–3 traditionell wegen der mythologischen Züge als älter als Gen 1, doch sieht man die zweite Erzählung heute durchaus auch als eine jüngere Korrektur zu Gen 1, die der tatsächlichen Erfahrungswelt Rechnung tragen möchte. Gen 2–3 rückt den Menschen stärker in den Mittelpunkt als Gen 1. Gott, der sich in Gen 1 jeder Vorstellbarkeit entzieht, ist hier buchstäblich handgreiflicher geschildert und offensichtlich in Menschengestalt gedacht[36]. Er tritt nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Gesetzgeber und Richter auf.
|31|Literarisch
Als markante Elemente bleiben aus Gen 1 der Anfangssatz mit dem „Im Anfang“[37], das Sieben-Tage-Schema und das Erschaffen durch das Wort Gottes im Gedächtnis und die hervorgehobene Position des Menschen als Ebenbild Gottes. Gen 2–3 ist hingegen durch einprägsame Szenen als Erzählung prominenter: Gott formt und belebt den Menschen, schafft die Frau aus seiner Rippe; die Schlange verführt die Frau zum Essen der verbotenen Frucht; das Paar wird aus dem Paradies vertrieben. Die beiden besonderen Bäume und die Wächtergestalten, die eine Rückkehr in den Garten verhindern, bilden markante Motive. In der Literatur – wie in der bildenden Kunst – entfaltete Gen 2–3 die stärkere Wirkung. Was die Bibel in zwei Erzählungen bietet, muss jedoch nicht säuberlich getrennt rezipiert werden.
Lob des SchöpfersDer Schöpfergott und seine wohl geordnete, sehr gute Weltschöpfung sind auch andernorts in der Bibel Gegenstand hymnischer Dichtung, nämlich in einer Reihe von Psalmen[38]. Man vergleiche etwa Ps 104,2–9 mit den ersten drei Tagen in Gen 1 oder Ps 8,4–9 mit der Erschaffung des Menschen nach Gen 1,26–28. Dieses Schöpferlob wird auch in Gedichten vernehmbar, und es kann sich darüber hinaus in Dichtungen spiegeln, die die Natur in ihrer Schönheit und Erhabenheit besingen.
▪ Christian Fürchtegott Gellert – Die Ehre Gottes aus der Natur. Gellert (1715–1769), Sohn eines Predigers, der selbst Theologie und Philosophie in Leipzig studierte, dichtete 1757:
Die Ehre Gottes aus der Natur
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
|32|Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!
5Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kömmt und leuchtet und lacht uns von ferne,
Und läuft den Weg, gleich als ein Held.
Vernimm’s, und siehe die Wunder der Werke,
10Die die Natur dir aufgestellt!
Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke
Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?
Kannst du der Wesen unzählbare Heere,
Den kleinsten Staub fühllos beschaun?
15Durch wen ist alles? O gib ihm die Ehre!
Mir, ruft der Herr, sollst du vertraun.
Mein ist die Kraft, mein ist Himmel und Erde;
An meinen Werken kennst du mich.
Ich bin’s und werde sein, der ich sein werde,
20Dein Gott und Vater ewiglich.
Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte,
Ein Gott der Ordnung und dein Heil;
Ich bin’s! Mich liebe von ganzem Gemüte,
Und nimm an meiner Gnade teil.[39]
Gellert lehnt einige der Verse an Ps 19 an[40]. Die Abfolge von Himmel, Erde, Meer und Himmelskörpern orientiert sich deutlich an den Schöpfungswerken der ersten vier Tage in Gen 1,6–19, die „Wesen“ in V. 13 verweisen mindestens auf die Tierwelt (Gen 1,20–25). Die Schöpfungswerke bezeugen den Schöpfer, seine Weisheit und seine Macht. Der Sprecher des Gedichts, den man mit dem Dichter wird identifizieren dürfen, spricht seinen Leser, den Menschen (V. 4), mit Aufforderungen und Fragen an, um ihn zum Erkennen Gottes in seiner Schöpfung und zum Gotteslob zu bewegen. Das Stichwort „Ehre“ fasst den ersten Teil (V. 1–15) ein. Mit V. 16 beginnt eine Gottesrede, die den zweiten Teil ausmacht (V. 16–24). Darin stellt Gott sich einerseits vor (V. 17–23a) – unter Verwendung der Selbstvorstellung Jahwehs Mose gegenüber (Ex 3,14) in V. 19 –, andererseits fordert er den Menschen auf, ihm Vertrauen und Liebe zu schenken (V. 16; 23b) – auch dies mit einer Anspielung auf eine biblische Aussage, nämlich Dtn 6,5.
Motiv des GartensAus Gen 2–3 findet das Motiv des Gartens literarische Verwendung. Der Garten in Eden trägt Züge, die für den in klassischer |33|antiker Dichtung geläufigen Topos eines locus amoenus[41] charakteristisch sind: Wasserreichtum, üppige Vegetation, Bäume, die Früchte tragen und vermutlich auch Schatten spenden. Dieser Garten Eden ist ein irdisches ParadiesParadies und verkörpert als solches einen besseren Zustand am Anfang der Menschheitsgeschichte, der verloren ist, ein Ideal, nach dem man sich zurücksehnt. Das Motiv vom Paradiesgarten Eden kann erweitert werden, etwa um das Motiv des Tierfriedens, das sich biblisch in Jes 11,6–8 findet.
Der Garten als Ort des Rückzugs aus der Welt▪ Andrew Marvell – Der Garten. Ein Beispiel für die literarische Nutzung des Gartenmotivs bietet Andrew Marvells Gedicht Der Garten[42]. Marvell (1621–1678) zählt zu den „metaphysical poets“, deren Dichtung religiöse und weltliche Themen behandelt und sich durch geistreich zugespitzte Sprache voller Bilder, Anspielungen und Mehrdeutigkeiten auszeichnet. In den neun, aus jeweils acht paarweise gereimten Versen bestehenden Strophen seines Gedichts entwirft Marvell das Bild eines paradiesischen Gartens, den das lyrische Ich als Refugium genießt. Der Garten weist alle Züge eines locus amoenus auf, die nach und nach erkennbar werden: üppiges Grün, Schatten spendende Bäume, reichlich Früchte tragende Obstbäume, Blumen und Gras, ein Brunnen und schließlich – als besonderes zuletzt genanntes Element – eine als Blumenbeet gestaltete Sonnenuhr, in der Bienen fleißig summen. Der Garten bildet eine Gegenwelt zum gesellschaftlichen Leben außerhalb: Draußen strengt man sich an, um Auszeichnungen zu erlangen: Palm-, Eichen- oder Lorbeerzweige, mit denen Menschen für militärische oder politische Verdienste geehrt oder als Dichter bekränzt werden. Solch strebsamem Mühen steht die Erholung im Garten gegenüber (1–8). Dort findet das Ich Stille und Unschuld vor sowie köstliche Einsamkeit (9–16). Die Schönheit des Gartens, sein Grün, empfindet es als den weiblichen Reizen – in der Liebeslyrik mit den Farben Weiß und Rot assoziiert – einer oft grausamen Geliebten überlegen (17–24). Auf Gen 2–3 beziehen sich V. 33–40, wo dem Sprecher die üppig wachsenden Äpfel und Trauben geradezu in den Mund wachsen, Nektarfrüchte |34|und Pfirsiche sich seinen Händen anbieten und er über Melonen strauchelt, so dass er in Blumen verfangen ins Gras fällt[43].
Umdeutung des SündenfallsDieser durch Früchte verursachte, buchstäbliche Fall ist anders als der Sündenfall harmlos. Neben den Sinnen wird auch der Geist in diesem Garten beglückt, indem er schließlich eine geradezu mystische Einigung mit dem Garten eingeht (41–48)[44]. Die Seele lässt den Körper hinter sich und wird wie ein Vogel, der sich in den Zweigen wiegt (49–56). Hat das lyrische Ich in sieben Strophen sein Erleben im Garten beschrieben, fügt es in der achten Strophe einen zusammenfassenden Kommentar ein:
So selig war der Garten-Stand,
Eh Adam die Gehilfin fand –
Nach solchem himmlisch reinen Ort,
Tat da noch andere Hilfe not?
Doch Sterblichen wars nicht gegeben,
Dort einsam wandelnd hinzuleben –
Zwei Paradiese müßtens sein,
Wär man im Paradies allein.[45] (57–64)
und der ZweisamkeitDas Geschilderte entspricht dem glücklichen Zustand des Menschen, als er noch allein im Paradiesgarten lebte. Einer anderen passenden Hilfe (vgl. Gen 2,18) als des Gartens selbst hätte es nicht bedurft; doch war es dem Menschen nicht vergönnt, ein Einzelgänger darin zu bleiben. Den Zustand des Menschen vor der Erschaffung der Frau bezeichnet Marvell als doppeltes Paradies in einem doppelten Sinne: ein zweifaches Paradies bedeutet |35|eine Steigerung gegenüber einem einfachen; da die Frau aus der Rippe des Mannes entstehen wird, ist sie implizit als Teil des Mannes doch auch schon inbegriffen, so dass so gesehen zwei auf einmal das Paradies erleben.
Marvell spielt auf subtile Weise mit dem Gartenmotiv. Es schillert zwischen einem realistischen Barockgarten, der am deutlichsten in der Sonnenuhr der Schlussstrophe greifbar wird, und einem Ideal, das dem Menschen Sorglosigkeit, Selbstbesinnung und Selbstverwirklichung ermöglicht. Marvell schildert den Rückzug aus der Gesellschaft, die in ehrgeizigem Wettstreit und Liebesaffären zweifelhafte Erfüllung sucht, und die Rückkehr in einen glücklichen Zustand vor dem Sündenfall. Dabei nimmt der Dichter auch die biblische Tradition auf und ironisiert sie teilweise.
Inhalt▪ John Milton – Das verlorene Paradies. Das Epos von John Milton (1608–1674) erschien 1674 im Todesjahr des Dichters in seiner endgültigen Fassung in zwölf Büchern[46]. In knapp 10.000 Blankversen schildert die Dichtung die Erschaffung des Menschen und den Sündenfall nach Gen 2–3, stellt diese jedoch durch Rück- und Vorgriffe in einen weiten Kontext. Der Erschaffung des Menschen geht nicht nur die Weltschöpfung voraus[47], sondern vor allem die Auseinandersetzung zwischen Gott, der als Vater – Schöpfer und Weltenlenker – und Sohn – Richter und Erlöser – auftritt, nebst seinen himmlischen Heerscharen einerseits und Satan und den mit ihm abgefallenen Engeln als Gottes Gegenspielern andererseits. Auf außerirdischer Ebene vollzieht sich ein Kampf zwischen Gott und Teufel, Gut und Böse. Darin ist die Erschaffung der Welt und des Menschen durch Gott ebenso |36|begründet wie der Einbruch des Bösen in die Welt, der zur Versuchung des Menschen, dem Ungehorsam und der Vertreibung aus dem Paradies führt. In Ankündigungen und Prophezeiungen bezieht Milton außerdem immer wieder begleitend den Ausblick auf Leiden und Sterben Christi[48] ein sowie auf das Jüngste Gericht und das Ende der Zeiten.
Vorbilder MiltonsDichterische Form und Sprache sind den Homerischen Epen, die Milton auswendig kannte, und vor allem Vergils Aeneis verpflichtet. Zu den aufgegriffenen epischen Konventionen gehören etwa die Musenanrufe an Schaltstellen der Dichtung[49], das Nebeneinander von göttlichen und menschlichen Handlungsebenen, die miteinander in Kontakt treten, Schlachtenbeschreibungen, die Technik der erzählenden Rückblenden und epische Vergleiche. Christlich-biblische Inhalte werden somit in eine ursprünglich „heidnische“ klassisch-antike Form gegossen. Da Milton auch englische und italienische Literatur studiert hatte, nutzte er auch Dantes Epos La divina commedia als Vorbild; außerdem begegnen Bezugnahmen und Anspielungen auf Spensers und Shakespeares Werk, am häufigsten jedoch auf die Bibel. Milton spannt einen Bogen von Adam und Eva und ihrem Sündenfall hin zur Überwindung von Sünde und Tod durch Jesus Christus[50] und präsentiert so die ganze Heilsgeschichte.
Entwicklung der SatansgestaltAbgesehen von den Schriften des Alten und Neuen Testamentes bezieht Milton zu theologisch akzeptiertem, christlichem Gemeingut avancierte Traditionen ein. Dazu gehört vornehmlich die gegenüber den Ansätzen im Alten Testament[51] stark ausgemalte Vorstellung von Satan als Verkörperung des Bösen und durchaus selbständigem Widersacher Gottes, bestrebt den himmlischen Heilsplan zu durchkreuzen. Diese Entwicklung vollzieht sich im Judentum in außerkanonischer Literatur, vor allem |37|den so genannten zwischentestamentlichen Schriften[52]. Die Vorstellungen ergeben zwar kein ganz einheitliches Bild, doch wird Satan schließlich zum Fürsten der dämonischen Mächte[53], dessen unmittelbaren Gegenspieler der Erzengel Michael mit einem Heer von Engeln bildet. Außerdem entsteht rein spekulativ die Auffassung, dass Gott ganz am Anfang, also bevor Gen 1 einsetzt, Engelwesen geschaffen hat. Der Schönste dieser Engel („Luzifer“, eigentlich „der Lichtträger“) begehrte gegen Gott auf und zettelte gemeinsam mit weiteren Engeln einen Aufstand an. Deshalb wurde er samt seinem Gefolge aus dem Himmel gestürzt in die Hölle, deren Fürst er seitdem ist. Auf diese Weise suchte man den Ursprung des Bösen zu erklären. Die Satansgestalt wurde auch mit den Geschehnissen in Gen 3 in Verbindung gebracht, also mit der Schlange identifiziert[54].
Satans NiederlageAus den zahlreichen biblischen Bezügen und Anspielungen in Miltons Epos sei hier die Darstellung des Vollzugs des Sündenfalls im 9. Buch herausgegriffen. Die Bücher 1–8 erzählen die Vorgeschichte dazu. Zu Beginn des 1. Buches erwachen Satan und sein Gefolge aus ihrer Betäubung nach dem Sturz aus dem Himmel auf einem feurigen Pfuhl in ihrem düsteren Gefängnis[55]. Satan und Beelzebub, beide gefallene Cheruben, erinnern sich an ihren Fall aus dem Reich des Lichts, nachdem sie die Schlacht gegen Gott verloren hatten. Doch Satan gibt sich nicht geschlagen:
Stets Böses tun uns einzige Lust wird sein.
Denn Böses ist der Widerpart von dem,
Was er will, unser Feind. Wenn Gutes er
Aus unserm Bösen zu erzeugen sucht,
Dann müssen wir vereiteln seinen Zweck
Und Gutes selbst dem Bösen dienstbar machen: (1,160–165)
Ratsversammlung in der HölleSatan spricht zum Heer der bösen Engel von seinem geplanten Angriff auf eine neue Welt und ein neues Geschlecht, von dem er gerüchteweise gehört hat. Im Höllenpalast halten die gefallenen |38|Engel eine Ratsversammlung ab und beauftragen Satan, die neu geschaffene Welt zu erkunden, um dort den Kampf gegen Gott fortzusetzen[56]. Satan durchquert die Hölle, an deren Tor die Personifizierungen von Sünde und Tod wachen, Satans Tochter und sein mit dieser gezeugter Sohn. Sie lassen Satan passieren, der nun durch das Reich von Nacht und Chaos weiterreist (2. Buch). Vom Himmel aus betrachtet Gott das Menschenpaar im Paradies und beobachtet Satans Reise. Im Gespräch mit seinem Sohn prophezeit Gott, dass Satan den Menschen, der über Willensfreiheit verfüge, verführen werde (3,95–99). Der göttliche HeilsplanGott-Vater stellt seine Gnade in Aussicht. Der Sohn Gottes bietet sich selbst als Sühnopfer an, und Gott setzt den Sohn zum Weltenrichter ein. Unterdessen erreicht Satan die Welt und passiert unerkannt den Engel Uriel, den Wächter des Sonnenkreises (3. Buch). Der Erzähler schildert nun Satans Gemütszustand[57], seine innere Zerrissenheit (4, 32–113). Weil Gott den Menschen an die Stelle der gestürzten Engel gesetzt hat (4,105–107), nimmt Satan sich schließlich vor: „Sei, Böses, du mein Gut!“ (4,110). Weil Satan dabei wütend gestikuliert, erkennt Uriel nun den Eindringling. Satan dringt ins Paradies einSatan betritt das Paradies[58] und setzt sich in Gestalt eines Raben auf den Baum des Lebens. Von dort erblickt er das Menschenpaar „das Abbild ihres Schöpfers“ (4,292), dessen Schönheit und Würde er bewundert, ja, die er gern haben könnte (4,358–365). In einen Löwen verwandelt, schleicht er sich nahe an die Menschen heran, belauscht sie und erfährt dadurch von dem Verbot Gottes hinsichtlich des Baumes der Erkenntnis[59]. Angesichts der Liebe der beiden zueinander empfindet Satan |39|Neid. Während Satan weiter durch den Garten schweift, verrichten Adam und Eva ihr Nachtgebet, bevor sie in ihrer Laube die eheliche Liebe genießen. Von Uriel alarmiert sucht Gabriel mit seinen Engeln nach dem Eindringling und findet Satan in Gestalt einer Kröte, die der schlafenden Eva ins Ohr flüstert. Im Verhör durch Gabriel zeigt Satan sich trotzig und entflieht schließlich (4. Buch).
Am nächsten Morgen erzählt Eva Adam ihren Traum: eine Stimme, die sie für Adams hielt, lockte sie zum verbotenen Baum. Dort erblickte sie einen Engel, der von den Früchten aß und auch sie dazu veranlasste. Sie aß und erhob sich mit dem Engel in die Wolken. Adam versucht, Eva mit einer Traumtheorie zu beruhigen, bevor sie ihr Morgengebet verrichten. Gott sendet Raphael zu Adam, damit er ihn zum Gehorsam gegen Gott ermahne. Raphael erzählt Adam von Satans SturzRaphael erzählt Adam, wie es seinerzeit zum Engelssturz kam: Gott stellte in der himmlischen Versammlung der Engel seinen Sohn vor. Satan „[d]er Ersten einer, wenn der Erste nicht“ (5,660), war neidisch auf den Sohn Gottes, brachte ein Drittel der Engel auf seine Seite und stachelte sie zur Rebellion gegen Gott an. Gott und der Sohn bemerkten die Absicht, waren aber sicher, dass sie die Abtrünnigen unterwerfen und dadurch umso mehr verherrlicht sein würden (5. Buch). Nach dreitägigem Kampf unterlag Satan den von Michael und Gabriel geführten himmlischen Heerscharen und wurde mit den Seinen in die Hölle hinab gestoßen, während der Gottessohn triumphierte (6. Buch).
und von der Erschaffung der WeltAuf Bitten Adams erzählt Raphael auch von der Erschaffung der Welt. Gott wollte damit den Verlust ausgleichen, der durch den Engelssturz entstanden war, und beauftragte den Sohn mit der Erschaffung der Welt („Sprich, und es geschieht;“, 7,164)[60]. Dies Schöpfungsgeschehen beschreibt Milton in Anlehnung an Gen 1 (7,190–634) mit gelegentlichen kleinen Anleihen aus Gen 2[61]. Nachdem Raphael ihm noch die Bewegungen der Himmelskörper erklärt hat, warnt er Adam, nach Dingen zu trachten, die ihm zu hoch sind (8,167–178). Adams ErinnerungenAdam schildert dem Erzengel seine Erinnerungen an seine ersten Lebenstage (8,250ff.). Darin |40|erwähnt Adam selbst nochmals Gottes Verbot, dessen Formulierung zeigt, dass der Mensch durch dessen Übertretung erst sterblich wird[62]. Zudem erinnert Adam sich an die Erschaffung Evas und schildert seine Empfindungen für sie (8,328–359); es wird klar, dass seine Schwäche für die Frau ihn angreifbar machen könnte. Nicht umsonst schärft der Engel ihm den Unterschied zwischen Liebe und Leidenschaft ein (8, 561–594) und die Mahnung, dass Liebe zu Gott, gehorsam sein bedeutet – für Menschen und Engel gleichermaßen (8,633–634).
Der SündenfallDamit sind alle Voraussetzungen für die Sündenfallgeschichte geschaffen, die Milton im 9. Buch umsetzt. Abends dringt Satan wieder in das Paradies ein auf der Suche nach einem Tier als Werkzeug für sein Vorhaben. Er wählt die Schlange, weil sie von Natur schlau ist und deshalb niemand Verdacht schöpfen wird, wenn er durch sie spricht (9,91–96). Satans Aktivität geht ein Selbstgespräch voraus (9,99–178), das die Motivation seines Handelns erhellt („einzig im Zerstören findet Ruh / Mein mitleidsloser Sinn.“, 9,129–130).
Mein sei, von allen Höllenmächten mein,
Der Ruhm, in einem Tag verderbt zu haben,
Woran er, der allmächtig heißt, sechs Tag
Und Nächte schuf […]. (9,135–138)
Obwohl er es als Schmach empfindet, schlüpft er in die Schlange und erwartet den Morgen.
Eva schlägt Adam an diesem Morgen vor, dass sie sich bei der Gartenarbeit trennen sollten, um sich nicht gegenseitig vom Arbeiten abzulenken. Als Adam Bedenken hegt, versteht Eva dies als Misstrauen, Adam beschwichtigt, er mache sich lediglich Sorgen[63], und mahnt Eva zur Wachsamkeit. Das Gespräch des Paares (9,204–384) offenbart erste Risse in ihrer bisher harmonischen Zweisamkeit. Eva macht sich allein auf den Weg. Als Satan in Gestalt der Schlange die Frau bei der Gartenarbeit erblickt, vergisst er angesichts ihrer Anmut für einen Moment seine böse Absicht (9,455–466), ruft sich jedoch alsbald seinen Plan ins Gedächtnis |41|und will die günstige Gelegenheit nutzen; denn die Frau ist allein – ihren Gatten fürchtet Satan, weil jener über höhere Einsicht verfügt (9,473–493).
Eva und die SchlangeDa die Schlange damals noch eine imposante Erscheinung war, erregt sie Evas Aufmerksamkeit, als sie scheinbar zögernd herangleitet. Schließlich schmeichelt die Satan-Schlange Eva, indem sie deren Schönheit als göttlich preist:
Dich, deines Schöpfers schönstes Ebenbild,
Betrachten staunend alle Wesen; dir
Gehören all, und alle beten sie
Beseligt deine Himmelsschönheit an. (9,538–541)
Eva wundert sich, dass die Schlange sprechen kann, und fragt das Tier, wie es dazu kam. Nun erzählt die Schlange der Frau (9,568–605), dass sie verlockende Äpfel verzehrt habe. Auch andere Tiere begehrten die Früchte dieses Baumes, vermochten sie jedoch nicht zu erreichen, während sie sich an dem Stamm empor geschlängelt habe. Nach dem Verzehr spürte sie eine Veränderung: Sie konnte nun sprechen und über himmlische und weltliche Dinge spekulieren. Die Rede endet mit neuerlicher Schmeichelei:
[…] alles Schöne find ich, alles Gute
In deiner Schönheit Himmelsstrahl, in dir,
Du Bild der Göttlichkeit, vereint. (9,606–608)
Die Schlange will Eva als Gebieterin der Welt anbeten. Eva lässt sich zu dem Baum führen, erkennt in ihm den verbotenen Baum und erwähnt Gottes Verbot. Damit ist die Konstellation erreicht, in der Gen 3,1 einsetzt. Die biblische Szene gestaltet Milton in den folgenden Versen nach[64]. Dabei erfährt insbesondere die zweite Rede der Schlange (Gen 3,4–5) eine breitere rhetorische Ausgestaltung. Zunächst verharmlost Satan die Todesdrohung[65]: Nach dem (angeblichen) Genuss der verbotenen Frucht ist die Schlange noch am Leben und vermag durch die gewonnene Erkenntnis Gottes Motivation für das Verbot zu durchschauen. Gott müsste ihren Mut loben, wenn sich die Menschen um Erkenntnis bemühen:
|42|Nach Gutem forschen – löbliches Bemühn!
Und Böses, wenn es wirklich Böses gibt,
Müßt ihr’s nicht kennen, wenn ihr’s meiden soll? (9,697–699)
Tatsächlich aber wolle Gott sie unwissend halten, damit sie ihm dienen. Die Wirkung des Apfels ist nämlich: „Ich Tier ward Mensch; ihr Menschen werdet Götter.“ (9,712). So fordert Satan Eva zum Essen der Frucht auf: „Huldreiche Göttin, pflücke denn und iß!“ (9,732). Eva denkt über die Worte der Schlange nach (9,745–779), die ihre Wirkung nicht verfehlt haben: Im Gegensatz zu Gott erscheint das Tier nicht missgünstig, da es das gewonnene Gut mit den Menschen teilen will, und das entscheidende Argument lautet:
Was also fürcht ich? Was ich fürchten soll,
Weiß ich’s denn, ich, die weder Gut noch Bös
Noch Gott und Tod, Gesetz und Strafe kennt? (9,773–775)
Das Essen der FruchtAls Eva die Frucht gepflückt und gegessen hat, schleicht sich die Schlange davon. Weil ihr nichts geschieht, meint Eva, dass Gott von der Übertretung nichts gemerkt hat. Sie überlegt nun, wie sie sich Adam gegenüber verhalten soll: Soll sie ihn teilhaben lassen oder die neue Kenntnis nutzen, „[u]m so des Weibes Mängel auszugleichen“ (9,821). Doch falls sie doch noch Tod als Strafe ereilen sollte, missgönnt sie einer anderen Eva die Gemeinschaft mit Adam. Deshalb soll Adam ihr Los teilen (9,795–833). Die Wirkung der Frucht zeigt sich also sofort in einer veränderten Haltung Evas. Unweit des Baumes trifft sie auf Adam und erzählt ihm begeistert, was sie getan hat. Sie begründet ihren Schritt damit, dass sie nur um Adams willen nach Göttlichkeit gestrebt habe[66], auch er solle essen, „damit uns gleiches Los / Verbinde […]“ (9,881). Adam ist zunächst sprachlos, dann beklagt er Evas Tat; doch weil sie ein Stück von ihm ist und er nicht ohne sie sein kann, will er ihr Los teilen. Adam ist zudem überzeugt, dass Gott sein vornehmstes Geschöpf nicht töten werde. Eva weiß diesen Liebesbeweis Adams zu schätzen. Der Erzähler kommentiert:
Und er, obgleich des Unrechts sich bewußt,
Er aß, nicht hintergangen, nicht getäuscht,
Nein, Weibesreizen töricht unterliegend! (9,997–999)
|43|Erste Auswirkungen auf die Beziehung von Adam und EvaNach dem Genuss der Frucht ist das Paar wie berauscht. Als eine erste Auswirkung wandelt sich ihre bislang zärtliche Liebe in „brünstige Sinnenlust“ („carnal desire“, 9,1013). Im Schlaf verfolgen sie böse Träume; Unschuld, Vertrauen, Redlichkeit und Ehrgefühl sind verschwunden, und Schamgefühl stellt sich ein. Am Morgen macht Adam Eva Vorwürfe (9,1067–1098): „Wie soll ich künftig Gottes Antlitz schaun“ (9,1080), hält er ihr vor. Nachdem sie sich Schurze aus Feigenblättern gemacht haben, geraten sie in Streit, weil Adam Eva vorwirft, dass sie am Morgen zuvor nicht auf seine Bedenken gehört und daher ohne seinen Schutz der Schlange begegnete. „Und ihres eiteln Zwistes war kein Ende.“ (9,1189).
Die Kunde davon, dass Satans Verführungskünste erfolgreich waren, erreicht den Himmel. Milton stellt hier die Allmacht Gottes sicher und hält fest:
[…] Gott ließ,
Gerecht und weise stets, es zu, daß Satan
Des Menschen Sinn versuchte, der mit Kraft
Und freiem Willen ja gerüstet war,
Um Feindes oder falschen Freundes List
Klar zu durchschaun und siegreich zu bestehn. (10,6–11)
Christus verhört und verurteilt das PaarGott sendet nun seinen Sohn als Richter zu den Menschen. Damit übernimmt Christus im Vorgriff auf seine Rolle als Weltenrichter am Jüngsten Tag auch hier die richtende Funktion, die durch Milde gekennzeichnet sein soll. Die anschließende Gerichtsszene im Paradies, das Verhör des Paares (10,103–123) und ihre Verurteilung (10,193–208) sind in enger Anlehnung an Gen 3,8–21 gestaltet mit einigen bemerkenswerten Erweiterungen: Adam spricht seine Anschuldigung gegen Eva nur widerwillig aus; er nähme die Schuld auf sich, wenn er nicht wüsste, dass Gott die Wahrheit kennt (10,125–143). Der göttliche Richter wirft Adam vor, dass er Eva vergöttert habe, dass er ihr diente statt Gott (10,145–156)[67]. Der Fluch über die Schlange trägt dem Umstand Rechnung, dass das Tier nur benutzt wurde und Satan der eigentlich Schuldige ist (10,163–181). Die Wirkung des Fluches schildert Milton im folgenden Abschnitt, als Satan auf seinem Fürstenthron in der Hölle seinen Untergebenen triumphierend Bericht erstattet hat (10,460–503): Statt des erwarteten |44|Beifalls hört er nur Zischen[68] und spürt, wie sich sein Körper in einen Schlangenleib verwandelt und auch er nur noch zu zischen vermag[69]. Aus Satan und seinem Gefolge werden Schlangen in einer Vielfalt von Arten (10,504–547). Zugleich wächst in der Hölle ein Hain mit Bäumen, die dem Baum der Erkenntnis gleichen. Als die Schlangen sich gierig auf die Früchte stürzen, sehen sie sich betrogen, weil sich die Früchte in ihren Mäulern als Aschenstaub entpuppen (10,548–584). Dies wird ihnen noch öfter widerfahren, so dass der Eindruck einer Höllenstrafe entsteht.
Sünde und Tod kommen in die WeltNach der Gerichtsszene im Paradies dringen Sünde und Tod dort ein. Der Tod beginnt, Pflanzen und Tiere zu verzehren, während die Sünde den Menschen von innen heraus vergiften und für den Tod vorbereiten will (10,585–613). Gott beobachtet die beiden; die Torheit der Menschen hat ihnen Einlass gewährt, sie werden wüten, bis Christus sie dereinst besiegt (10,616–640). Gott weist einige Engel an, die Schöpfung neu zu ordnen: Jetzt erst kommt es zum Wechsel der Jahreszeiten und zur Aufhebung des Tierfriedens. Das Menschenpaar bedenkt seine veränderte Lage, zunächst klagend, dann akzeptierend und auf das Gebet hoffend. Ein Gebet mit einem Sündenbekenntnis beschließt das 10. Buch.
Blick in die zukünftige HeilsgeschichteGottes Sohn setzt sich vor Gott für die Menschen ein. Gott akzeptiert diese Fürbitte, doch müssen die Menschen den Paradiesgarten verlassen. Der Erzengel Michael soll Adam und Eva aus dem Paradies führen, ihnen als Trost jedoch die Zukunft offenbaren (11,84–125). Michael verkündet dem Menschenpaar, dass der Tod aufgeschoben werde, um ihnen Gelegenheit zu Reue und frommen Taten zu geben. Aus dem Paradies sind sie jedoch verbannt. Michael lässt Adam zum Trost in Traumvisionen die zukünftige Heilsgeschichte schauen (11,423–12,551), bevor er Adam und Eva bei der Hand nimmt und sie aus dem Paradies führt (12,636–640).
Miltons DeutungenMilton klärt in seinem epischen Gedicht manche Frage, die die biblische Darstellung offen ließ. Der Ursprung des Bösen liegt bei einer außerirdischen Macht, Satan, der aus Hochmut, Ehrgeiz und Neid zum Gegenspieler Gottes geworden aus dem |45|Himmel und der Gottesgegenwart verbannt wurde. Gott lässt die Versuchung des Menschen zu, den er mit einem freien Willen ausgestattet hat, so dass der Mensch Entscheidungsfreiheit besitzt. Damit erhält Satans Anschlag auf den Menschen den Anstrich einer Prüfung. Da Gott weiß, wie der Mensch sich entscheiden wird, hat er auch bereits einen Heilsplan entwickelt: Gottes Sohn wird das Böse am Ende besiegen – die alttestamentliche Geschichte ist damit in einen christlichen Horizont gestellt.