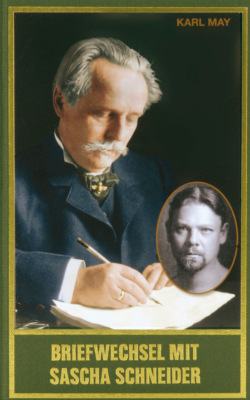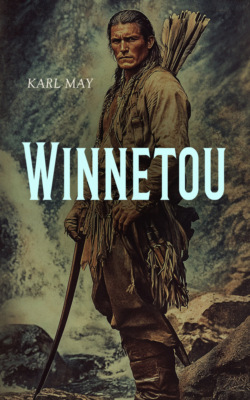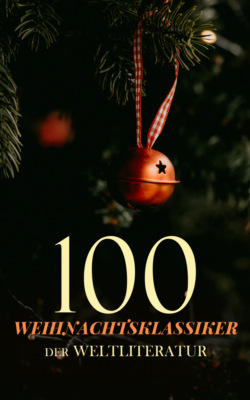Kitabı oku: «Waldröschen IV. Matavese, der Fürst des Felsens. Teil 2», sayfa 19
»Der Sohn des Fliegenden Pferdes hat den Grizzly erlegt; er hat dazu eines einzigen Schusses bedurft, das ist mehr, als wenn er zwanzig feige Söhne der Komantschen getötet hätte, sein Herz ist stark, seine Hand fest und sein Auge sicher, er verdient, aufgenommen zu werden unter die Schar der Krieger. Bärenherz will, daß sein junger Bruder einen Namen erhalte.«
Das war sehr schmeichelhaft für Vater und Sohn, denn beide hatten als die Beteiligten kein Recht, den Antrag zu stellen, den Bärenherz jetzt ausgesprochen hatte. Er erhielt allgemeinen Beifall. Der Besieger des Bären stand noch immer aufrecht am Feuer. Sein Auge glänzte vor Stolz und Freude, und er sagte:
»Bärenherz, mein Bruder, ist berühmt unter den Berühmten; seiner Rede verdanke ich es, daß ich einen Namen haben werde. Wann soll das Fest des Namens gefeiert werden?« – »Sobald die Söhne der Apachen heimgekehrt sind in ihre Wigwams«, antwortete der Alte. – »Darf einer, der keinen Namen hat gegen die Hunde der Komantschen ziehen?« – »Nein.« – »Aber ich will jetzt Bärenherz, meinen Freund, nach Mexiko begleiten; darum soll man mir bereits morgen einen Namen geben.« – »Das ist nicht Sitte; aber die Tatzen des Bären gehören dem Häuptling der Mixtekas, er ist unser Gast und mag entscheiden, wann er einen Namen für dich hat.«
Da sagte Büffelstirn:
»Diesen Namen habe ich bereits. Mein junger Freund hat den Grizzly überwunden, und darum soll er Grizzlytastsa, der Grizzlytöter, heißen. Ich werde ihm morgen diesen Namen geben, und wenn mein Bruder, das Fliegende Pferd, erlaubt, so soll Grizzlytöter mit uns nach Mexiko reiten, um sich die Skalpe der Komantschen zu holen, nachdem er sich die Haut des Bären genommen hat.«
Dieser Vorschlag des berühmten Häuptlings war abermals eine ehrenvolle Auszeichnung für den jungen Apachen und wurde darum sofort angenommen.
Damit war die Beratung beendet, aber noch lange saßen die Männer beisammen, um sich in ihrer ernsten, ruhigen Weise über den beabsichtigten Kriegszug auszusprechen. Einige brachen trotz der Dunkelheit nach der Schlucht auf, um den von Büffelstirn getöteten Stier und den abgezogenen Bären herbeizuschaffen. Es geschah dies durch Schleifen, die man aus freier Hand fertigte und an die man mittels Lassos die Pferde spannte.
Darauf trat die nächtliche Stille ein. Büffelstirn schlief im Zelt Bärenherzens, und das Lager war von Posten bewacht, die sich stündlich abzulösen hatten.
Am anderen Morgen wurde die Feier der Namensgebung vorgenommen, bei der die beiden gebratenen Bärentatzen eine Hauptrolle spielten. Grizzlytöter erhielt die beste Büchse seines Vaters und als Häuptlingssohn das Recht, eine Adlerfeder in seinem Haarschopf zu tragen. Am Nachmittag begannen die Kriegsmalereien. Es waren gegen zweihundert Krieger, die bei Anbruch des Tages abziehen sollten, und sie alle hatten vollauf zu tun, ihre Kleider und Waffen mit den Trophäen früherer Siege zu schmücken.
Als diese Schar am anderen Morgen das Lager verließ, wurde sie von den übrigen eine Strecke lang begleitet, und erst nach der Trennung formierte man den bekannten indianischen Zug, indem ein Reiter dem anderen folgte. Der älteste Krieger erhielt das Kommando über die Schar; Büffelstirn, Bärenherz und Grizzlytöter aber ritten im Galopp davon, um eine halbe Tagereise vor den Ihrigen die Gegend zu erkunden und für die nötige Sicherheit zu sorgen.
Da man die offene Prärie nicht benutzen durfte, so führte der Zug in das Gebirge und über die verschiedenen Stufen desselben empor auf die Hochebene; dies gab einen Aufenthalt, eine Verspätung, die man aber der Vorsicht halber keineswegs umgehen konnte, und erst am fünften Tag nach dem Aufbruch wurde die Wüste Mapimi erreicht, und zwar an einem Punkt, der sich ungefähr zwischen dem Muschelsee und dem westlichen Ende der Wüste befand.
Da es galt, zwischen Chihuahua und den heranziehenden Komantschen Stellung zu nehmen, so drangen die drei Männer nach Süden vor, immer weiter in die Mapimi ein, bis sie plötzlich alle drei zugleich ihre Pferde anhielten, denn gerade im rechten Winkel zu ihrer jetzigen Richtung führten Spuren vorüber.
»Reiter!« sagte Grizzlytöter, indem er vom Pferd stieg. »Mein Bruder mag zählen, wieviel es ihrer waren«, sagte Bärenherz, indem er ruhig im Sattel blieb. Er wollte nur den Scharfsinn des jungen Apachen üben, denn für ihn selbst hätte es nur einer halben Minute bedurft, um die Zahl der vorübergekommenen Pferde zu erkennen.
Grizzlytöter untersuchte die Fährte und sagte dann: »Es waren zehn und ein Pferd.« – »Das ist richtig. Wer hat auf diesen Pferden gesessen?« – »Es waren Bleichgesichter.« – »Woraus sieht das mein Bruder?« – »Sie sind nicht hintereinander geritten. Ihre Spur ist so breit, daß man alle Huftritte zählen kann.« – »Wann kamen sie vorüber?«
Der junge Apache bückte sich abermals nieder und antwortete dann:
»Die Sonne steht jetzt bald über uns; sie sind vorübergekommen, als sie gestern fast am Horizont war.« – »Hatten diese Bleichgesichter Eile oder nicht?« – »Sie hatten sehr große Eile, denn der Sand wurde von den Hufen zurückgeschleudert. Sie sind im Galopp geritten.« – »Mein Bruder hat sehr richtig gesehen, nun aber mag er mir noch sagen, ob es gute Männer waren oder böse!«
Grizzlytöter blickte den Häuptling einigermaßen ratlos an, schüttelte langsam und nachdenklich den Kopf und erwiderte dann:
»Wer soll das aus dieser Fährte erkennen! Kein Mensch!« – »Ich werde meinem Bruder beweisen, daß es zu erkennen ist. Die Mapimi ist hier vier Tagereisen breit. Wer über drei Tagereisen geritten ist, dessen Tier ist sehr ermüdet, und er wird es schonen. Die Eindrücke der Hufe sind nicht leicht, wie beim Galopp, sondern sehr tief; die Sprünge sind nicht weit und langgestreckt, sondern kurz gewesen. Die Tiere waren angegriffen und wurden über die Maßen angestrengt, die Reiter befanden sich also auf der Flucht.«
Grizzlytöter wollte sich verteidigen und sagte:
»Auch wer sich auf der Verfolgung befindet, reitet schnell.« – »Hätten sie einen Feind verfolgt, so wären sie auf dessen Fährte geritten, dies ist nicht der Fall; es gibt keine frühere Fährte, sie sind geflohen, sie befanden sich auf der Flucht und werden verfolgt. Es sind also böse Menschen gewesen.«
Büffelstirn nickte und sagte, scharf nach der Richtung blickend, aus der die Fährte kam:
»Bärenherz hat recht. Die Verfolger können bald eintreffen, und da wir uns nicht sehen lassen dürfen, so mag Grizzlytöter zurückreiten und sagen, daß die Krieger der Apachen uns nicht hierher folgen mögen; sie sollen weiter nach Norden über die Höhen gehen, welche die Mapimi begrenzen, und dort auf mich und Bärenherz warten. Wir werden sehen, was diese Spuren zu bedeuten haben.«
Der junge Apache gehorchte. Er setzte sich auf sein Pferd und ritt im Galopp zurück. Die beiden anderen verfolgten den westlichen Lauf der Spuren und blickten sich dann an. Sie sahen, daß sie ganz denselben Gedanken hatten.
»Die Fährte geht gerade nach West«, sagte Büffelstirn. – »In jenen Paß hinein. Das ist ein gefährlicher Ort.« – »Vielleicht stellen die Verfolgten den Verfolgern eine Falle. Wir wollen nachsehen.« – »Aber wir müssen unsere Spuren verbergen, denn die Verfolger können doch unsere Feinde sein. Mein Bruder mag mir helfen.«
Sie löschten die Tapfen ihrer Pferde und ihre eigenen mit einer Geschicklichkeit aus, die bewunderungswert genannt werden mußte, und als dies auf einer genügend langen Strecke geschehen war, ritten sie einen Bogen und erreichten die Berge, die an der westlichen Grenze der Mapimi liegen, vielleicht eine englische Meile nördlich von der Stelle, an der der Paß durch die Berge führt.
Es gab zwar hier ein außerordentlich schwieriges Terrain, aber dennoch lenkten sie ihre Pferde die schroffen, von Gebüsch besetzten Höhen hinan, wieder in die Tiefe hinab und ließen sie hier, wo sie in Sicherheit waren, stehen. Dann stiegen sie einen Felsenrücken empor und konnten nun von hier aus eine ziemliche Strecke des Passes übersehen. Derselbe bildete gerade unter ihnen das Tal, in dem Verdoja zum letzten Mal gelagert hatte und von dem aus die kleine Seitenschlucht nach Süden lief, in der die Mexikaner zurückgeblieben waren, die Sternau töten oder fangen sollten. Davon aber wußten die beiden Indianer nichts.
Sie hatten sich auf den Boden niedergeduckt und konnten von unten unmöglich gesehen werden, während ihre scharfen, geübten Augen alles erkannten, was unter ihnen lag.
»Uff!« sagte da plötzlich Bärenherz.
Dieses Wort war ein sicherer Beweis, daß er etwas Ungewöhnliches bemerkte. Büffelstirn sah ihn an und folgte dann der Richtung seiner Augen. Da erkannte er einen Mann, der aus dem Seitental empor zur Höhe stieg. Die Entfernung war so groß, daß der Mann einem großen Käfer glich, der sich aufwärts bewegte, dennoch aber wußten die beiden sofort, wie sie ihn zu bezeichnen hatten.
»Ein Mexikaner«, sagte Büffelstirn. – »Ja«, antwortete Bärenherz. »Das Seitental scheint besetzt zu sein.« – »Sie stellen den Verfolgern einen Hinterhalt.«
Die beiden Indianer warteten nun, bis der Mann die gegenüberliegende Höhe erreicht hatte, dort stillstand und nach Osten blickte, und sie folgten mit ihren Augen dann ganz unwillkürlich derselben Richtung. Es vergingen einige Sekunden, ehe sie den dortigen Horizont abgesucht hatten, da aber meinte Büffelstirn:
»Uff, sie kommen!« – »Drei Reiter!« fiel Bärenherz ein.
In der Tat erblickten sie jetzt drei kleine Punkte, die aber so winzig waren, daß sie nur von zwei Paar solcher Augen erkannt werden konnten, wie sie die beiden Indianer besaßen. Der Mexikaner da drüben, jenseits des Passes, hatte sie jedenfalls noch nicht erkannt.
»Sollten es die Verfolger sein?« fragte Bärenherz. – »Nein«, antwortete Büffelstirn. – »Warum nicht?« – »Würden elf Krieger vor dreien fliehen?« – »Warum nicht, wenn diese drei tapfer genug sind! Übrigens können diese drei ja der Vortrab einer größeren Horde sein.« – »Wir müssen es abwarten.«
Sie beobachteten den Mann, der drüben auf dem Berg stand, auch fernerhin mit großer Aufmerksamkeit. Er stieß jetzt einen Ruf aus und stieg so schnell wie möglich von der Höhe herab. Offenbar hatte er die drei Nahenden jetzt auch bemerkt.
»Er benachrichtigt die anderen, die sich versteckt haben«, meinte Bärenherz.
Und so war es wirklich, denn nachdem er in dem Seitental verschwunden war, erschien er eine Minute später mit noch zwei anderen, die aus dem Tal herauskamen und sich mit ihm hinter einen Felsen versteckten, der die ganze Breite des Passes beherrschte.
»Sie werden die Nahenden töten«, sagte Bärenherz. – »Aber weshalb sind es nur drei, da wir doch elf Spuren fanden?« – »Die anderen haben den Ritt fortgesetzt, da die drei Feiglinge genug sind, um drei tapfere Männer aus dem Hinterhalt zu ermorden.« – »Wollen wir die Bedrohten warnen?« – »Wir warnen sie nicht nur, sondern helfen ihnen, wenn sie es wert sind. Es vergehen nach der Zeit der Weißen noch fünf Minuten, ehe sie hier sind, und das gibt uns Zeit, hinter ihre Gegner zu kommen. Vorwärts!«
Bärenherz glitt wieder von der Höhe herab, und Büffelstirn folgte ihm. Sobald sie von unten nicht mehr gesehen werden konnten, rannten sie aus Leibeskräften an der Abdachung des Berges dahin, bis sie ein Gebüsch erreichten, das sich über die Höhe zog und drüben bis auf die Sohle des Passes niederstieg.
Im Schutz dieses Gebüschs gelangten sie hinab, und zwar in genügender Entfernung, um von den drei Mexikanern nicht gesehen zu werden, dann sprangen sie quer über das Tal und befanden sich auf derselben Seite, an der die Männer versteckt lagen. Nun galt es, sich diesen unbemerkt zu nähern. Es gab zum Glück einige Büsche und zerstreute Felsblöcke, die Deckung gewährten, und so brachten es die beiden Häuptlinge fertig, sich vorwärts zu bewegen und hinter einem Stein Posto zu fassen, der kaum fünfzig Schritt von dem Felsenstück entfernt war, hinter dem die drei Mexikaner lagen.
Die Häuptlinge konnten die letzteren genau sehen und zugleich auch die ganze Sohle des Tales überblicken. Sie kauerten hinter dem Stein und hielten ihre Büchsen schußbereit.
Da hörte man Pferdegetrappel, und sogleich erschienen die drei Nahenden am Eingang des Haupttales, befanden sich aber noch außer Schußweite.
Kaum hatten die Indianer einen Blick auf sie geworfen, so konnten sie sich eine Bewegung der lebhaftesten Überraschung nicht erwehren.
»Uff!« flüsterte Bärenherz. »Das ist Itintika, Donnerpfeil, unser Bruder.« – »Und Francesco, der Vaquero!« flüsterte Büffelstirn. »Was tun die hier? Sollte es auf der Hacienda del Erina ein Unglück gegeben haben?« – »Das müssen wir abwarten. Aber wer ist der starke Krieger, den sie bei sich haben? Kennt ihn mein Bruder Büffelstirn?« – »Ja«, entgegnete Büffelstirn. »Es ist der berühmteste Jäger der Savanne, es ist der Fürst des Felsens, vor dem alle Feinde zittern.« – »Ugh!« machte Bärenherz, indem seine dunklen Augen glänzten. »Das ist ein großer Tag, an dem Bärenherz diesen Krieger kennenlernt. Wir werden die drei Mexikaner töten!« – »Erst wollen wir sehen, was sie vorhaben. Nur wenn sie zu den Waffen greifen, schießen wir sie nieder.«
Die Mexikaner lagen hinter dem Stein und flüsterten miteinander. Sie hatten nur Sternau erwartet, und zwar auch nicht jetzt schon, sondern erst am nächsten Tag. Und nun kam er nicht allein, sondern mit zwei anderen. Wer waren sie?
»Sie werden unterwegs zu ihm gestoßen sein«, sagte der eine Mexikaner zu seinen Gefährten. »Was tun wir? Es sind nun drei gegen uns.« – »Pah!« antwortete der zweite. »Fangen können wir ihn nicht; das ist nun wegen seiner Begleiter unmöglich; aber erschießen werden wir ihn.« – »Und die Begleiter? Lassen wir sie laufen?« – »Unsinn! Sie müssen fallen, damit sie nichts erzählen können. Aber wir haben noch Zeit. Sie sind noch nicht im Bereich unserer Büchsen, und wir dürfen keinen von ihnen fehlen. Sie müssen auf unsere ersten Schüsse fallen, sonst kann es uns übel ergehen; wir wissen ja, was für ein Teufel dieser Sternau ist. Übrigens haben wir Zeit zum Zielen, denn wenn sie hier die Spuren unseres Lagers finden, werden sie diese genau untersuchen und also geraume Zeit vor den Mündungen unserer Gewehre verweilen und uns nicht entlaufen. Wir brauchen uns nicht zu überstürzen und können mit Gemächlichkeit zielen.« – »Wenn unsere Kameraden, die Verdoja zurücksenden wollte, bereits erschienen wären, so würden wir alle drei fangen können«, meinte der dritte. – »Wir brauchen sie nicht Wir sind stark genug.« Die Mexikaner ahnten nicht daß wenige Schritte hinter ihnen zwei furchtbare Männer lagen, die jede ihrer Bewegungen beaufsichtigten.
34. Kapitel
Unterdessen war Sternau mit seinen beiden Begleitern vorwärts geritten, aber nicht so scharf wie vorhin, sondern er hatte den Gang seines Pferdes gezügelt und betrachtete nun mit forschenden Blicken den Bau des Tales und die Entfernung der Bergwände voneinander.
»Ein gefährliches Loch!« sagte er. – »Warum?« fragte Donnerpfeil. – »Wenn Verdoja uns hier nicht einen Hinterhalt gelegt hat, so verdient er totgeprügelt zu werden. Wir wollen langsam vordringen und so tun, als ob wir uns gar nicht umblickten. Aber ich werde dabei die Augen offenhalten.«
Sie ritten im Schritt vorwärts, bis sie an die Stelle kamen, an der Verdoja gelagert hatte. Hier blieben sie stehen.
»Hier haben die Schufte ausgeruht«, sagte Francesco.
Sternau warf einen Blick umher und erwiderte hastig:
»Rasch! Steigt von den Pferden, koppelt sie an und tut, als ob wir hier lagern wollten! Schnell, schnell!«
Donnerpfeils Auge suchte in der Richtung, die der Blick Sternaus gehabt hatte, und sofort sprang er vom Pferd.
»Sie haben recht!« sagte er.»Aber lassen wir uns nichts merken. Wir müssen uns eine Verschanzung suchen.« – »Da, rechts an der Wand, der große Felsblock«, entgegnete Sternau, »die Pferde werden sie nicht erschießen. Wir teilen uns und tun, als ob wir Holz zum Lagerfeuer suchen wollen; dann springen wir hinter den Felsen.«
Sie ließen ihre Pferde grasen und lasen dürre Zweige auf.
»Seht«, meinte der erste Mexikaner, »sie bleiben hier. Wir können sie also in aller Gemütlichkeit niederpuffen.« – »Sie suchen Lesholz«, sagte der zweite. »Wir haben unsere Spuren nicht verwischt.« – »Pah, die haben sie ja gar nicht gesehen. Sie sind ja noch nicht in das Seitentälchen gekommen. Es muß einen anderen Grund haben.« – »Schwerlich. Nun stecken wir hier und sie drüben. Wir sind also ebensogut belagert wie sie!«
So war es in der Tat. Sternau hatte nichts weiter gesehen, als am Eingang zu dem Seitental den abgebrochenen Zweig eines Busches. Als der eine Mexikaner, der vorhin von der Höhe Umschau gehalten hatte, emporgeklommen war, hatte er sich an diesem Zweig angehalten und denselben abgebrochen; die Rinde hatte weitergeschlitzt, so war eine helle Stelle entstanden, die einem scharfen, vorsichtigen Auge sofort auffallen mußte. Auch Donnerpfeil hatte sie bemerkt.
Jetzt lagen die drei Bedrohten hinter dem Felsen in vollständiger Sicherheit.
»Was gab es denn?« fragte Francesco.
Er konnte sich den Grund dieses Versteckspielens nicht erklären.
»Siehst du nicht den abgeschlitzten Zweig da drüben am Busch?« fragte Donnerpfeil. – »Ah! Ja.« – »Und darüber die eigentümlichen Einschärfungen in dem Steingeröll?« – »Ja.« – »Nun, es ist vor ganz kurzer Zeit jemand da oben gewesen und hat nach uns ausgeschaut. Als er uns bemerkte, ist er etwas zu hastig in das Tal zurückgekehrt, mehr gerutscht als gelaufen und hat also jene Spur zurückgelassen. Da drüben stehen Leute, die uns auflauern.« – »Donnerwetter!« fluchte Francesco. – »Du brauchst keine Angst zu haben«, lächelte Sternau. »Es sind nur zwei, höchstens drei Männer.« – »Warum so wenige?« fragte Donnerpfeil. – »Glauben Sie«, antwortete Sternau, »daß sich Verdoja mit seiner ganzen Truppe in den Hinterhalt gelegt hat? Nein! Es muß ihm zuerst daran liegen, seine Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Es sind vier, die Eskorte aber beträgt nur elf Mann, und so kann er höchstens drei entbehren. Da er ja nicht gewußt hat, daß ich Hilfe erhalte, und glaubte, daß ich allein kommen werde, so hat er gemeint, ein einziger sei genug, mir eine Kugel zu geben. Der Hinterhalt da drüben liegt natürlich in Schußweite von dem Lagerort. Wir wollen einmal alles genau absuchen. Vielleicht bemerken wir das Versteck.«
Sein scharfes Auge glitt langsam und bedächtig über jeden Busch und Stein, der da drüben Deckung geben konnte.
»Ah, ich hab‘s!« sagte er plötzlich. – »Wo?« fragte Francesco. – »Ich sah ein Knie für einen kurzen Augenblick hinter jenem hohen, viereckigen Felsen erscheinen. Wollen den Leuten einmal eine Kugel geben.« – »Sie wird nicht treffen«, meinte der Vaquero. – »Ich bin vom Gegenteil überzeugt«
Sternau legte sich platt auf den Boden. Es war aus der Ecke des Steins, hinter dem sie steckten, etwas ausgebröckelt und er konnte also durch diese Öffnung zielen, ohne sich selbst eine Blöße zu geben. Dann bat er Donnerpfeil:
»Wenn Sie Ihren Hut auf den Gewehrlauf stecken und ihn so weit emporhalten, daß es gerade so aussieht, als ob jemand über den Stein hinübersehen wolle, so wird sich wohl einer da drüben verleiten lassen, nach dem Hut zu schießen; er wird also einen Teil von sich sehen lassen müssen, und dann ist es um ihn geschehen.« – »Wollen es versuchen«, meinte Donnerpfeil lächelnd, indem er den Hut vom Kopf nahm und auf den Gewehrlauf steckte.
Drüben hatten vorher die beiden Häuptlinge alles genau beobachtet und legten ihre Büchsen bereit, um jeden Augenblick abdrücken zu können.
»Jetzt sind sie in Schußweite«, sagte Bärenherz. »Sie steigen ab. Der Fürst des Felsens blickt sich um, ah, sein Auge blitzt auf; er hat etwas Verdächtiges bemerkt. Was muß es sein?«
Büffelstirn nickte.
»Er ist gewarnt Er weiß, daß ihm der Tod nahe ist. Jetzt gibt er den anderen seine Befehle. Wie ruhig! Ja, er ist ein großer Jäger!« – »Uff« flüsterte Bärenherz. »Sie springen hinter den Stein. Sie sind gerettet, auch ohne uns. Was werden sie beginnen?«
Es verging eine Weile; dann erschien da drüben der Hut, und es sah ganz so aus, als ob ein Kopf vorsichtig herüberblickte.
»Uff!« flüsterte Bärenherz. »Welche Unvorsichtigkeit!« – »Hält mein Bruder den Fürsten des Felsens wirklich für so dumm?« fragte Büffelstirn. »Wir wollen den Spaß abwarten.«
Die drei Mexikaner flüsterten miteinander; dann griff der erste nach seinem Karabiner, lehnte ihn an die Kante des Felsens, bog seinen Kopf ein wenig vor und zielte auf den Hut. Noch aber hatte er nicht losgedrückt, so blitzte es drüben auf, ein Schuß krachte, und der Mexikaner sank mit zerschmettertem Kopf hintenüber.
»Sieht nun mein Bruder, daß es eine List war?« fragte Büffelstirn. – »Der Herr des Felsens ist wahrhaftig ein großer Jäger!« antwortete der Gefragte. – »Er würde die beiden anderen auf alle Fälle töten; aber das dauert zu lange. Wollen wir uns zeigen?« – »Ja«, nickte der Apache.
Die beiden Mexikaner waren um ihren Toten so beschäftigt, daß sie gar kein Auge für das hatten, was hinter ihnen vorging. Die beiden Häuptlinge erhoben sich also und winkten hinüber; dann ließen sie sich wieder nieder.
»Alle Teufel, was ist das!« sagte Donnerpfeil. – »Das ist ja Büffelstirn«, meinte Sternau. »Wer war der Indianer an seiner Seite?« – »Bärenherz, der Apache«, antwortete der Gefragte. – »Der berühmte Bärenherz? Welch ein Zusammentreffen! So haben wir den Feind also zwischen zwei Feuern. Wer konnte ahnen, daß die beiden Häuptlinge in der Nähe sind. Kein Zufall konnte so glücklich sein.« – »Sie werden die Mexikaner erschießen, wir brauchen nur ruhig zuzusehen«, meinte Francesco. – »Daran liegt mir nichts«, entgegnete Sternau. »Besser ist es, wir fangen sie lebendig, damit wir sie ausfragen können. Ich hoffe nicht, daß diese Mexikaner die Sprache der Apachen verstehen. Wenn ich also rufe, werden sie nicht ahnen, wem es gilt und wie es heißt. Und ich glaube auch nicht, daß die beiden Häuptlinge so unbedacht sind, mir mit Worten zu antworten.« – »Das fällt ihnen nicht ein«, sagte Donnerpfeil.
Sternau ließ einige Augenblicke vergehen, dann rief er, aber ohne sich sehen zu lassen, mit seiner weithin schallenden Stimme:
»Tlao nte akajia – wie viele Feinde sind drüben?«
Sofort erhoben sich hinter dem Versteck der Häuptlinge zwei Arme.
»Also nur zwei«, meinte Sternau; »ich hatte recht.«
Und er rief abermals:
»Ni nokhi et tastsa, ni nokhi hotli intahinta – ich will sie nicht tot, sondern ich will sie lebendig haben!« – »Was schreit nur dieser Sternau da drüben?« meinte der eine Mexikaner. »Will er uns verhöhnen, so mag er doch spanisch reden! Wir stecken in einer verfluchten Patsche. Sobald wir ein Glied sehen lassen, werden sie schießen. Es bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als hier steckenzubleiben, bis es Nacht wird oder gar bis die Unsrigen zurückkehren.«
Es sollte aber anders kommen, als er gedacht hatte. Die Häuptlinge hatten nämlich Sternau verstanden. Sie legten ihre Büchsen weg, nahmen die Messer zwischen die Zähne, erhoben sich und schlichen sich leise an die Mexikaner heran. Sternau bemerkte dies und sah, daß er die Aufmerksamkeit der letzteren von den Indianern ablenken müsse; er erhob sich also zu seiner vollen Höhe, legte die Büchse an und zielte.
»Ah, er will schießen!« lachte der eine Mexikaner, indem er vorsichtig hinter dem Felsen hervorlugte. »Ich werde ihm eine Kugel geben.«
Damit langte er nach seinem Gewehr, fühlte aber in demselben Augenblick zwei Hände um seinen Hals, die ihm die Kehle mit solcher Gewalt zudrückten, daß ihm der Atem verging, und seinem Kameraden geschah ebenso.
»Hinüber!« sagte jetzt Sternau, indem er quer über das Tal sprang. Die beiden anderen folgten ihm. Sie brauchten gar nicht zu helfen, denn die Häuptlinge waten bereits beschäftigt, die Besinnungslosen mit ihren Lassos zu binden.
»Büffelstirn, der Häuptling der Mixtekas, rettet mich zum zweiten Mal«, sagte Sternau und streckte dem Genannten dankbar die Hand entgegen.
»Der Fürst des Felsens hat sich selbst verteidigt«, sagte der Häuptling bescheiden. »Hier steht Bärenherz, der Häuptling der Apachen.«
Sternau streckte auch diesem die Hand entgegen.
»Ich begrüße den tapferen Häuptling der Apachen«, sagte er. »Sein Name ist berühmt, aber seine Gestalt sehe ich erst heute.« – »Noch berühmter ist der Fürst des Felsens«, antwortete der Apache. »Er ist ein Freund der roten Männer, und ich werde sein Bruder sein.«
Die beiden großen Jäger und Krieger standen einander gegenüber, Hand in Hand, der eine ein hochgebildeter Meister und der andere ein ungebildeter Indianer, aber vom Standpunkt der Menschlichkeit beide von gleich hohem Wert. Sie dachten in diesem Augenblick wohl nicht, welchem gemeinschaftlichen Geschick auf viele Jahre hinaus sie entgegengingen. Auch die anderen, die sich ja bereits kannten, begrüßten sich; dann setzten sie sich zur Beratung nieder, aber so, daß die zwei Mexikaner von der Unterhaltung nichts hören konnten.
»Was treibt unsere Freunde über die Wüste?« fragte Büffelstirn. – »Ein sehr trauriges Ereignis«, antwortete Sternau. »Die Hacienda del Erina ist überfallen worden.« – »Von wem? Von den Mexikanern?« – »Ja, diese Schufte haben vier Personen gefangengenommen, nämlich Señor Mariano, Señor Helmers, Señorita Emma und Señorita Karja.«
Die Indianer sind gewöhnt, selbst der überraschendsten Nachricht mit stoischem Gleichmut entgegenzutreten, bei Nennung dieser Namen aber fuhren die Häuptlinge alle beide erschrocken empor.
»Karja, meine Schwester?« fragte Büffelstirn. – »Karja, die Blume der Mixtekas?« rief Bärenherz. – »Ja«, antwortete Sternau. – »Wie ist das gekommen? Waren keine Männer da?« fragte die beiden wie aus einem Mund. – »Es waren alle Männer da, aber…« – »Nein, es können keine Männer da gewesen sein, wenn man Gefangene fortzuschleppen vermag«, sagte Bärenherz.
Der Umstand, daß er Sternau gar nicht ausreden ließ, verriet deutlich, wie sehr sein Herz noch heute an Karja hing.
»Ich sage dem Häuptling der Apachen, daß ich selbst gefangen war«, entgegnete Sternau. – »Der Fürst des Felsens war gefangen?« fragte Bärenherz ungläubig. – »Ja.« – »Aber ich sehe ihn doch frei.« – »Weil ich mich befreit habe. Die beiden Häuptlinge mögen hören, was geschehen ist.«
Er erzählte nunmehr in kurzen, gedrängten Worten das Erlebnis der letzten Tage. Als er geendet hatte, reichte ihm der Apache die Hand und bat:
»Der Fürst des Felsens möge mir verzeihen. Im Dunkel der Nacht ist es leicht, den stärksten und tapfersten Helden hinterrücks niederzuschlagen. Jetzt aber wollen wir die Pferde verbergen, denn keiner weiß, wer kommen kann.«
Sternau ging selbst mit, und die Pferde wurden in das Nebental geführt, wo man bei dieser Gelegenheit die drei Pferde der Mexikaner fand, die hinter dem Gebüsch verborgen waren, wo sie ruhig weideten. Die Mexikaner, die wieder zu sich gekommen waren, wurden jetzt herbeigeschafft; Francesco blieb am Eingang des Seitentals als Wache zurück, und die übrigen hörten den Fragen zu, die Sternau an die Gefangenen richtete.
»Ihr gehört zu der Truppe Verdojas?« fragte er.
Keiner antwortete.
»Ich sah euch bei ihm, es hilft euch weder das Schweigen noch eine Leugnung etwas«, sagte er. »Aber ich will euch bemerken, daß ihr euer Schicksal verschlimmert, wenn ihr hartköpfig seid. Weshalb bliebt ihr zurück?« – »Verdoja gebot es uns«, erwiderte der eine barsch. – »Was solltet ihr?« – »Wir sollten Sie fangen oder töten.« – »Das konnte ich mir denken. Aber getrautet ihr drei euch denn wirklich an mich? Ihr habt mich ja kennengelernt. Töten war leicht, aber das Fangen wäre euch schwergeworden.« – »Wir dachten, Sie würden erst morgen hier vorüberkommen, und Verdoja wollte uns ja Hilfe senden.« – »Ah! Es kommen noch Leute?« – »Ja.« – »Wann?« – »Vielleicht bereits morgen am Vormittag.« – »Wie viele?« – »Das wissen wir nicht.« – »Wohin hat Verdoja seine Gefangenen geführt?« – »Auch das wissen wir nicht.« – »Lüge nicht!« – »Glauben Sie, daß Verdoja uns solche Geheimnisse mitteilt?« – »Hm! Aber diejenigen, die morgen nach hier zurückkehren, werden es wissen?« – Jedenfalls.« – »Wo wollten sie mit euch zusammentreffen?« – »Hier im Tal.« – »Wieviel hat Verdoja euch für den Raub versprochen?« – »Dem Mann hundert Pesos.« – »Es ist gut. Man wird über euer Schicksal beraten.«
Diese Beratung fiel für die beiden Gefangenen sehr ungünstig aus. Sternau hätte ihnen gern das Leben geschenkt, aber die beiden Häuptlinge gaben es nicht zu, und Donnerpfeil nebst Francesco schlossen sich ihnen an.
Die Mexikaner wurden tiefer in das Seitental hineingeführt, während Sternau zurückblieb. Als er zwei Schüsse fallen hörte, wußte er, wem sie gegolten hatten. Zu den beiden Toten wurde nun auch der Leichnam des dritten geschleift, und man begrub sie gar nicht, sondern ließ sie den Geiern, die sich bald versammelten, zum Fraß liegen.
Jetzt waren sie zu fünf Mann versammelt und konnten auch von der Veranlassung sprechen, welche die Apachen herbeigeführt hatte. Sternau wußte weiter nichts, als daß ein Leutnant mit einer Schwadron Lanzenreiter, die zu Juarez gehörten, in Monclova hielt, und daß Verdoja sechs Mexikaner bei sich hatte. Selbst wenn diese morgen zurückkehrten, brauchte man sie nicht zu fürchten, und so wurde beschlossen, daß Bärenherz zu seinen Apachen gehen solle, um sie über sein Wegbleiben zu beruhigen und jenseits des Gebirgszuges auf die anderen zu warten. Bärenherz entfernte sich daher zusammen mit Büffelstirn, und beide suchten ihre Pferde auf, worauf sie sich trennten und Büffelstirn zu Sternau zurückkehrte.