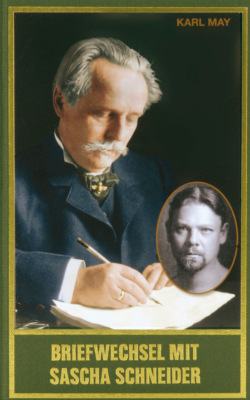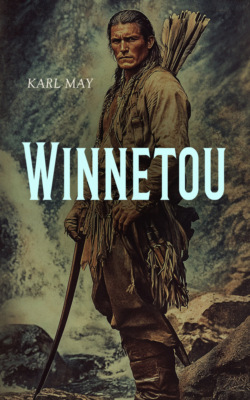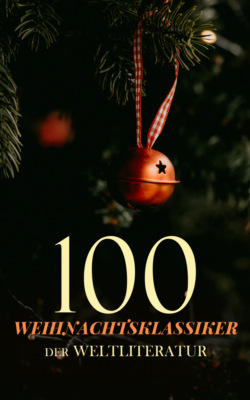Kitabı oku: «Waldröschen IV. Matavese, der Fürst des Felsens. Teil 2», sayfa 20
35. Kapitel
Während des Nachmittags und während der Nacht unterbrach nichts die Einsamkeit des Tales, auch fast der ganze Vormittag verging, aber um die Zeit des Mittags ließ sich Pferdegetrappel vernehmen. Sternau hatte für diesen Fall jedem seinen Posten angewiesen und jedem den Befehl gegeben, zunächst die Pferde zu erschießen. Als sich das Geräusch vernehmen ließ, steckte sich jeder einzelne hinter einen der herumliegenden Felsenblöcke.
Es erschienen sechs Mexikaner an der Stelle, wo nach Westen hin das Tal sich wieder zum Paß verengte. Sie blieben halten, um das Tal zu überblicken. Als sie aber keinen ihrer Gefährten bemerkten, schwenkten sie in das kleine, enge Seitental ein. Kaum waren sie dort angekommen, so fielen vier Schüsse, und darauf aus den Doppelgewehren noch zwei. Alle sechs Pferde bäumten sich empor und stürzten dann zur Erde; sie waren zu gut getroffen, als daß sie sich hätten wieder erheben können. Pferde und Reiter bildeten für einige Zeit einen Wirrwarr, den die vier Schützen augenblicklich benützten, indem sie herbeisprangen, die Mexikaner, noch ehe dieselben sich von den Pferden losmachen konnten, mit dem Kolben zu Boden schlugen und sie mit ihren eigenen Lassos so banden, daß an eine Flucht nicht zu denken war.
Der Anführer dieser Leute war derjenige, der auf der Hacienda del Erina als Lanzenreiter-Offizier erschienen war.
»Jetzt sehen wir uns wieder, mein Bursche, und werden Abrechnung halten«, sagte Sternau zu ihm. »Du sollst nicht so bald wieder Gelegenheit finden, den Offizier zu spielen.«
Der Mann warf einen haßerfüllten Blick auf ihn und antwortete:
»Ich bin ein freier Mexikaner, mit mir hat kein Fremder Abrechnung zu halten.« – »Also ein freier Mexikaner?« lachte Sternau. »Ich habe noch nicht gewußt, daß jemand, der in Fesseln liegt, frei ist. Wohin habt ihr eure Gefangenen gebracht?« – »Das geht niemanden etwas an.« – »Ich wiederhole meine Frage, aber nur dies eine Mal! Wo sind die Gefangenen?« – »Ich sage es nicht!«
Da zog Büffelstirn das Messer, hielt es dem Mexikaner entgegen und sagte:
»Wo ist Karja, meine Schwester?«
Der Gefragte schwieg trotzig; denn er kannte den Sinn der Indianer nicht. Der Häuptling der Mixtekas bemerkt nochmals mit ruhiger Stimme:
»Antworte!« – »Ich sage nichts!« – »So brauchst du nicht zu leben. Nur die Toten schweigen, und wer schweigt, soll tot sein. Aber dein Tod soll nicht schnell sein, sondern du sollst ihn langsam kommen sehen.«
Mit diesen Worten setzte Büffelstirn dem Gefangenen das Messer auf den Unterleib und riß ihm denselben mit einem raschen Schnitt auf, so daß die Eingeweide sofort aus der Wunde hervorquollen. Der Mann stieß einen Schrei des Entsetzens aus, aber trotzdem er sah, daß er nunmehr unvermeidlich dem Tod verfallen sei, rief er:
»Verdammte Rothaut, nun sollst du erst recht nichts erfahren!« Und sich an seine Gefährten wendend, setzte er hinzu: »Tausendmal verflucht sei der von euch, der sagt, wohin wir die Gefangenen geschafft haben!« – »So werden sie alle sterben, gerade wie du!« sagte Büffelstirn kaltblütig.
Dann setzte er das Messer dem zweiten auf den Leib und fragte:
»Wirst du auch schweigen, oder sagst du mir, wo sie sind?«
Der Mann besann sich nur eine Minute lang, er wollte gern sein Leben retten, aber der Fluch des anderen hatte ihn eingeschüchtert. Diese Minute entschied über ihn, sie dauerte dem Mixteka zu lange, er senkte sein Messer in den Leib des Mexikaners, und sofort quollen auch dessen Gedärme durch die fürchterliche Wunde.
»Ihr sollt sterben wie die Hunde«, sagte Büffelstirn. »Ihr sollt eure Kaldaunen sehen und zählen, bis der Brand euch tötet. Sprich, Hund, wo sind die Gefangenen!«
Während die beiden Aufgeschlitzten vor Schmerz und Todesangst ächzten und wimmerten, setzte er bereits dem dritten das Messer auf den Leib.
»Ich will es sagen«, rief dieser eilig. – »Schweig!« brüllte der Anführer. – »Daß ich ein Esel wäre!« antwortete der Mann. »Ich will leben und nicht sterben nur dir zuliebe!« – »So möge dich die Hölle verderben, schuftiger Verräter!«
Der Sprecher, der jetzt sah, daß er sein Leben nutzlos geopfert hatte, schäumte vor Schmerz und Wut. Seine Augen unterliefen mit Blut, und dicker Gischt stand auf seinen bleichen Lippen.
»Rede schnell!« gebot Büffelstirn dem Mexikaner.
Mit dieser Aufforderung drückte er die Klinge seines Messers durch die Kleidung des Gefesselten, so daß die Spitze den bloßen Leib berührte.
»Ich spreche ja schon, tue das Messer fort!« rief der Mann erschrocken. »Die Gefangenen befinden sich in einer alten Opferstätte.« – »Leben sie noch?« – »Ich hoffe es.« – »Wo ist die Opferstätte?« – »Im Staat Chihuahua, in der Nähe der Hacienda Verdoja.« – »Beschreibe sie mir.« – »Das ist eine alte, mexikanische Pyramide, sie liegt im Norden von der Hazienda und ist mit Gebüsch bewachsen.« – »Wo ist der Eingang?« – »Das weiß ich nicht. Es war Nacht, als wir hinkamen. Wir mußten im Freien halten bleiben und durften nicht mit hinein.« – »Keiner von euch?« – »Keiner. Nur Señor Verdoja, Señor Pardero und ein alter Diener gingen in die Pyramide. Erst wurden die Damen und dann die beiden Männer hineingeschafft.« – »Auf welcher Seite befindet sich der Eingang?« – »Ich weiß es nicht.« – »Dummkopf! Auf welcher Seite hieltet ihr, als ihr dort ankamt?« – »Auf der Ostseite.« – »Und auf dieser Seite verschwand Verdoja in der Pyramide?« – »Nein. Er ging nach den Büschen, die an der Ecke der Pyramide stehen, und verschwand dann auf der Südseite.« – »So ist dort der Eingang. Was tatet ihr, als die Gefangenen fort waren?« – »Wir ritten nach der Hacienda Verdoja, erhielten frische Pferde und Proviant, dann brachen wir sofort wieder auf.« – »Nach hier?« – »Ja.« – »Wie lange seid ihr geritten?« – »Von zwei Stunden nach Mitternacht bis jetzt.« – »Wenn wir jetzt aufbrechen, können wir also des Abends bei der Pyramide sein?« – »Ja.« – »Gut. Du wirst uns führen, und zwar so, daß wir von niemand bemerkt werden. Aber beim kleinsten Verdacht, daß du uns betrügen willst, bist du ein Kind des Todes. Hast du dir den Weg gemerkt?« – »Ja, ich kenne ihn genau.« – »Das genügt, und wir brauchen die anderen nicht. Sie haben nach den Gesetzen der Savanne den Tod verdient und sollen ihn haben, aber da sie nicht widersetzlich gewesen sind, so sollen sie ihn leicht und schnell finden.«
Damit zückte Büffelstirn, ehe Sternau es noch verhindern konnte, dreimal das Messer und senkte es bis an das Heft in die Herzen der drei übrigen Mexikaner; sie waren augenblicklich tot. Dann wandte er sich an die zwei, die mit aufgeschlitzten Leibern dalagen, und durchschnitt ihre Banden.
»Ihr sollt hier liegen und sehen, wie die Geier eure Kameraden zerreißen, und dann sollt ihr mit den Vögeln ringen, bis ihr matt werdet und sie euch überwältigen. Wir aber brechen auf, denn es ist keine Zeit zu verlieren.« – »Warum nimmt man nicht die Skalpe der Toten?« fragte Donnerpfeil.
Der Gefragte antwortete in stolzem Ton:
»Der Häuptling der Mixtekas nimmt nur die Skalpe solcher Feinde, mit denen er gekämpft hat, dies hier aber sind Hunde, deren Fell er nicht haben mag, sie sind gestorben wie die Schakale, die man mit dem Stock erschlägt.«
Man nahm nun den sechs Mexikanern alles ab, was sie Brauchbares bei sich trugen, dann wurde aufgebrochen. Der gefangene Führer erhielt das Pferd, das Sternau übrig hatte. Als die fünf Männer davonritten, sahen sie noch, wie die beiden Lebenden sich bemühten, ihre Gedärme in die geöffneten Leiber zurückzustecken, und noch lange verfolgte sie das Geschrei der dem langsamen Tod Geweihten, die an diesem einsamen Ort so unerwartet ihre Bestrafung gefunden hatten. Sie ritten durch den Paß und bogen nach Norden um, wo die Apachen ihrer warteten. Diese hatten Posten vorgeschoben, um leichter gefunden zu werden.
Als Bärenherz hörte, was im Tal geschehen war, gab er zu dem, was Büffelstirn getan hatte, seine Zustimmung. Der Führer wurde gefragt, ob er gehört und gesehen habe, daß Komantschen in der Gegend von Chihuahua befindlich seien. Er verneinte die Frage, und auch von den Regierungstruppen, die in der Hacienda Verdoja lagen, wußte er nichts. Er hatte die Hazienda ja vor dem Morgen verlassen, an dem sie dort angekommen waren.
Es wurde nun beschlossen, insgesamt aufzubrechen. Die Apachen wollten sich der Hazienda bemächtigen und Verdoja mit Pardero gefangennehmen. Beide waren dann ja gezwungen, ihre Gefangenen herauszugeben, und dann sollte Gericht über sie gehalten werden. Einer der Apachen ritt als Bote zurück, um dem Fliegenden Pferd zu melden, wo die nachfolgenden Krieger mit den zuerst aufgebrochenen zusammentreffen sollten.
Nun setzte sich der Zug in Bewegung. Voran ritten die Weißen mit Bärenherz und Grizzlytöter, den wohl bewachten Führer in der Mitte. Dann folgten unter Anführung des ältesten Kriegers die Apachen in ihrer gewohnten Weise, einer immer in den Tapfen des anderen reitend. Sie erreichten die Hochebene von Chihuahua und passierten die Gebiete mehrerer Haziendas, ohne von den Bewohnern derselben gesehen zu werden.
Am Spätnachmittag ritten sie an einem Wald vorüber, der sich so in die Länge dehnte, daß es unmöglich war, ihn zu durchsuchen, was eigentlich durch die Vorsicht geboten worden wäre. Als es dunkel wurde, gelangten sie an die Grenze von Verdojas Besitzung und sahen im Westen die Pyramide aufsteigen, die das Ziel ihrer Wanderung bildete. Sie erhob sich finster, von jeher der Schauplatz von Taten, die das Licht zu scheuen hatten.
36. Kapitel
Im Norden der Mapimi, da, wo von Südwesten aus der Gegend von Cosigniachi her mehrere größere Wässer die Hochebene durchfließen, um sich dann von dem Plateau hinab in den Rio Grande del Norte zu stürzen, entlocken diese Wasser dem sonst unfruchtbaren Boden eine üppige Vegetation. Es gibt fruchtbare Weidestrecken, die von dichten Wäldern umschlossen werden, die sich hinab nach Sonora, der nordwestlichen Provinz von Mexiko erstrecken, wo sie sich dann in die leblosen Ebenen der Apacheria verlieren, denen weiter im Norden durch den Rio Gila einige Fruchtbarkeit abgezwungen wird.
Einer dieser Wälder war derjenige, an dem die Apachen unter Anführung Sternaus, Büffelstirns und Bärenherzens vorüberritten. Sie hatten während des ganzen Rittes keinen einzigen Menschen gesehen und hielten sich für vollständig sicher und unbeobachtet.
Hätte der Wald einen geringeren Umfang gehabt, so wäre er ganz gewiß von ihnen umstellt und durchsucht worden, dies war aber bei seiner ganz bedeutenden Größe vollständig unmöglich, und so begnügte man sich, an ihm vorüberzureiten und nichts als seinen Saum zu durchforschen.
Zu ganz derselben Zeit hätte ein aufmerksamer Beobachter in der Tiefe dieses Waldes ein leises aber ununterbrochen sich fortbewegendes Geräusch vernehmen können. Bald klang es wie das Knicken eines kleinen, dürren Zweiges, bald wie das Zusammenreiben von Blättern, an die jemand stieß. Dieses Geräusch blieb nicht an einer Stelle, sondern es bewegte sich fort, nach dem Rand des Waldes hin. Endlich erklangen sogar einige geflüsterte Worte:
»Hat mein Bruder gelernt, sich unhörbar zu bewegen?«
Darauf hätte man eine ebenso leise geflüsterte Antwort hören können:
»Unter den Bäumen ist es dunkel. Hat mein Bruder etwa die Augen einer Katze, daß er alle Zweige und Blätter erkennen kann?«
Darauf wurde es wieder still, nur ein geheimnisvolles Rauschen ließ sich vernehmen. Dann verstummte auch dieses, und nach kurzer Zeit lispelte es:
»Warum steht mein Bruder? Hat er etwas gehört?« – »Ja, er hörte das ferne Schnauben eines Pferdes.«
Da erklang dasselbe Schnauben abermals, und zwar in größerer Nähe.
»Es kommen Reiter. Hier ist eine große Kiefer; wer oben in den Zweigen sitzt, kann nicht gesehen werden und hat die Prärie vor sich liegen.«
Es waren zwei Indianer, die dieses Gespräch führten. Derjenige von ihnen, der die letzten Worte gesprochen hatte, umfaßte den Stamm und kletterte empor, der andere folgte ihm. Beide kletterten wie Eichkätzchen und zeigten eine solche Gewandtheit, daß nicht das geringste Geräusch zu vernehmen war. Als sie oben zwischen den dicht benadelten Ästen saßen, waren sie von unten unmöglich zu bemerken. Sie hatten ihre Waffen an sich hängen, wurden durch dieselben jedoch nicht im mindesten belästigt. Kaum saßen sie fest, so hörten sie nahende Schritte. Es waren diejenigen der Apachen, die von ihren Pferden gestiegen waren, um den Rand des Gehölzes zu untersuchen. Man konnte sie von oben nicht sehen. Als sie, dem Geräusch nach, vorüber waren, ertönte draußen lautes Pferdegetrappel, und die Truppe ritt vorüber.
»Uff!« flüsterte der eine Indianer. »Apachen.« – »In den Farben des Krieges!« fügte der andere bei. – »Es sind Bleichgesichter bei ihnen?« – »Vier! Uff! Uff!«
Die beiden letzten Worte waren in einem solchen Ton der Überraschung geflüstert daß der andere leise fragte:
»Worüber wundert sich mein Bruder?« – »Kennt mein Bruder das große, starke Bleichgesicht, das an der Spitze reitet?« – »Nein.« – »Es ist der Fürst des Felsens. Ich habe ihn gesehen vor drei Wintern, als ich in der Stadt war, die die Bleichgesichter Santa Fe nennen.« – »Uff! Das ist das tapferste Bleichgesicht, das es gibt! Aber kennt mein Bruder die beiden Häuptlinge, die daneben reiten?« – »Der eine ist Bärenherz, der Apachenhund.« – »Und der andere ist Büffelstirn, der Mixteka. Wir wollen sehen, wie viele reiten.«
Der Sitz der Indianer war so hoch, daß sie über die Wipfel des Waldrandes hinausblicken und den ganzen Zug übersehen konnten. Sie zählten genau, und als die Apachen vorüber waren, sagte der eine:
»Zwanzigmal zehn und noch sechs Apachen und vier Bleichgesichter!« – »Mein Bruder hat richtig gezählt, aber der Fürst des Felsens gilt hundert Apachen. Wohin gehen sie?« – »Diese Richtung geht nach der Hacienda Verdoja. Der Präsident von Mexiko hat die Krieger der Komantschen gerufen, und nun wird der Verräter Juarez die Apachen gerufen haben. Sie gehen nach der Hazienda, wohin auch wir wollen, und werden die Reiter, die sich dort befinden, töten wollen. Morgen kommen viele Krieger der Komantschen, die Apachen sind verloren und werden uns ihre Skalpe geben müssen. Wir müssen unsere Freunde auf der Hazienda warnen, aber wir müssen auch den Hunden der Apachen folgen, um darüber gewiß zu sein, was sie beabsichtigen.« – »So trennen wir uns. Ich folge ihnen, und mein Freund eilt nach der Hazienda.« – »So soll es sein.«
Die Indianer glitten vom Baum herab und drangen bis zum Ende des Waldes vor. Dort überzeugten sie sich zunächst, daß kein Nachzügler zu erwarten war, und dann traten sie auf die offene Prärie hinaus.
Jetzt konnte man beide genau erkennen. Es waren zwei Komantschen im vollen Kriegsschmuck. Sie trugen nicht das Häuptlingsabzeichen, aber sie waren jedenfalls keine gewöhnlichen Krieger, sonst hätte man ihnen nicht die schwierige Aufgabe anvertraut, das Terrain zu sondieren und auf der Hacienda Verdoja die Ankunft der verbündeten Komantschen anzusagen.
Die Sonne war im Untergehen, und in der Ferne verschwand jetzt der lange, schlangengleiche Zug der Apachen.
»Mein Bruder beeile sich, ihnen zu folgen. Er muß sie stets vor Augen haben, denn es wird nun so dunkel, daß man sich nicht auf die Fährte verlassen kann.«
Der andere eilte, ohne eine Antwort zu geben, vorwärts. Ein Kriegskundschafter hat selten ein Pferd bei sich, da ihm dasselbe oft hinderlich sein würde. So war es auch hier, und da der Komantsche als Fußgänger in dem weiten Raum der Prärie nur einen verschwindenden Punkt bildete und jede Art der Deckung benutzen konnte, so war es ihm leicht, selbst jetzt, da es noch hell war, sich den Apachen zu nähern, ohne von ihnen bemerkt zu werden.
Sein Kamerad blickte ihm eine Weile nach und schritt dann in westlicher Richtung davon. Die Apachen machten, um unbemerkt zu bleiben, einen Umweg; der Komantsche konnte sich also direkt nach den Weideplätzen der Hazienda wenden und kam dort eher an als sie, obgleich sie beritten waren.
Er war wohl noch nie in dieser Gegend gewesen, aber sein Instinkt und ein Rundblick über den Horizont ließen ihn erraten, wo die Hazienda liegen werde. Er hatte auch wirklich die genaue Richtung dahin eingeschlagen und eilte nun mit den langen, elastischen Schritten vorwärts, die man bei einem Indianer, wenn er Eile hat, beobachtet. Es wurde bald dunkel, aber er eilte weiter, als ob er jeden Fußbreit dieser Gegend kenne, bis er schließlich verschiedene Herdenfeuer sah, die die Vaqueros angezündet hatten, um sich zu erwärmen und die wilden Tiere abzuhalten. Er hielt sich jedoch von ihnen fern, obgleich er als Freund kam und niemand zu fürchten hatte, schlich sich unbemerkt zwischen den Herden hindurch und erreichte die Hazienda.
Dort weideten die Pferde der Dragoner, an den Vorderbeinen eng gefesselt, und vor der Umzäunung, die jede Hazienda besitzt, lagen die Krieger um mehrere Feuer. Der Komantsche duckte sich zur Erde, schlich nahe an sie heran und stand plötzlich mitten unter ihnen, wie aus der Erde emporgefahren.
Dies tut der Wilde auch dann gern, wenn er zu Freunden kommt, denn wer es versteht, sich unbemerkt anzuschleichen, der wird für einen guten Krieger gehalten. Die Dragoner erschraken beim Anblick der dunklen Gestalt, sprangen empor und griffen zu den Waffen, indem sie ihn sofort umringten.
Bei diesen Zeichen der Feindseligkeit machte der Komantsche eine geringschätzende Handbewegung, blickte sich ruhig im Kreis um und fragte:
»Fürchten sich die Bleichgesichter vor einem einzelnen roten Krieger?«
Einer der Dragoner, der die Abzeichen des Unteroffiziers trug, antwortete:
»Pah, wir fürchten uns vor hundert Roten nicht! Wer bist du?« – »Können die Bleichgesichter die Kriegsfarben der roten Männer nicht unterscheiden?« – »Ihr seid viele hundert Stämme, und der Teufel kann sich da die Malereien alle merken; aber wie mir scheint, bist du ein Komantsche?« – »Ich bin es. Wo ist der Häuptling der Weißen?« – »Du meinst den Rittmeister? Was willst du bei ihm?« – »Ich habe mit ihm zu sprechen.« – »Das läßt sich denken, aber es fragt sich, ob er mit dir zu sprechen hat.« – »Er muß froh sein, wenn der rote Krieger zu ihm kommt«, antwortete der Komantsche stolz. »Ich komme als Abgesandter der verbündeten Komantschen und habe ihm eine wichtige Botschaft mitzuteilen.« – »Das ist etwas anderes. Komm, ich werde dich führen!«
Der Unteroffizier schritt voran, der Indianer folgte ihm. Sie passierten das Palisadentor und begaben sich in das Innere des Gebäudes. Dort mußte der Wilde warten, bis er angemeldet war. Als er eintreten durfte, sah er den Rittmeister mit seinen Offizieren rauchend und spielend am Tisch sitzen. Er blieb ruhig und wortlos an der Tür stehen. Der Rittmeister warf einen verächtlichen Blick auf ihn, spielte seine Partie erst aus, warf dann die Karte von sich und fragte unmutig:
»Was willst du, Rothaut?«
Der Indianer antwortete nicht.
»Was du willst, frage ich!« wiederholte der Rittmeister. – »Mit wem spricht der Offizier?« fragte jetzt der Komantsche. – »Mit dir!« rief der Rittmeister. – »Ich dachte, der weiße Häuptling rede mit einem Fuchs.« – »Mit einem Fuchs? Bist du toll!« – »Der weiße Häuptling sprach mit einer Rothaut, und der Fuchs hat eine rote Haut.« – »Ah«, lachte der Offizier. »Du fühlst dich beleidigt! Nun gut, so werde ich höflicher sein. Was willst du, Komantsche?« – »Ich bringe den Gruß unserer großen Häuptlinge. Der Präsident hat uns gebeten, ihm unsere Hilfe zu leihen, und die Häuptlinge haben beschlossen, es zu tun.« – »Sehr freundlich von euch! Also eure Krieger werden kommen?« – »Ja, sie kommen. Bereits morgen früh wird ein ganzer Stamm sich in dem Wald befinden, der von hier gerade gen Osten liegt.« – »Ah, das geht rasch! Und die anderen?« – »Sie kommen nach, täglich ein berühmter Häuptling mit den Seinen.« – »Ihr scheint lauter berühmte Häuptlinge zu haben; ob sie uns aber großen Nutzen bringen, das wird sich erst zeigen. Sie werden sich zunächst unter meinen Befehl zu begeben haben. Ich werde noch heute abend einen Boten nach Chihuahua senden, um mir Verhaltungsmaßregeln geben zu lassen.«
Der Komantsche lächelte auf eine eigentümliche Weise und antwortete:
»Mein weißer Bruder spricht Worte, die ich nicht begreife.« – »Warum nicht?« – »Er will einen Boten senden, um Befehle zu holen, also kann er kein Häuptling sein, und dennoch verlangt er, daß die berühmten Führer der Komantschen ihm gehorchen sollen. Die Komantschen werden kommen, ihre Häuptlinge werden eine Beratung halten mit den Häuptlingen der Weißen, und dann wird man tun, was beschlossen worden ist. Ein Komantsche stellt sich nicht unter den Befehl eines fremden Kriegers.«
Der Rittmeister sah gar wohl ein, daß er hier nicht starke Saiten aufziehen dürfe, und antwortete daher:
»Wir streiten uns nicht. Wenn deine Häuptlinge kommen, werde ich mit ihnen sprechen. Was mich betrifft, so würde ich allerdings keinen Roten brauchen.«
Das Auge des Indianers glühte auf.
»Wenn du keinen Roten brauchtest, so wärest du morgen eine Leiche, und dein Skalp hinge an dem Gürtel eines Apachen«, antwortete er. – »Alle Wetter! Was sagst du da?« fragte der Rittmeister erschrocken. – »Was du gehört hast!« – »Du sprachst von Apachen?« – »Ja.« – »Sind sie etwa in der Nähe?« – »Ja.« – »Wo?« – »Sie sind von ihren Weideplätzen aufgebrochen, um die Weißen zu töten.« – »Das ist möglich, aber sie haben einen weiten Weg.« – »Sie haben gute Pferde.« – »Eure Komantschen werden eher hier sein als sie.« – »Die Apachen sind eher da als wir.« – »Donnerwetter! Morgen kommt ihr, da müßten sie also heute hier sein.« – »Sie sind hier.« – »Wo?« – »Sie können in diesem Augenblick bereits draußen bei euren Pferden sein.« – »Heilige Madonna, ist das möglich?«
Der Offizier sprang erschrocken auf und die anderen mit ihm. Der Komantsche lächelte über den Eindruck, den seine Worte machten. Ein Indianer wäre ganz kaltblütig sitzen geblieben. Er wußte sehr genau, daß die Wilden ihre Angriffe am liebsten gegen Morgen unternehmen. Wenn er auch die Apachen gesehen hatte, so war er doch überzeugt, daß die Hazienda jetzt noch vor ihnen sicher sei. Darum sagte er in stolzem Ton:
»Die Bleichgesichter fürchten sich!« – »Nein!« rief der Rittmeister. »Aber wir wollen uns nicht unvermutet und wehrlos morden lassen. Hast du die Apachen gesehen?« – »Ja.« – »Wo?« – »Sie ritten am Wald vorüber, in dem morgen die Komantschen ankommen werden.« – »Wann?« – »Vor so viel Zeit, als die Bleichgesichter eine Stunde nennen.« – »Wie viele waren es?« – »Zehnmal zwanzig und sechs.« – »Alle Teufel, zweihundertundsechs! Doppelt so viel, als wir sind.« – »Es waren vier Bleichgesichter bei ihnen.« – »Ah! Jedenfalls Anhänger dieses Juarez! Jetzt ist es sicher, daß sie es auf die Hazienda abgesehen haben. Wir müssen uns in Verteidigungszustand versetzen!« – »Es werden dennoch viele Bleichgesichter fallen.« – »Das befürchte ich nicht. Wir ziehen uns hinter die Umzäunung zurück und sind dann vor ihren Kugeln sicher.« – »Es ist bei ihnen der größte Krieger der Bleichgesichter, er hat ein Gewehr, das viele Feinde tötet, ehe er wieder ladet.« – »Wer wäre das?« – »Der Fürst des Felsens.«
Dieser Name war überall bekannt und berühmt, auch die Offiziere hatten ihn bereits gehört
»Der Fürst des Felsens?« fragte der Rittmeister. »Donnerwetter, das wäre die beste Gelegenheit, diesen famosen Kerl einmal zu sehen. Ist er wirklich dabei?« – »Ja, ich kenne ihn.« – »Aber was haben wir ihm getan, daß er als Feind zu uns kommt?« – »Der Fürst des Felsens ist der Freund der Apachen und Komantschen, er ist der Freund aller roten und weißen Männer«, sagte der Indianer. »Er ist gerecht und gut, er tötet nur den, der ihn beleidigt hat. Wenn er als Feind nach der Hacienda Verdoja kommt, so muß es hier einen Mann geben, der sein Feind ist.« – »Hm, vielleicht Verdoja selbst? Aber der ist nicht mehr da, der hat sich aus dem Staub gemacht, der ist entflohen. Wo stecken die Apachen?« – »Ich weiß es nicht, aber es war einer meiner roten Brüder bei mir, der ist ihnen nachgeschlichen. Er wird kommen und berichten, wo sie zu finden sind.« – »Das genügt. Du bleibst bei uns, bis eure Krieger kommen?« – »Ich bleibe hier während der Nacht, dann aber gehe ich meinen Brüdern entgegen, um sie nach der Hazienda zu führen.«
Somit war dieses Gespräch beendet, und der Rittmeister traf seine Vorbereitungen zum Empfang der Apachen. Die Pferde wurden auf der Weide gelassen, um den Anschein zu bewahren, daß man von der Anwesenheit der Feinde gar nichts wisse, die Dragoner aber löschten ihre Feuer aus und zogen sich hinter die Palisaden und in das Gebäude zurück. Da ein jeder einen Karabiner, einen Degen und auch Pistolen hatte, so war vorauszusehen, daß die Apachen mit fürchterlichen Verlusten zurückgeschlagen werden würden.