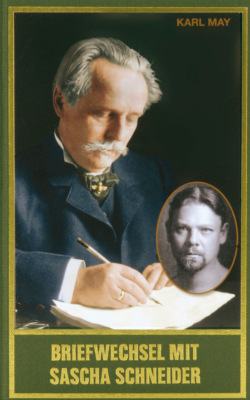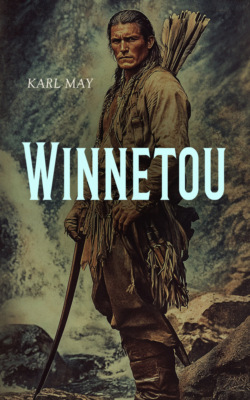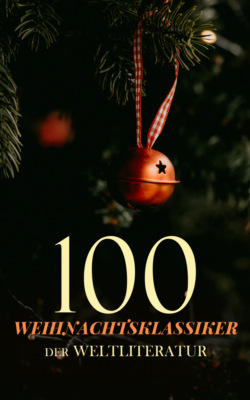Kitabı oku: «Waldröschen IV. Matavese, der Fürst des Felsens. Teil 2», sayfa 21
37. Kapitel
Als der Komantsche die Hazienda erreichte, waren die Apachen auch bei der Pyramide angekommen. Sie hielten in der Nähe des finsteren Bauwerks, und die Anführer betrachteten dasselbe mit nicht sehr angenehmen Gefühlen. Im Inneren dieses massiven Mauerwerks staken ja diejenigen, denen ihre Liebe gehörte.
»Könnte man das Dings da zertrümmern!« knirschte Donnerpfeil. – »Nur Geduld!« antwortete Sternau. »Wir werden die Unsrigen ganz sicher befreien.« – »Davon bin ich überzeugt. Aber was werden sie zu leiden haben, ehe wir sie finden!« – »Vielleicht gelingt es uns, ihre Leiden sehr bald zu beenden.«
Da sagte Büffelstirn:
»Jeder Seufzer, den Karja, die Tochter der Mixtekas ausgestoßen hat, bezahlt ein Feind mit dem Leben! Wo wird der Eingang sein?«
Sternau wandte sich an ihren Führer, den Mexikaner:
»An welcher Stelle habt ihr angehalten?« – »Kommen Sie.«
Der Mexikaner ritt eine Strecke weiter ab und blieb dann halten.
»Hier war es«, sagte er. – »Und wo verschwand Verdoja mit den Gefangenen?« – »Hier ist der Busch, in dessen Nähe er in das Dickicht drang, und dort die Ecke, an der ich das Licht der Laterne aufleuchten sah.«
»Gut. Wenn alles sich wirklich so verhält, soll dir das Leben geschenkt sein.« – »Señor, ich rede die Wahrheit.« – »Das ist gut für dich.«
Sternau rief die beiden Häuptlinge und Donnerpfeil herbei und zeigte ihnen das Terrain.
»So darf jetzt kein Mensch das Gebüsch und den Fuß der Pyramide betreten«, sagte Büffelstirn. »Verdoja ist öfters hin- und hergegangen, es müssen Spuren vorhanden sein trotz der Länge der Zeit, die seitdem vergangen ist, und diese Spuren können wir erst sehen, wenn es Tag geworden ist.« – »Warum warten bis der Tag anbricht?« fragte Bärenherz. – »Jawohl!« stimmte Donnerpfeil bei. »Meine Braut soll keine Minute länger in diesem Kerker schmachten, als es durchaus notwendig ist« – »Sie meinen, daß uns Verdoja selbst den Weg zeigen soll?« fragte Sternau. – »Ja.« – »So überfallen wir die Hazienda?« – »Ja, unbedingt! Und wehe ihm, wenn er uns nicht gehorcht.« – »Gut, so wollen wir zunächst einmal forschen, wie es in der Hazienda aussieht« – »Warum erst forschen«, sagte Donnerpfeil. »Wir reiten hin, fassen den Kerl fest und schleppen ihn her. Weiter ist ja nichts anderes möglich!«
Der gute Anton Helmers, genannt Donnerpfeil, hätte am liebsten gleich den Himmel herabgerissen, um der Geliebten baldige Erlösung zu bringen. Eben wollte Sternau antworten, als ein lauter Ruf erscholl:
»Uff! No-ki peniyil! – Uff, kommt herbei!«
Das waren Worte im Apachendialekt Es war also ein Apache, der gerufen hatte. Die Stimme klang in der Nähe, und zwar von der Richtung her, aus der sie gekommen waren.
»Wer war das?« fragte Sternau. – »Der Grizzlytöter«, antwortete der Apache. – »Ist er fort?« – »Ja, er wollte die Gegend durchsuchen, ob wir sicher sind.« – »So hat er etwas Wichtiges entdeckt. Schnell hin zu ihm!«
Sternau selbst sprang eilig vom Pferd und eilte nach dem Ort hin, wo der Ruf erklungen war. Da fand er den jungen Apachen am Boden kniend, und unter ihm lag ein Mensch, den er fest an der Erde hielt.
»Ein Komantsche!« sagte er.
Im Nu war ein Lasso zur Stelle, und der Komantsche wurde gebunden. Es war der Bote, der sich im Wald von seinem Kameraden getrennt hatte, um den Apachen nachzuschleichen.
»Wie kommt mein Bruder Grizzlytöter zu diesem Hund?« – »Ich ritt am Ende des Zuges und hörte ein Schleichen hinter uns«, erklärte der junge Held. »Es folgte uns ein Mann. Darum stieg ich vom Pferd, als wir hier angekommen waren, und suchte ihn. Ich fand ihn hier, er wollte unsere Rede belauschen. Da warf ich mich auf ihn und hielt ihn fest.«
Da trat Sternau herzu und betrachtete den Gefangenen.
»Ja«, sagte er, »es ist ein Komantsche; er ist uns gefolgt.« – »Tötet den Hund!« sagte einer der Apachen.
Nun wandte sich Sternau zu dem Sprecher und erwiderte in scharfem Ton:
»Seit wann sprechen bei den Apachen die Männer, ehe die Häuptlinge gesprochen haben? Wer seine Rede nicht zügeln kann, ist ein Knabe oder ein Weib.«
Jetzt trat der Mann beschämt zurück. Bärenherz stand auch dabei und fragte den Gefangenen:
»Wo hast du deine Gefährten?«
Der Gefragte antwortete nicht. Da versetzte ihm Grizzlytöter einen Hieb in das Gesicht und sagte:
»Wirst du antworten, wenn dich ein Häuptling der Apachen fragt!«
Aber der Mann schwieg. Und auch, als einige andere versuchten, ihn zum Reden zu bringen, war dies vergeblich, bis Sternau die Sache änderte, indem er fragte:
»Du bist ein Krieger der Komantschen und antwortest nur dem, der dich als tapferen Krieger behandelt. Wirst du fliehen, wenn ich deine Fesseln löse?« – »Ich bleibe«, antwortete der Mann. – »Wirst du mir antworten?« – »Dem Fürsten des Felsens antworte ich; er ist gerecht und gut; er schlägt keinen Gefangenen, der sich nicht wehren kann.«
Das ging auf Grizzlytöter, der sich durch einen Schlag in dem Komantschen einen Todfeind erworben hatte.
»Wie, du kennst mich?« fragte Sternau. – »Ich kenne dich und bin dein Gefangener.« – »Du gehörst dem, der dich besiegt hat. Stehe auf!«
Sternau band den Lasso los, und der Gefangene erhob sich vom Boden und machte auch nicht die geringste Miene zu entfliehen.
»Bist du allein hier?« fragte ihn jetzt Sternau. – »Nein«, lautete die Antwort. – »Sind viele bei dir?« – »Nur einer.« – »So seid ihr als Kundschafter gekommen?« – »Ja.« – »Und es kommen sehr viele Krieger hinter euch?« – »Weiter darf ich nichts sagen.« – »Gut, ich werde dich nicht weiter fragen. Also du wirst nicht entfliehen?« – »Ich werde fliehen.« – »Sprechen die Söhne der Komantschen in zwei Zungen? Du versprachst mir doch, zu bleiben.« – »Wenn ich dein Gefangener sein kann. Der Gefangene eines Knaben, der mich schlägt, mag ich nicht bleiben.« – »So müssen wir dich wieder binden.« – »Versucht es!«
Der Komantsche holte aus und hätte Grizzlytöter mit einem Schlag seiner Faust niedergeworfen, wenn Sternau nicht schneller gewesen wäre. Er faßte den erhobenen Arm des Komantschen mit der Linken und versetzte ihm mit der Rechten einen Hieb an die Schläfe, daß er zusammenbrach; in demselben Augenblick aber erhob auch Grizzlytöter sein Messer und stieß es dem Niederstürzenden in das Herz.
»Sein Skalp ist mein!« rief er. – »Ein schlechter Skalp!« sagte Sternau, indem er sich unwillig abwandte.
Grizzlytöter sah ihn betroffen an und fragte:
»Warum soll der Apache nicht den Komantschen töten?« – »Weil er ihn nicht in einem ehrlichen Kampf erlegt hat, soll er den Skalp nicht tragen«, entgegnete statt Sternau Bärenherz. »Der Komantsche war bereits betäubt Warum hast du ihn geschlagen? Ein tapferer Krieger trägt nicht den Skalp dessen, den er entehrt hat.«
Das war eine harte, aber wohlverdiente Zurechtweisung. Der junge Apache wandte sich ab, warf keinen Blick mehr auf die Leiche und getraute sich nicht wieder in die Nähe der Häuptlinge zu treten, die sich jetzt mit halblauter Stimme berieten.
»Wenn heute zwei Kundschafter hier sind, so steht es fest, daß die Komantschen bald nachkommen«, sagte Sternau. »Wir müssen vorsichtig sein. Die zwei haben uns gesehen und sich dann jedenfalls geteilt. Der eine ist uns nachgefolgt und der andere ist nach der Hazienda geeilt, um deren Bewohner zu warnen. Wollen wir sie überfallen, so ist es nötig, vorher zu rekognoszieren. Und das werde ich selbst tun. Die Zurückbleibenden mögen absitzen, um ihre Pferde weiden zu lassen. Sie mögen ein Lager ohne Feuer bilden und Wachen aufstellen. Sie mögen ferner dafür sorgen, daß die Spuren Verdojas nicht zerstört werden.«
Nach dieser Anordnung und nachdem er sich bei dem mexikanischen Führer nach der Lage der Hazienda erkundigt hatte, schritt Sternau davon. Die schwere, ihn hindernde Büchse ließ er beim Pferd zurück, aber den Henrystutzen warf er über die Schulter.
Es war ganz dunkel geworden, aber als er ungefähr fünf Minuten gegangen war, sah er die Herdenfeuer leuchten. Sie dienten ihm als untrügliche Wegweiser.
Eines dieser Feuer brannte an der Seite eines großen Felsblocks, der mitten in der Ebene lag. Die Flamme war hier gegen den Luftzug geschützt, und fünf bärtige Vaqueros bildeten einen Halbkreis um dieselbe.
Sternaus scharfes Auge erkannte die günstige Gelegenheit, etwas zu erlauschen, sofort. Rasch schlich er sich herbei, und dies wurde ihm nicht schwer, denn der nur von der einen Seite erleuchtete Felsen warf nach der entgegengesetzten Richtung einen riefen Schlagschatten, in dessen Dunkel Sternau vollständig sicher herbeischleichen konnte. Er faßte an dieser Seite des Felsens Posto und konnte nun jedes Wort des Gesprächs belauschen.
»Verdammt gefährlich ist‘s für uns«, sagte jetzt einer der Vaqueros. – »Nicht im mindesten«, antwortete ein anderer. – »So? Wenn die Apachen kommen, über wen fallen sie zuerst her? Über uns.« – »Ich wette mein Leben, daß sie erst gegen Morgen kommen, und dann sind wir nicht mehr da. Wir sollen uns ja bereits um Mitternacht in die Hazienda zurückziehen.« – »Wo mögen sie stecken?« – »Das werden wir erfahren, sobald der andere Komantsche kommt; er ist ihnen nachgegangen. Dieser Rittmeister der Dragoner scheint in tüchtiger Kerl zu sein. Er hat die Hazienda verbarrikadiert, daß sicherlich kein Apache über die Palisaden kommt. Und wenn über hundert Dragonergewehre krachen, dann werden nicht viele Rothäute übrigbleiben.«
Ah, war das so! Sternau hörte, daß ein Rittmeister mit einer Schwadron Dragoner hier lag. Das gab der Sache eine ganz andere Wendung. Er trat schnell entschlossen hinter dem Felsen hervor und grüßte. Die Vaqueros sprangen entsetzt auf und griffen nach ihren Gewehren, als sie aber sahen, daß sie einen Weißen vor sich hatten, beruhigten sie sich.
»Es liegen Dragoner in der Hazienda?« fragte er. – »Ja«, antwortete einer. – »Wie viele?« – »Über hundert.« – »Regierungstruppen?« – »Ja.« – »Wird man den Rittmeister sprechen können?« – »Sicher.« – »Gute Nacht.«
Sternau wandte sich ab und schritt der Hazienda zu.
»Santa Madonna«, sagte der Vaquero, »ich dachte zunächst, es sei der Teufel!« – »Ja«, meinte ein zweiter, »ich dachte, es sei der Geist des Riesen Goliath. So einen Kerl habe ich noch gar nicht gesehen!« – »Wie er einen anguckte! Man war ganz verblüfft. Man hätte ihn doch eigentlich examinieren sollen! Wer mag er sein?« – »Er war keine Rothaut, und das ist genug. Er sah aus wie ein Jäger aus dem Norden; wir werden ihn noch kennenlernen, denn jedenfalls sucht er sich ein Nachtlager in der Hazienda.«
Während hier am Feuer diese Vermutungen ausgesprochen wurden, schritt Sternau dem Haus entgegen. Als er die vor demselben weidenden Pferde sah, lächelte er.
Er schritt an den Palisaden entlang und hörte dahinter flüstern. Diese Dragoner waren nicht die Leute, einen Savannenmann zu täuschen. Am Tor klopfte er an.
»Wer ist draußen?« fragte eine Stimme. – »Ein Fremder«, antwortete er. – »Was will er?« – »Mit dem Rittmeister sprechen.« – »Ah, ist‘s ein Roter oder ein Weißer?« – »Ein Weißer.« – »Allein?« – »Ganz allein!« – »Hm, wer darf trauen! Das Tor öffne ich nicht, Könnt Ihr klettern?« – »Ja.« – »So steigt über die Palisaden; wir wollen‘s erlauben, wenn es nur einer ist; sind es aber mehrere, so schießen wir sie über den Haufen!« – »So tretet hinten weg!«
Sternau schritt eine kurze Strecke zurück und nahm einen Anlauf; im nächsten Augenblick flog er über die Planken hinüber und mitten unter die Dragoner hinein, die nicht geahnt hatten, daß sie es mit einem solchen Voltigeur zu tun hatten. Er riß einige davon zu Boden, während die anderen zusammenprallten, daß die Köpfe krachten.
»Donnerwetter!« rief die Stimme, die bereits vorhin gesprochen hatte. »Was ist denn das? Ihr fliegt ja aus den Wolken herab! Ich denke, Ihr wolltet über die Palisaden steigen?« – »Das tat ich auch, aber nur in meiner Weise«, lachte Sternau. – »Nun, das ist eine ganz verdammte Art und Weise! Ihr könnt dabei Hals und Beine brechen und anderen ehrbaren Leuten die Knochen zerschlagen. Wer seid Ihr denn?«
Es war ein Unteroffizier, der das sagte. Er rieb sich den Rücken, denn er gehörte auch zu denen, welche niedergerissen worden waren.
»Ein Jäger bin ich.« – »Ein Jäger? Hm, ich denke, Ihr hättet es auch zum Seiltänzer bringen können! Und mit dem Rittmeister wollt Ihr reden?« – »Ja.« – »Was denn?« – »Was Euch nichts angeht! Wenn ich es Euch sagen wollte, brauchte ich es nicht dem Rittmeister zu erzählen. Verstanden?« – »Heilige Madonna, seid Ihr ein Grobian! Woher wißt Ihr denn, daß ein Rittmeister hier ist?« – »Es hat mir geträumt. Vorwärts, ich habe nicht viel Zeit.« – »Hopp, hopp! Wenn ein mexikanischer Unteroffizier der Dragoner Auskunft verlangt, so hat man ihm zu antworten!« – »Das tue ich ja auch. Oder bin ich Euch vielleicht zu einsilbig?« – »Beileibe nicht! Ihr redet eher zu viel. Seid Ihr bewaffnet?« – »Ja.« – »So gebt die Waffen ab!« – »Weshalb?« – »Es sind Kriegszeiten, und da muß man vorsichtig sein. Wie nun, wenn Ihr nur kämt, um den Rittmeister zu ermorden!« – »Glaubt Ihr, daß es so einen Wahnsinnigen geben kann? Ich wäre ja sofort des Todes. Oder sind die mexikanischen Dragoner Memmen, die man nicht zu fürchten braucht, weil sie selbst sich fürchten vor einem einzelnen Mann, der eine Flinte hat?« – »Hört, Mann, zu reden versteht Ihr wie sonst einer! Nun, ich will einmal von der Regel absehen und Euch auch bewaffnet zum Rittmeister lassen. Kommt!«
Der Unteroffizier führte Sternau nun in ganz dasselbe Zimmer, in dem nicht lange Zeit vorher der Komantsche gewesen war. Die Offiziere saßen noch immer beim Spiel. Als sie Sternau erblickten, erhoben sie sich unwillkürlich. Der Eindruck seines Äußeren gab sich sofort zu erkennen.
38. Kapitel
»Wer sind Sie, Señor?« fragte der Rittmeister, als er den höflichen Gruß des Eintretenden erwidert hatte.
Sternau warf einen Blick im Zimmer umher und dann auf die Offiziere. Sie trugen ihre Degen, waren aber sonst unbewaffnet.
Er antwortete: »Mein Name ist Sternau, Señor; ich bin Arzt und reise teils in Familienangelegenheiten und teils, um meine Erfahrungen zu erweitern. Ich komme nach dieser Hazienda, um mit Señor Verdoja in Ihrer Gegenwart ein Wort zu sprechen.« – »Das ist unmöglich, denn Verdoja ist nicht hier.« – »Ah! Wo befindet er sich?« – »Ich weiß es nicht; ich vermute, daß er sich vor uns aus dem Staub gemacht hat.« – »Das ist mir höchst unangenehm. Seit wann befinden Sie sich hier?« – »Seit heute vormittag.« – »War da Verdoja bereits fort?« – »Nein. Ich sprach mit ihm. Er sagte, daß er seine Vaqueros zu inspizieren hätte, und ritt davon. Er kam nicht zurück, und ich habe erfahren, daß er bei keinem einzigen Vaquero gesehen wurde. Er war ein Anhänger von Juarez und floh deshalb. Sein Lieblingsdiener ist mit ihm verschwunden.« – »So befindet sich wenigstens Señor Pardero hier?« – »Pardero? Ah, der Leutnant Verdojas? Nein, er ist nicht hier.«
Das gab Sternau zu denken. Waren diese beiden Männer mit ihren Gefangenen entflohen? Möglich war es schon. Oder hatten sie sich vor den Regierungstruppen in die Pyramide geflüchtet? Welch ein Los erwartete da die beiden Mädchen! Es lag auf der Hand, daß keiner der Offiziere von dem verbrecherischen Tun Verdojas etwas ahnte. Sollte Sternau es ihnen erzählen? Vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht.
»Sie sind mit Verdoja und Pardero Freund?« fragte der Rittmeister. – »Nein«, antwortete Sternau. »Diese beiden Männer sind die größten Schurken, die ich jemals kennenlernte. Ich kam, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.« – »Ach, ich teile Ihre Meinung vollständig; um so mehr tut es mir leid, daß Sie diese Leute nicht finden.« – »Sie haben wirklich keine Ahnung, wo sie zu suchen sind?« – »Nicht die geringste.« – »So habe ich Sie umsonst inkommodiert und bitte, mich zu entschuldigen.«
Man hatte während der kurzen Unterhaltung noch nicht daran gedacht, Sternau einen Sessel anzubieten; jetzt, als er sich mit einer Verbeugung verabschieden wollte, sagte der Rittmeister:
»Nehmen Sie doch Platz, Señor! Sie bleiben diese Nacht doch hier?« – »Nein.« – »Ah, nicht? Sie wollen weiter? Die beiden Männer suchen?« – »Ja, allerdings.« – »Hören Sie, das ist gefährlich! Sie sind fremd, und es ist gewissermaßen Revolution im Land. Es streifen wilde Indianer gerade in dieser Gegend herum, und ich will Ihnen aufrichtig sagen, daß wir sogar diese Nacht einen Überfall der Apachen hier erwarten. Wenn Sie diesen Schuften in die Hände fallen, so sind Sie verloren!« – »Oh, ich fürchte sie nicht, Señor!« – »Nicht? Hm, Sie sind ein Neuling im Land!« – »Nicht so ganz! Übrigens weiß ich, daß die Indianer im Grunde genommen bessere Menschen sind, als man zu meinen gewohnt ist.« – »Sie irren, Sie irren sehr. Da liegt neben der hiesigen Besitzung eine weite Länderei, die dem Grafen Rodriganda gehört Er hat eine Anzahl Pueblo-Indianer angestellt, und vorige Woche haben sie den Majordomo mit fast sämtlichen Weißen abgeschlachtet.« – »Das tut mir leid, hat seinen Grund aber jedenfalls in der nicht menschenfreundlichen Administration des Señor Cortejo.« – »Ah, Sie kennen diesen Cortejo, der die Güter des Grafen verwaltet?« – »Ja, er wohnt in Mexiko.« – »Das ist richtig. Dieser Graf Rodriganda ist einer der reichsten Grundbesitzer des Landes. Ich möchte wünschen, sein Sohn oder Erbe zu sein.«
Sternau lächelte und verbeugte sich verbindlich.
»Dann wären wir Verwandte«, sagte er. – »Verwandte?« fragte der Offizier. – »Ja. Meine Frau ist eine Condesa de Rodriganda y Sevilla, die einstige Erbin der Güter, von denen Sie sprachen.«
Der Rittmeister fuhr empor.
»Nicht möglich!« rief er. »Eine Gräfin de Rodriganda die Frau eines Arztes?« – »Es ist dennoch so!« – »Dann sind Sie von Adel?« – »Nein.« – »Aber ich bitte Sie! Das wäre ja kaum zu verstehen!«
Sternau griff in die Tasche und zog den letzten Brief hervor, den er von Rosa erhalten hatte. Er zeigte dem Rittmeister die Über- und die Unterschrift, den Stempel des Bogens und das Siegel des Kuverts.
»Bitte, überzeugen Sie sich«, sagte er. – »Wahrhaftig, das ist das Siegel der Rodriganda; ich kenne es sehr genau. Sie müssen nämlich wissen, daß ich mit Alfonzo de Rodriganda, der sich jetzt in Spanien befindet, sehr befreundet war. Ich habe von ihm erfahren, daß er eine Schwester besitzt, die Rosa heißt, und sehe also, daß Sie die volle Wahrheit sagen. Nun müssen Sie bei uns Platz nehmen, denn es versteht sich ganz von selbst, daß ich Sie nicht fort lasse!«
Sternau lächelte abermals und erwiderte:
»Ihre Freundlichkeit verpflichtet mich zum größten Dank, aber ich darf nicht bleiben.« – »Warum?« – »Ich werde erwartet.« – »Wo? Außerhalb der Hacienda Verdoja?« – »Ja.« – »Teufel, wo könnte das sein? Bis zur nächsten Besitzung hat man fast einen Tag zu reiten. Und daß Ihre Gesellschaft im Freien kampiert, nehme ich doch nicht an.« – »Und doch ist es so. Ich werde von den Apachen erwartet.«
Sternau sprach diese Worte mit einem unendlichen Gleichmut aus, und doch war die Wirkung ganz dieselbe, als ob eine Bombe geplatzt wäre. Die Herren Offiziere fuhren von ihren Sitzen auf und dann weit auseinander.
»Von den Apachen?« fragte der Rittmeister mit offenem Mund. – »Ja.« – »Alle Wetter, das ist ein Spaß! Erklären Sie mir das!« – »Die Erklärung ist einfach, ich bin der Anführer der Apachen.«
Die Bestürzung der Herren verdoppelte sich; sie waren das, was man perplex nennt.
»Ihr Anführer? Aber das ist ja unmöglich!« – »Es ist im Gegenteil nicht nur möglich, sondern wirklich. Soll ich es Ihnen beweisen?« – »Ja, ich bitte Sie darum, ich bitte Sie recht sehr darum.« – »Nun, Sie haben einen Komantschen hier?« – »Das stimmt. Aber was hat das mit Ihrem Beweis zu tun?« – »Und den anderen Komantschen haben wir«, fuhr Sternau unbeirrt fort. – »Sie haben ihn?« fuhr der Offizier auf. – »Ja. Diese beiden Komantschen beobachteten uns, und dann trennten sie sich. Der eine ging nach dieser Hazienda, und der andere folgte unserer Fährte. Er war dabei sehr unvorsichtig, wurde ertappt und von einem der Apachen erstochen.«
Da griff der Rittmeister an seinen Degen und donnerte: »Señor, ist das wahr?« – »Ja.« – »Und das sagen Sie uns, die wir mit den Komantschen verbündet sind? Sie wagen es, in dieses Haus zu kommen?« – »Ah, pah, ich wage nichts! Ich kam in dieses Haus, um mit Verdoja eine Abrechnung zu halten, und nun ich ihn nicht finde, halte ich es für meine Pflicht, Ihren Leuten zu sagen, daß sie schlafen gehen können. Die Apachen werden keinen Angriff auf die Hazienda unternehmen.« – »Aber, zum Teufel, träume ich denn?« fragte der Offizier, indem er sich an den Kopf griff. – »Nein, Sie wachen. Mein Erscheinen hier mag Ihnen ein wenig ungewöhnlich vorkommen, ist aber sehr leicht zu erklären. Die Apachen kommen nicht, um mit den Weißen Krieg zu führen, sie beabsichtigen weiter nichts, als sich von den Komantschen einige Skalpe zu holen; sie sind meine Freunde, aber darum bin ich noch nicht Ihr Feind, Señor. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß die Apachen weder Ihnen noch der Hazienda einen Schaden zufügen werden, und daher erwarte ich, daß auch Sie meine Freunde nicht belästigen.« – »Den Teufel können Sie erwarten!« rief der Rittmeister. »Die Apachen sind Feinde unserer Verbündeten, also auch die unsrigen, ich werde sie niedersäbeln, wo ich sie finde!« – »Ich habe keine Veranlassung, Sie zu bekehren; aber betrachten Sie mich wenigstens als einen Abgesandten, der Sie um einen dreitägigen Waffenstillstand bitten will!« – »Fällt mir nicht ein! Die Rothäute mögen heute nacht kommen und sich blutige Köpfe holen. Und kommen sie nicht, so werde ich sie morgen aufsuchen; darauf können Sie sich verlassen!« – »Dies ist Ihr Ernst?« – »Mein vollständiger!« – »Dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Gute Nacht!«
Da trat ihm der Rittmeister in den Weg und fragte:
»Halt, wohin?« – »Fort, zu meinen Apachen«, antwortete Sternau gleichmütig. – »Sie? Fort? Daß ich ein Narr wäre! Sie bleiben da, Sie sind mein Gefangener!« – »Sie scherzen«, lachte Sternau. – »Donnerwetter, in solchen Sachen scherzt man nicht! Es ist mein vollständiger Ernst!« – »Sie erklären einen Abgesandten, einen Parlamentär, für gefangen?« – »Von den Roten erkenne ich keinen Parlamentär an. Übrigens sind Sie ganz ohne meine Erlaubnis gekommen, ich habe keinerlei Verpflichtung gegen Sie. Sie sind gekommen, um sich unsere Vorbereitungsmaßregeln anzusehen, ich erkläre Sie für einen Spion!« – »Halt, Señor! Der Gemahl einer Rodriganda ein Spion?« – »Pah, ich glaube jetzt nicht mehr an das, was ich vorhin für wahr hielt!« – »Tun Sie, was Ihnen beliebt! Ich aber bemerke Ihnen, daß ein Spion sich wohl nicht in der Weise in die Hazienda wagen würde, wie ich es getan habe.« – »Nun gut, Spion oder nicht! Sie sind in der Hazienda, Sie haben unsere Vorbereitungen gesehen, und Sie dürfen also nicht fort!« – »Wer will mich halten?« – »Ich, Señor!« entgegnete der Rittmeister drohend. – »Pah, Sie und alle Ihre Dragoner können mich nicht halten. Ich werde gehen, wie mir es beliebt, gerade so, wie ich gekommen bin, als es mir beliebte.«
Da zog der Offizier den Degen.
»Sie bleiben!« gebot er. »Sie riskieren sonst Ihr Leben!« – »Haben Sie keine Sorge um mich!« lächelte Sternau. »In solcher Gesellschaft riskiert der Fürst des Felsens ganz und gar nichts.«
Da erbleichte der Rittmeister und mit ihm die anderen Offiziere, trat zurück und sagte:
»Der Fürst des Felsens? Dios, ja, er soll dabeigewesen sein!« – »Allerdings war er bei den Apachen. Ich selbst bin es. Und nun versuchen Sie einmal, mich zu halten!«
Der Rittmeister war doch mutig genug, ihm wieder nahe zu treten. Er gebot:
»Und wenn Sie es zehnmal sind, Sie bleiben mein Gefangener. Legen Sie die Waffen ab!« – »Das dürfte mir wohl schwerlich einfallen! Übrigens haben Sie nur Ihre Degen, Señores, ich dürfte nur den Revolver ziehen, so wären Sie verloren; aber ich tue es anders. Ich habe gesagt, daß ich Ihr Feind nicht bin, und bitte nochmals, mich zu entlassen.« – »Sie bleiben!« gebot der Rittmeister. – »Nun denn, Sie wollen es nicht anders!«
Damit erhob Sternau blitzschnell die Faust, und in derselben Sekunde krachte der Rittmeister besinnungslos zu Boden. Ehe die beiden Leutnants nur einen Gedanken haben konnten, stand er auch schon vor ihnen – zwei Faustschläge, und auch sie lagen an der Erde, er hatte sich die Bahn frei gemacht und ging.
Als er in den Hof kam, empfing ihn derselbe Unteroffizier.
»Fertig?« fragte dieser. – »Ja. Laßt mich hinaus!« – »Durch die Tür?« – »Versteht sich, denn nun werdet Ihr ja glauben, daß ich allein bin!« – »Na, so kommt!«
Der Unteroffizier trat an das Tor, um es zu öffnen. In diesem Augenblick kam eine dunkle Gestalt herangeschlichen, es war der Komantsche, der einen Rundgang gemacht hatte. Die hohe Gestalt Sternaus fiel ihm auf; er trat heran, warf einen forschen Blick auf ihn und rief:
»Der Fürst des Felsens!« – »Der Fürst des Felsens!« erscholl es von Mund zu Mund. – »Haltet ihn fest!« schrie der Komantsche abermals und faßte zugleich nach Sternau. – »Sei nicht dumm, Komantsche!« gebot da Sternau. »Wie kannst du den Fürsten des Felsens halten! Ich weiß, du willst meinen Tod nicht, ich den deinen auch nicht. Pack dich!«
Damit ergriff er den Roten und gab ihm einen Stoß, daß er weit fortflog. Da aber wurde ein Fenster aufgerissen, und man sah den von der Lampe beschienenen Kopf des Rittmeisters erscheinen.
»Ist er noch da?« rief er in den Hof hinaus. »Nehmt ihn gefangen!« – »Hier ist er! Haltet ihn, haltet ihn fest!« rief es aus mehr als einem Dutzend Kehlen.
Doppelt so viele Hände streckten sich nach Sternau aus. Dieser aber riß den Stutzen von der Schulter und schlug ein gewaltiges Rad mit demselben. Der zwölffache Hieb, den er so austeilte, schaffte ihm freie Bahn, dann nahm er einen Anlauf und flog ebenso schnell über die Palisaden hinaus, wie er über dieselben hereingekommen war.
Jetzt griff alles zu den Gewehren, man kletterte an den Planken empor und schoß nach ihm. Doch Sternau hatte dies vorausgesehen und war im eiligsten Lauf um die nächste Ecke gebogen; daher flogen die Kugeln in eine vollständig falsche Richtung.
»Zu den Vaqueros, zu den Vaqueros!« rief der Rittmeister. »Sie mögen ihn fangen!«
Das Tor wurde geöffnet, und mehrere der flinksten Dragoner rannten zu den Herdfeuern, um die Vaqueros zu unterrichten; da aber bog Sternau wieder um die Ecke herum und schlich sich zu den Pferden. Vier von ihnen weideten auf einem separaten Platz, das waren die Offizierspferde, die besten von allen. Er sprang hinzu, löste die Fessel des einen, schwang sich auf und galoppierte davon, ehe noch einer der Vaqueros erfuhr, um was es sich handle.
Die Herren Dragoner hatten heute abend den Fürsten des Felsens kennengelernt.