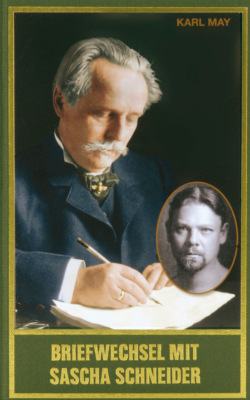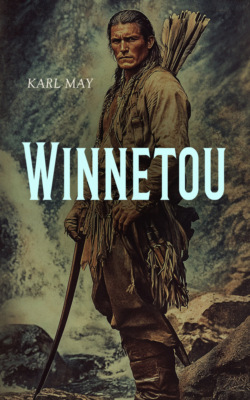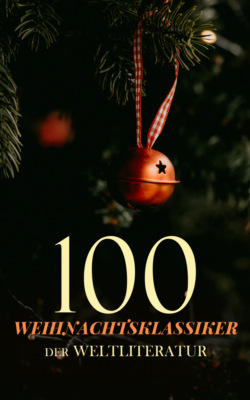Kitabı oku: «Waldröschen VII. Die Abenteuer des schwarzen Gerard 2», sayfa 5
Die alte Marie schwieg; sie hätte gern gesprochen, ja, laut geschrien und gejubelt, aber sie brachte dies nicht fertig. Sie saß sprachlos da und weinte leise vor sich hin. Was sie gehört hatte, war zu groß für sie, stürmte zu mächtig auf sie ein. Sie fühlte sich förmlich erdrückt unter der Masse des Glücks, vor welcher der Gedanke an ihre gegenwärtige Lage zurücktreten mußte.
Und nun, während sie so weinte, begann der Vaquero seine so folgenschwere Unterredung mit Josefa zu erzählen. Er sprach in halblautem Ton, und Marie lauschte jedem seiner Worte.
Da erklang wie der Ton eines unsichtbaren Geistes eine leise Stimme neben ihnen:
»Sorgt Euch nicht. Ich sehe Euch frei. Die Guten siegen, sie haben dann noch eine schwere Prüfung, aber der Vater im Himmel führt sie zum Ziel.«
Der verwundete Haziendero hatte diese Worte gesprochen.
»Señor Pedro!« rief Marie
Er antwortete nicht.
»Señor Arbellez!«
Auch jetzt schwieg er.
Das Licht war niedergebrannt, darum konnten sie den Kranken nicht sehen.
»Hat er im Wachen gesprochen?« fragte sie leise. – »Dann wäre er ja sofort wieder eingeschlafen«, meinte der Vaquero. – »So hat er im Traum geredet.« – »Und der Traum hat ihm die Zukunft gezeigt.« – »Oder es ist noch anders«, sagte Marie zagend. »Hast du nicht schon einmal gehört, daß sich vor dem Auge mancher Sterbenden die Zukunft öffnet? Sie sagen dann Dinge vorher, die anderen verborgen sind.« – »So meinst du, daß unser Señor im Sterben liegt? Nein, das glaube ich nicht, der Tod ist anders. Wir haben ihn verbunden; das hat ihm wohlgetan. Er ist erwacht und hat meine Erzählung gehört, aber so, wie man etwas halb im Traum hört, so hat er auch gesprochen, und dann ist er sofort wieder eingeschlummert.«
Dieser Ansicht schloß sich schließlich auch Marie Hermoyes an.
7. Kapitel
Unterdessen hatte der eine der Mexikaner, die den Vaquero nach dem Keller gebracht hatten, eine Magd hinauf zu Josefa geschickt. Diese fand das Mädchen in der oben bereits erwähnten Stellung. Sie saß auf dem Stuhl, hatte die Stirn auf der Kante des Tisches liegen und hustete in einzelnen, schwachen Stößen Blut aus dem Mund.
»Um aller Heiligen willen, was ist mit Euch, Señorita?« fragte die Magd. »Ihr spuckt ja Blut. Seid Ihr verletzt?«
Josefa hob langsam den Kopf in die Höhe und erwiderte leise:
»Ich muß schreiben. Gib Kissen her.« – »Schreiben? Das geht unmöglich.« – »Es muß gehen.« – Aber man sagte mir, Ihr hättet mehrere Rippen gebrochen.« – »Wer sagte es?« – »Einer von den zweien, die dabeigewesen sind.«
Da fuhr sie langsam mit der Hand nach der Brust. Dann entfuhr ein Wehlaut ihrem Mund, ihr Gesicht wurde erst leichenblaß, dann blutrot, und nun hustete sie wieder so, daß das Blut ihr aus dem Mund floß.
»Seht Ihr es, Señorita, daß der Mann recht hatte?« rief das Mädchen. – »Hole ihn!«
Die Magd ging, und bald trat der ein, von dem sie soeben gesprochen hatte.
»Ihr sagtet vorhin, daß ich einige Rippen gebrochen hätte?« fragte ihn Josefa.
Man sah und hörte ihr an, daß ihr jede Silbe schwerfiel.
»Ja, Señorita«, antwortete er. – »Wißt Ihr, wo der nächste Arzt zu finden ist?« – »Vielleicht in Saltillo oder Castannela. Gewiß weiß ich es nicht.« – »Wie weit ist dies?« – »Einen und einen halben Tag und ebensolange wieder her, also drei Tage.« – »So lange kann ich nicht warten.« – »Ja, näher gibt es keinen Arzt.« – »Kennt Ihr alle Männer genau, die sich jetzt hier befinden?« – »Ich denke, so ziemlich alle.« – »Gibt es nicht zufälligerweise einen unter ihnen, der Arzt gewesen ist?«
Diese Frage war nicht so außerordentlich, als es einem Deutschen scheinen möchte. Da drüben in jenen Ländern spielt das Schicksal sonderbar mit dem Menschen.
»Arzt nicht, aber – Chirurg«, antwortete der Mann zögernd.
Er wollte das Wort Bader denn doch lieber nicht gebrauchen.
»Chirurg? Das ist ja, was ich nötig habe. Wer ist es?« – »Mein Kamerad, der vorhin mit bei Euch war.« – »Der den Vaquero hielt?« – »Ja.« – »Versteht er sich auf Rippenbrüche?« – »Oh, ausgezeichnet. Er hat schon als Lehrling Rippenbrüche geheilt.« – »So holt ihn herauf.«
Der Mann ging und brachte in kurzer Zeit seinen Kameraden herbei, der mit selbstbewußter Miene in das Zimmer trat.
Josefa hatte Mühe, sich auf dem Stuhl zu halten.
»Ihr seid Chirurg?« fragte sie ihn. – »Nein«, antwortete er. – »Dummkopf«, raunte ihm der andere zu. – »Was denn?« fragte sie. »Der da sagte, daß Ihr Chirurg wäret.« – »Chirurg nicht, sondern Bader bin ich, Señorita.« – »Bader? Das ist ja ein sehr großer Unterschied, denke ich.«
Der gute Mann sah ein, daß er einen Fehler gemacht hatte, und antwortete:
»Jawohl, Señorita. Nämlich die Chirurgen heilen die Bein- und Leistenbrüche, die Bader aber heilen die Rippen- und Wasserbrüche.«
Er glaubte, damit seinen Fehler wieder gutgemacht zu haben. Josefa litt zu große Schmerzen, als daß sie über diesen Unsinn nachgedacht hätte.
»Also Ihr versteht, mit Rippenbrüchen umzugehen? Ihr könnt sie einrichten, verbinden und kurieren?« – »Das meine ich.« – »So untersucht mich einmal genau.« – »Legt Euch in die Hängematte.« – »Schafft mich hin.«
Die beiden Männer griffen zu und legten Josefa in die Matte. Da sie nach Art des Landes nur leicht gekleidet war, so konnte die Untersuchung ohne große Schwierigkeiten vorgenommen werden. Sie biß die Zähne zusammen, mußte aber doch einige Male einen Schmerzensschrei ausstoßen.
Endlich war der Mann fertig. Er verstand von dem Bau und den Krankheiten des menschlichen Körpers nicht mehr, als jeder andere Abenteurer, dennoch aber gab er sich den Anschein eines Mannes der Wissenschaft.
»Nun, wie steht es denn?« – »Schlimm, sehr schlimm«, antwortet er. – »Wirklich?« fragte sie voller Angst – »Ja, es steht so schlimm, daß es Euer Tod sein würde, wenn Ihr Euch an einen Pfuscher wendetet. Davon rate ich Euch ab.« – »Nun, was seid Ihr denn da? Ein Pfuscher?« – »Pfui Teufel«, antwortete er stolz. – »Also ein erfahrener Bader?« – »Ja. Fragt nur den da, der weiß es. Der hat Kuren von mir gesehen, Kuren, daß sich einem die Haare sträuben würden.« – »Vor Angst und Schreck?« – »Unsinn! Vor Erstaunen und Bewunderung.« – »Nun also, wie steht es mit mir?« – »Das muß ich Euch erklären. Habt Ihr die Rippen studiert, Señorita?« – »Nein.« – »So muß ich Euch sagen, daß es dreierlei Rippen gibt; solche, die zusammenstoßen, das sind die verheirateten Rippen, solche, die nicht zusammenstoßen, das sind die unverheirateten Rippen, und solche, die nur zuweilen zusammenstoßen, das sind die Konkubinatsrippen. Eine jede Frau hat sechs verheiratete, fünf unverheiratete und vier Konkubinatsrippen auf jeder Seite, macht also zusammen dreißig Rippen vorn und dreißig Rippen hinten. Der Mann hat einige Konkubinatsrippen mehr und eine verheiratete weniger.« – »Wozu das alles?« – »Um Euren Zustand zu begreifen. Der Fußtritt hat eine sehr große Verwüstung bei Euch angerichtet Es sind nicht nur neun Rippen gebrochen, nämlich auf der linken Seite, sondern die gebrochenen und ungebrochenen sind vollständig untereinander geraten – verheiratete, unverheiratete und Konkubinatsrippen. Alles befindet sich bunt durcheinander. Darum stehen Sie so große Schmerzen aus. Das alles auseinanderzubringen, ist wahrhaftig nicht jedermanns Sache.« – »Werdet Ihr es fertigbringen?« – »Das versteht sich«, antwortete er, sich in die Brust werfend. – »Wie lange wird es dauern?« – »Vier bis fünf Stunden.«
Josefa wurde leichenblaß.
»Fünf Stunden«, hauchte sie, »das ist ja unerhört.« – »Unerhört? Bei neun Rippen? Wo denkt Ihr hin. Ich habe in Durango zugesehen, wie ein Kolleg nur drei gebrochene Rippen einrichtete, was bei ihm elf volle Stunden dauerte, und als die Patientin gesund war, stellte es sich heraus, daß er zwei von diesen Rippen so dumm eingerichtet hatte, daß sie zwei Fuß lang hinten zum Rücken hinausstanden.« – Aber die Schmerzen«, sagte sie bang. – »Pah, das tut nicht sehr weh, das ist ungefähr so, als wenn Euch ein ziemlich großer Floh sticht. Und tut es einmal weher, so ist es am besten, man beißt die Zähne zusammen und fällt in eine Ohnmacht. Werdet Ihr das können?« – »Ich denke.« – »Nun, so kann es wohl losgehen?« – »Halt. Zuvor eine Frage. Darf ich dann gleich schreiben?« – »Wo denkt Ihr hin. Es würden Euch ja alle neun zum Rücken hinausfahren, wie der Frau in Durango. Ihr müßt im Bett liegenbleiben.« – »Gut, so werde ich vorher schreiben.« – »Ist das so notwendig?« – »Ja.« – »Aber Ihr werdet dabei große Schmerzen ausstehen.« – »Das muß ich ertragen.« – »Ganz, wie Ihr wollt. Ich muß Euch aber sagen, daß ich mit diesen neun Rippen nicht allein fertig werden kann.« – »So braucht Dir also Hilfe?« fragte sie erschrocken. – »Ja.« – Aber woher diese nehmen?« – »Ist schon gefunden. Hier mein Kamerad.« – »Ist er denn auch Chirurg oder Bader?« – »Nein, das ist gar nicht notwendig. Ich brauche nur einen Mann, der aufpaßt, daß die verheirateten, unverheirateten und Konkubinatsrippen nicht wieder zusammenfahren, wenn ich sie auseinandergelesen habe. Er muß sie festhalten, bis ich eine nach der anderen eingerichtet habe.« – »Nun gut, er mag Euch helfen. Ich werde Euch rufen lassen, wenn ich Euch brauche. Schickt mir die Magd und noch eine zweite dazu.«
Die beiden Männer gingen. Unten sagte der Bader zum anderen:
»Habe ich das nicht gut gemacht?« – »Famos! Sind wirklich neun entzwei?« – »Unsinn; es sind nur sechs. Drei habe ich dazugelogen, um ein besseres Trinkgeld zu erhalten. Verstehst du mich?« – »Sehr gut. Du bist ein Schlaukopf. Aber war das mit den dreierlei Rippen auch wirklich wahr?« – »Hm, darüber bin ich noch selbst im Zweifel. Ich glaube, das hat mir einmal ein Spaßvogel aufgebunden, und nun habe ich es auch glücklich wieder abgeladen.« – »Und sie hat es geglaubt?« – »Ah, Weiber glauben alles, wenn sie ein paar Rippen gebrochen haben, sonst aber glauben sie verdammt wenig, das kann ich dir sagen.« – »Hm, das ist meine Erfahrung auch. Aber ich will nach den Mägden sehen, damit sie nicht so lange zu warten braucht.«
Eine Viertelstunde später saß Josefa, von Kissen unterstützt und von den zwei Mägden gehalten, vor dem Tisch und schrieb. Es ging nur langsam, und es war viel, was sie schrieb. Endlich war sie fertig und schickte die Mädchen fort, zugleich ließ sie einen der Unteranführer rufen und fragte ihn:
»Hat Euch mein Vater seine Route mitgeteilt?« – »Ja, im geheimen, Señorita«, antwortete er. – »Ihr würdet ihn also treffen, wenn ich Euch ihm nachschickte?« – »Sicher.« – »Wann?« – »Er reitet schnell. Vier Tage würde ich brauchen.« – »Wenn Ihr ihn von jetzt an in vier Tagen erreicht und ihm diesen Brief übergebt, erhaltet Ihr dreihundert Duros ausgezahlt. Wollt Ihr diese Botschaft übernehmen?« – »Ja«, antwortete der Mann, indem sein Gesicht strahlte. – »Aber mein Vater braucht noch mehr Leute. Könnten wir fünfzig Mann entbehren?« – »Ja, ganz gut.« – »So nehmt fünfzig wohlbewaffnete Männer mit. Ihr werdet später erfahren, weshalb. Nur so viel kann ich Euch sagen, daß es einen Zug gilt, der Euch Auszeichnung und gute Beute bringen wird. Diesen Brief aber gebt ja in keine anderen Hände, als in die meines Vaters.«
Der Brief lautete wie folgt:
»Lieber Vater!
Ich habe kurz nach deinem Wegritt höchst Wichtiges erfahren. Ein alter Vaquero, derjenige, den Arbellez nach Fort Guadeloupe geschickt hatte, kam zurück, wurde festgehalten und von mir verhört. Es gelang mir, ihm folgendes zu entlocken:
Henrico Landola hat ein falsches Spiel mit uns getrieben. Keiner unserer Feinde ist tot sie leben alle noch. Sie wurden auf einer wüsten Insel ausgesetzt von der sie sich jetzt gerettet haben. Gegenwärtig befinden sie sich in Fort Guadeloupe, um unter Juarez‘ Schutz gegen uns loszubrechen. Es sind: Sternau, Mariano, Graf Ferdinando, die beiden Helmers, Büffelstirn, Bärenherz, Emma Arbellez und Karja. Graf Ferdinando bleibt auf dem Fort, weil er verwundet ist; er wird unter Apachenbedeckung später den anderen nachreiten. Diese sind mit Juarez nach Chihuahua aufgebrochen, von wo sie dann nach Coahuila gehen werden, um auch dieses zu erobern.
Juarez hat vier Kompanien Franzosen vernichtet und ebenso viele Komantschen. Östlich von Coahuila, am Zusammenfluß des Sabinaflusses mit dem anderen Arm, wollen sie Lord und Amy Lindsay treffen.
Du weißt nun, wie die Sachen stehen, und wirst dir selbst sagen, was geschehen muß. Sie müssen natürlich alle sterben, sonst sind wir verloren. Triff deine Maßregeln schnell, ich sende dir zu diesem Zweck noch fünfzig Männer nach.
Handle schleunigst, daß du bald zurückkehren kannst. Ich bedarf deiner, denn ich habe neun Rippen gebrochen, die mir jener Vaquero eingetreten hat, aus Rache, daß ich ihn überlistet und ausgehorcht habe.
Deine Josefa.«
Noch vor Abend sprengte die Truppe von fünfzig Mann zum Tor der Hazienda hinaus. Der Anführer trug den Brief wohlverwahrt bei sich.
Um dieselbe Zeit lag Josefa auf einem über den Boden ausgebreiteten Teppich. Die Operation hatte begonnen. Während der eine Mexikaner sie mit seinen Fäusten hielt, arbeitete der andere an ihren sechzig Rippen in einer Weise herum, daß ihr der blutige Schaum vor dem Mund stand.
Man hörte in der ganzen Hazienda ihr Schmerzgeschrei, das einem tierischen Gebrüll ähnlicher klang, als menschlichen Wehlauten. Man wollte bei ihr eintreten, um zu sehen, ob das nicht zu ändern sei, aber die beiden Operateure hatten von innen die Tür verschlossen und ließen keinen Menschen ein.
Erst nach mehreren Stunden hörte das Brüllen auf, und wer an der Tür horchte, konnte ein halblautes, ununterbrochenes Wimmern vernehmen. Die Tochter Cortejos litt unsägliche Schmerzen. In diesem Augenblick hätte sie den Tod willkommen geheißen. Und doch ahnte sie nicht, daß sie diese Schmerzen nun stets empfinden werde als Begleiter für das ihr noch zugemessene Leben. Die Rache des gerechten Richters hatte mit heute begonnen.
8. Kapitel
Gehen wir zurück in die Zeit, mit der das Nachfolgende sich im innigsten Zusammenhang befindet, so treten wir durch das Portal des Palacio imperiale – des kaiserlichen Palastes – in Mexiko, steigen die Treppe empor und begeben uns in das Audienzzimmer, in dem Max die Spitzen seiner Behörden zu empfangen pflegte.
In diesem Augenblick lehnt der Kaiser mit dem Rücken an einem Tisch. Sein Auge ruht auf einem großen Schriftstück, das er in den Händen hält. Dieses Auge blitzt, die Wangen sind gerötet, sein Inneres scheint in gewaltiger Bewegung zu sein.
Vor ihm steht einer seiner Minister und hält den Blick mit einem fast lauernden Ausdruck auf den Gebieter gerichtet.
Unweit des Fensters, in einem Fauteuil, sitzt die Kaiserin in all ihrer Jugend und Schönheit. Sie scheint mehr Männliches als der Kaiser selbst zu besitzen. Er schwärmerisch, träumerisch und weich, sie nach Glanz und Ehren strebend, er ein Poet, sie feurig trachtend nach materiellen Werten.
Der Minister schien gesprochen zu haben, denn Kaiser Max antwortete:
»Sie verlangen meine endgültige Entscheidung? Jetzt gleich?« – »Ich muß um dieselbe bitten, Majestät.« – »Ich bin entschlossen …« – »Abzulehnen etwa?« fragte die Kaiserin schnell.
Max drehte sich ihr mit lächelnder Miene zu und erwiderte:
»Wie ich höre, sind Sie mit der Entscheidung bereits zustande?« – »Allerdings.« – »Darf ich fragen, wie sie lautet?« – »Bei dem siegreichen, überzeugenden Eifer, mit dem diese hochwichtige Angelegenheit soeben vorgetragen wurde, kann die Entscheidung nicht zweifelhaft sein. Ich stimme bei.«
Max nickte und sagte, zu dem Minister gewandt:
»Sie hören, wie man sich beeilt, meiner Anerkennung vorzugreifen. So will ich Ihnen denn sagen, daß ich nicht bloß bereit bin, dieses Dekret zu unterschreiben, sondern ich werde, Wort für Wort, es selbst zu Papier bringen und den Herren Ministern zur Signatur unterbreiten.« – »Ich danke, Majestät«, erwiderte der Minister mit einer tiefen Verneigung. »Es ist die Aufgabe meines Berufes und Lebens, all mein Sinnen und Denken für das Wohl Mexikos und seines Kaisers einzusetzen. Ich bin überzeugt, daß wir mit diesem Schritt siegreich über alles hinwegschreiten, was sich uns bisher hindernd und störend in den Weg gestellt hat. Mit einem vulgären deutschen Wort zu sagen: Wir ›räumen auf‹. Das war doch endlich einmal sehr notwendig.« – »Sie haben recht mein Lieber. Ich werde …«
Da erschien der Diensthabende. »General Mejia!« meldete er. – »Sogleich eintreten!« befahl der Kaiser.
Eigentümlich war es, daß die Kaiserin sich sofort erhob und durch eine Tür verschwand, während Max den Minister verabschiedete. Dieser traf mit dem berühmten General unter der Tür zusammen. Beide machten einander eine kalte Verneigung, ohne aber einen Blick auszutauschen.
»Willkommen, General!« begrüßte Max den Eintretenden. »Sie kommen heute gerade zur guten Stunde.«
Das ernste Gesicht des Mexikaners zeigte ein schönes, aufrichtiges Lächeln, als er die heiteren Züge seines Herrschers bemerkte.
»Ich bin ganz glücklich, dies zu hören, Majestät«, erwiderte er. »Wollte Gott, es wären Eurer Majestät und dem Reich lauter solche Stunden beschert.« – »Ich hoffe, daß es von jetzt ab geschehen werde.« – »Darf ich fragen, ob diese Hoffnung eine gewisse Veranlassung hat?« – »Ja. Ich stehe im Begriff, ein wichtiges Dekret zu erlassen.« – »Wenn es die erwähnte Wirkung haben soll, so ist es allerdings wichtig.« – »Da, überzeugen Sie sich selbst. Lesen Sie.«
Der Kaiser reichte Mejia den Entwurf hin und trat an das Fenster. Während er durch dasselbe hinabblickte, um dem General Muße zu lassen, die Lektüre mit Sammlung vorzunehmen, warf dieser sein Auge auf die Zeilen.
Je weiter er las, desto mehr zogen sich seine Brauen zusammen, seine Augen blitzten zornig, seine Lippen zuckten. Dann hörte Max ein lautes Papierrascheln hinter sich, und als er sich umblickte, sah er den General dastehen, ein Bild des höchsten Zorns, das zerknitterte Papier in der Faust.
»Majestät, wer hat dieses – dieses Machwerk verfaßt?« fragte er.
In seinem Zorn hatte er nicht an die Regeln der Etikette gedacht.
Der Kaiser, sonst so gütig, konnte so etwas nicht gut übergehen.
»General!« sagte er in ernstem Ton. – »Majestät!« erwiderte Mejia und verneigte sich bei diesen Worten, wie um sich zu entschuldigen. – »Wo ist mein Entwurf?« – »Hier, Majestät.«
Der General nahm das Papier, glättete es so gut wie möglich und reichte es dem Kaiser hin.
»Ah, in welchem Zustand! Sind meine Diarien etwa Kottillonzeichen?«
Max war jetzt wirklich zornig, da entgegnete Mejia:
»Ich bitte alleruntertänigst um Gnade, Majestät. Was hier gesündigt wurde, das ist nur meinem Eifer für das Wohl des Kaisers zur Schuld zu schreiben.« – »Aber dieser Eifer darf nichts anderes als nur Eifer sein.«
Über Mejias Gesicht zuckte ein undefinierbarer Zug. Max kannte denselben. Wenn er sich zeigte, so brannte der Vulkan im Innern des Generals.
»Kann mir nicht vergeben werden, so diktiere ich mir selbst die größte Strafe«, sagte er. »Erlauben mir Eure Majestät, mich zurückzuziehen!«
Ohne eine Antwort abzuwarten, begann er, sich rückwärts nach der Tür zu bewegen.
»Halt!«
Auf diesen Zuruf des Kaisers blieb der General stehen. »Haben Sie das Dekret bis zu Ende gelesen?« – »Ja. Majestät.« – »Sie nannten es ein Machwerk; es hat also Ihren Beifall nicht?« – »Nein.« – »Warum nicht?« – »Darf ich meine Meinung aufrichtig sagen, Majestät?« – »Ich ersuche Sie darum.« – »Hätten Ihre ärgsten Feinde in Ihrem Namen ein Dekret erlassen, um Sie sicher zu verderben, so hätten sie dieses hier wählen müssen.« – »Ah, welch eine Anschauung!« – »Die richtige, Majestät.« – »Ich habe meinen Untertanen einmal zu zeigen, daß ich Kaiser bin.« – »Sie werden es doch nicht glauben.« – »Ah, General, das klingt ja fast wie eine Beleidigung.« – »Majestät haben mir befohlen, die Wahrheit zu sagen. Mexiko wird bei jedem Dekret meinen, daß es von den Franzosen diktiert sei.« – »So mag man es auch von diesem sagen; ich aber werde es ausführen.« – »Majestät, ich bitte, mir den Kopf zu nehmen, aber dieses Schriftstück in der Mappe zu lassen. Ich kenne mein Volk, kenne Mexiko und weiß, welche Folgen die Bekanntmachung des Schriftstückes nach sich ziehen würde.« – »Nun, welche?« – »Es wird ein Schrei der Entrüstung durch das ganze Land gehen.« – »General!«
Die Augen des Kaisers blitzten zornig.
»Majestät!«
Die Augen des Generals blitzten auch.
Max wußte, was er Mejia dankte; er besann sich und sagte:
»Hören Sie meine Verteidigung!« – »Oh, Majestät, wenn das Dekret einer Verteidigung bedarf, so …« – »Sie wollen mich wirklich ernstlich erzürnen!« – »Nein, ich schweige.« – »So hören Sie.«
Der Kaiser begann nun, was bei einem Herrscher allerdings Selbstüberwindung genannt werden muß, sich zu verteidigen.
»Sie wissen, General«, sagte er, »daß sich alle Hauptstädte und Häfen des Landes in unserer Gewalt befinden …« – »In der Gewalt der Franzosen, Majestät.« – »Das ist gleich. Sie sind unsere Verbündeten.« – »Ich sehe es aber kommen, daß sie das Land verlassen und die Hauptstädte und Häfen nicht uns, sondern den Republikanern überlassen werden.« – »Sie sehen zu schwarz, wie immer. Das Land ist in unserer Gewalt. Juarez ist nach El Paso entwichen; ja, man sagt, daß er den mexikanischen Boden ganz verlassen habe. Es ist Zeit, durch eine feste, ernste Kundgebung die Stellung zu nehmen, die wir für immer festhalten wollen.« – »Zugegeben, Majestät. Was wird dies für eine Stellung sein?« – »Eine beruhigende und zugleich vernichtende.« – »Ah.« – »Ja. Trotzdem sich das Land in meiner Gewalt befindet, wagen es gewisse Maulwürfe, im Boden fortzuwühlen. Da ist dieser Panther des Südens, dieser Cortejo und noch einige andere. Ich erkläre in meinem Dekret, daß ich von heute an jeden Republikaner gleich einem Banditen, Straßenräuber und gemeinen Verbrecher bestrafen werde. Von heute ab sind die Republikaner vogelfrei; sie stehen außerhalb des Gesetzes. Jede republikanische Truppe erkläre ich für eine Bande, und jedes ergriffene Mitglied einer solchen Bande soll binnen vierundzwanzig Stunden erschossen werden.«
Mejia schüttelte den Kopf.
»Banditen, Straßenräuber? Vogelfrei – erschossen? O Majestät, ich wiederhole meine Bitte: Nehmen Sie meinen Kopf, aber geben Sie den Gedanken auf, dieses Dekret zu sanktionieren.« – »Behalten Sie Ihren Kopf; ich behalte mein Dekret; es ist in allen seinen Teilen von erfahrenen Männern sorgfältig überlegt.« – »Oh, diese erfahrenen Männer kennen Mexiko nicht. Sie haben alles überlegt, nur das eine nicht.« – »Was?« – »Ich fürchte nichts als nur die Ungnade meines Kaisers.« – »Sprechen Sie ohne Furcht, General.« – »Nun wohl! Majestät sind wirklich entschlossen, dieses Dekret zu unterzeichnen?« – »Fest entschlossen!« – »So werden Sie sich Ihr eigenes Todesurteil damit ausfertigen.«
Das Blut wich aus den Wangen des Kaisers zurück. Es war fast, als ob er heftig erschrocken sei. Aber er faßte sich schnell und erwiderte:
»Mein Todesurteil? Sie sprechen von einer Unmöglichkeit, die zugleich eine Ungeheuerlichkeit ist, wie von etwas ganz Selbstverständlichem.« – »Allerdings, denn was ich sagte, ist mir ganz selbstverständlich.« – »Erklären Sie das!« – »Das wird nicht schwer sein, Majestät. Zugegeben, daß der echte, geborene Mexikaner der rechtmäßige Besitzer dieses Bodens ist …« – »Ich gebe dies zu«, fiel der Kaiser ein. – »… muß er auch das Recht haben«, fuhr der General fort, »diesen Boden gegen eine fremde, ungerechte Invasion zu verteidigen.« – »Invasion? Ungerecht? Das sind starke Ausdrücke, die sich ganz sicher bedeutend mildern lassen.« – »Ich spreche jetzt, wie jeder Republikaner spricht. Denken Majestät sich an die Stelle dieser Leute. Sie sagen: Das Land ist unser. Was wollen die Franzosen? Unser Geld, unsere Früchte, unsere Frauen und Töchter. Sie sind Räuber. Was bringen sie uns dafür? Einen Kaiser! Wozu? Wir brauchen keinen, wir haben einen Präsidenten. Napoleon hat Angst vor seinem Volk; er muß die Unzufriedenen beschäftigen. Er kommt auf den Einfall, der Phantasie seiner Untertanen durch ein großes Ausstattungsstück zu schmeicheln. Er bringt zur Aufführung eine kriegerische Zauberei durch den Kaiser Max von Mexiko. Das schmeichelt der Eigenliebe der Franzosen; das gibt dem Ruhm neuen Glanz. Und weil dies Napoleon einfällt, muß Mexiko bluten, dulden und verwüstet werden.« – »So arg ist‘s nicht«, fiel der Kaiser ein. – »O doch! Ich weiß am besten, wie die Herren Franzosen hausen. Der echte Mexikaner ist Republikaner; er verteidigt sein Land, sein Heim, seinen Herd gegen fremde Eindringlinge. Ist er deshalb ein Bandit, der binnen vierundzwanzig Stunden erschossen werden muß?« – »Wir sind durch das Schwert Herren des Landes. Jeder Mexikaner hat sich den Umständen zu fügen.« – »Gut, Majestät! Ich spreche jetzt nicht zu meinem Kaiser, sondern zu dem, für den ich mein Leben tausendmal opfern würde. Angenommen, dieser Satz wäre das richtige: Das Schwert entscheidet; wer siegt, ist Herr; der Überwundene hat zu gehorchen. Folgt aber daraus wirklich, daß man den Gegner als Banditen betrachten muß?« – »Nachdem die anderen die Waffen streckten. Ja.« – »Gut, so soll auch dieses als richtig angenommen werden. Wer aber sagt, daß der Besiegte sich nicht erheben und zum Sieger werden kann?« – »Im allgemeinen ist diese Möglichkeit vorhanden.« – »Nun, dann wird er den Spieß umdrehen und den früheren Sieger als Banditen betrachten und behandeln.« – »Das ist für Mexiko niemals zu befürchten.« – »Wollte Gott, daß Majestät nicht irren. Für kein Land ist dies eher zu befürchten, als für Mexiko. Das Land ist ein Vulkan. Und Juarez …« – »Er ist unschädlich.« – »Er ist noch löwenstark selbst an der äußersten Grenze des Reiches.« – »Ich werde ihn amnestieren.« – »Er wird die Amnestie verschmähen; er wird sie für ein Unding erklären, er wird sagen, daß er als Präsident des Landes das Recht habe, einen gewissen Max von Habsburg zu amnestieren, nicht dieser aber ihn.« – »Ich werde ihn zu mir rufen.« – »Er wird nicht kommen.« – »Auch nicht, wenn ich ihn als Präsident des obersten Gerichtshofes anstelle?« – »Das war er bereits. Er ist jetzt Präsident des ganzen Landes.« – »Sie machen mir wirklich heiß, General.« – »Besser, als wenn Majestät später kaltgemacht werden.« – »Sie reden wirklich in mehr als kühnen Bildern!« – »Ich bin überzeugt, nur die Wahrheit zu sagen. Wenn Majestät jetzt den Besiegten als Banditen behandeln, so darf Majestät sich nie besiegen lassen, denn man würde Revanche nehmen und Sie auch als Banditen behandeln.« – »Man müßte selbst in diesem Fall bedenken, wer und was ich bin!« – »Kaiser? Ah, Sie würden als solcher von den Republikanern nicht anerkannt.« – »Erzherzog von Österreich!« – »Was fragt Juarez nach Österreich.« – »Ich dächte doch, daß Österreich eine Macht wäre, welche …« – »Welche selbst den Erzherzog Max aufgeben wird, wenn es so der Wille Napoleons, des Allmächtigen, ist.« – »General, Sie beleidigen jetzt wirklich!« – »So will ich nichts mehr sagen; nur die eine Frage gestatte ich mir noch: Wird das Dekret unterzeichnet?« – »Ja, bereits morgen.«
Da zog Mejia seinen Dolch und sagte:
»Majestät, sagen Sie, daß dies nicht geschehen soll, und ich stoße mir diesen Stahl mit Freuden in mein Herz. Ich will noch sterbend Ihre Großmut segnen.« – »Es ist beschlossen, es ist notwendig; es wird geschehen, General.«
Da beugte Mejia, noch immer den Dolch in der Hand haltend, sein Knie vor dem Kaiser und sagte:
»Majestät, von dem Augenblick an, wo das Dekret erscheint, steht das Grab Ihnen offen an der Festungsmauer, hinter dem Sandhügel, auf dem man kniet mit der Binde um die Augen. Ich werde Sie nicht verlassen und daher von diesem Tag an ein Sterbender sein. Nicht für mich flehe ich, nicht für andere, nicht für Mexiko, sondern ich flehe für Sie. Bereiten Sie der Welt nicht das Schauspiel, daß ein deutscher Kaisersohn standrechtlich von mexikanischen Bandilleros erschossen wird.« – »Stehen Sie auf, General«, entgegnete Max zürnend. – »Nein, ich bleibe liegen, bis …« – »Sie stehen auf: ich befehle es! Sie phantasieren ja!«
Des Kaisers Stimme klang kalt und frostig, fast ein wenig höhnisch. Dies letztere konnte Mejia, der ehrliche Held und Kämpe, am wenigsten vertragen. Er sprang also auf, warf einen mitleidigen Blick auf den Kaiser und sagte:
»So muß ich alle Hoffnungen aufgeben, Majestät?« – »Alle. Selbst die Kaiserin stimmt mir bei.«
Das Gesicht des Generals wurde um einen Schatten bleicher.
»Dann habe ich allerdings zu schweigen«, erwiderte er. »Aber damit diese Stunde nicht vergessen werde, und die Worte, die ich gesprochen habe, will ich sie festspießen mit dem Stahl, den ich mit Freuden in mein Herz gesenkt hätte.«
Mit diesen Worten erhob er den Arm und schleuderte den Dolch mit solcher Gewalt gegen die Wand, daß er bis an das Heft in das Tafelwerk fuhr, verbeugte sich vor dem Kaiser und schritt davon.
Max blickte ihm nach und dann nach der Stelle, wo der Dolch steckte.
»Sollte dies ein Omen sein?« sagte er. »Sollte ich mich geirrt haben?«
Er hatte jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn soeben trat ein anderer General ein, Miramon, der Unehrliche, der ihn in seinem Vorsatz bestärkte.
Das berüchtigte Dekret erschien wirklich. Max hatte es mit eigener Hand geschrieben und damit sein Todesurteil unterzeichnet.
Der Krieg war bisher mörderisch geführt worden, wenigstens von seiten der Franzosen, die mit ihren republikanischen Gefangenen wirklich wie mit Räubern umgingen, während es eine unbestreitbare Tatsache ist, daß Juarez und die meisten seiner Generäle ihre Gefangenen mit großer Milde und Freundlichkeit behandelten.
Von Bazaine weiß man nur, daß er die Ausführung des Dekrets sehr energisch forderte. Zu Dutzenden, zu Hunderten wurden nun die Republikaner getötet. Erbarmungslos wurden hohe Generale erschossen, wie Salazar und Arteago, vielbetrauerte Märtyrer für die Unabhängigkeit ihres Landes.
Aber der Gang der Nemesis, der gewöhnlich ein sehr langsamer und hinkender ist, war dieses Mal sehr rasch und fest.