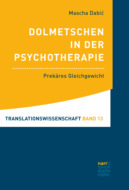Kitabı oku: «Dolmetschen im Medizintourismus», sayfa 6
2.1.4 Ethnomedizinische Aspekte
Durch das Modell der partizipativen Entscheidung ist die medizinische Kommunikation in den vergangenen Jahren dialogischer und narrativer geworden (vgl. Koerfer/Albus 2015: 118). So können die von den ÄrztInnen gestellten offenen Fragen während der Gesprächsinitialisierung und der Informationsakquise den PatientInnen helfen, das eigene Krankheitsverständnis und die Schmerzwahrnehmung zu kommunizieren oder zu offenbaren. Diese Offenbarungen sind im Sinne der biopsychosozialen Medizin, die nicht nur die dichotomische Dimension von Gesundheit oder Krankheit, sondern auch die psychischen und sozialen Faktoren hervorhebt, von enormer Relevanz: „Krankheit und Gesundheit sind im biopsychosozialen Modell nicht als ein Zustand definiert, sondern als ein dynamisches Geschehen“ (Egger 2005: 3). Das Kranksein ist als dynamisch und in einem direkten sozialen und kulturellen Kontext eingebettet zu verstehen (vgl. Domenig 2003: 28). Der kulturelle Kontext kann darüber hinaus vorschreiben, wie sich Kranke zu verhalten haben. In manchen Kulturkreisen verhalten sich zum Beispiel PatientInnen als Kranke, da dies von ihnen erwartet wird: „They have to lie in bed, refuse to do anything for themselves, cry out in pain and so on“ (Crezee 2013: 27). Aus diesem Grund kann es sogar vorkommen, dass die Kranken bestimmten Empfehlungen zu Essgewohnheiten bzw. körperlicher Tätigkeit nicht nachkommen, obwohl ihnen nach einer Operation empfohlen wird, Sport zu treiben (vgl. Crezee 2013: 27f.). In einigen Kulturkreisen gilt darüber hinaus eine Krankheit als Angelegenheit der gesamten Familie: Die Krankheit besitzt eine intersubjektive Dimension und die Familie hat eine Beistandspflicht (vgl. Bechmann 2014: 222f.).
Hinsichtlich des narrativen Ansatzes bildet besonders die Schmerzbeschreibung eine Herausforderung für alle Beteiligten, denn der Kommunikationsstil unterscheidet sich nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern wird auch von kulturbedingten Aspekten beeinflusst (vgl. Menz et al. 2013: 23). So wird der Präsentationsstil u.a. von der Kultur der Sprechenden beeinflusst, die sich in einem ärztlichen Erstgespräch darüber verwundert zeigen könnten, dass die Kommunikation nicht dem Muster eines für sie gewohnten Small Talks folgt. Schmerzen basieren zwar immer auf subjektiven Erfahrungen (vgl. Crezee 2013: 27, Spranz-Fogasy/Becker 2015: 94f.), aber sie weisen mehrere Dimensionen auf: „Nach dem Dreiebenenmodell menschlichen Verhaltens beinhaltet Schmerz psychologische, physiologische und soziale Aspekte“ (Bergener 1987: 21). Die Schmerztoleranz – aber auch die Meinungsbildung zum Schmerz – ist daher nicht vom Individuum isoliert zu betrachten, sondern wird von soziokulturellen Faktoren beeinflusst. Lalouschek (2008: 31ff.) thematisiert die Kulturgebundenheit sowie die soziokulturelle Dimension von Schmerzbeschreibungen, Beschwerden und Syndromen sowie die Geschlechtsspezifik von Krankheit und Gesundheit. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Kulturkreisen zeigt sie den Zusammenhang zwischen Symptomwahl, Symptomdifferenzierung und Krankheitsbeschreibungen.1 Deutschsprachige PatientInnen weisen in der Regel unabhängig vom Alter eine relativ hohe Schmerztoleranz auf (vgl. Delli Ponti/Forlivesi 2005: 198) und klagen seltener und weniger über Schmerzen im Vergleich zu PatientInnen aus dem Mittelmeerraum. Delli Ponti und Forlivesi (2005) führen als Beispiel den Fall eines deutschen Patienten an, der fünf Stunden im Wartesaal der Notaufnahme saß, ohne sich zu beschweren, obwohl die ÄrztInnen, die ihn später untersuchten, seine Lage viel ernster bewerteten als jene anderer PatientInnen aus Italien, Albanien und dem Maghreb, die ihre Schmerzen viel stärker nach außen getragen hatten und daher früher behandelt worden waren. Auch die non- und paraverbale Sprache bei der Schilderung von Schmerzen spiegelt soziokulturelle Aspekte wider: „Patients from some cultures express the fact that they are in pain by yelling, shouting and moaning, whereas people from other cultural backgrounds may have learned to grit their teeth and ‘suffer’ in silence“ (Crezee 2013: 28). Die individuelle Dimension des Schmerzempfindens (vgl. Meyer/Bührig 2014: 305) und das subjektive, private Krankheitsmodell (vgl. Bechmann 2014: 158) werden also um die kulturbedingte Schmerzkonzeption ergänzt. Daraus kann eine schwer nachvollziehbare Schmerzbeschreibung entstehen, die die Erstellung einer Diagnose deutlich schwieriger gestaltet.
Manche Syndrome gelten in der medizinischen und sprachwissenschaftlichen Literatur als kultur- und genderspezifisch, weshalb sie nur unter Berücksichtigung des spezifischen (sub-)kulturellen Kontexts verstanden werden können. Um diese Elemente der Beschwerdeschilderung zu verstehen, ist Kulturkompetenz in beiden Sprachen von großer Bedeutung. Ein Beispiel ist das mittel- und südamerikanische susto, ein „Schrecken, der zu Seelenverlust führt“ (vgl. Lalouschek 2008: 33). Oder die cervicale für italienischsprachige Menschen (vgl. Mitzman 2011), die in anderen Ländern nur als steifer Nacken oder Nackenschmerzen beschrieben und nicht unbedingt als ernsthafte Problematik wahrgenommen wird. Ein weiteres Beispiel für die Kulturgebundenheit von Schmerzen ist das sogenannte Mittelmeer-Syndrom, auch Morbus mediterraneus oder Morbus bosporus genannt, das durch eine exzessive Emotionalität gekennzeichnet ist und eine „erhöhte Somatisierungsneigung und Tendenz zur Somatisierung psychischer Störungen“ (Bechmann 2014: 221) von PatientInnen aus bestimmten Regionen bedeutet.2
Auch Tabus, die in jeder Gesellschaft existieren und Unterschiede zwischen Sprach- und Kulturkreisen aufweisen, können die ÄrztInnen-Patienten-Kommunikation beeinflussen. Dazu gehören Krankheiten oder Themen, die besonders mit Sexualität, Tod und menschlichen Sekreten verbunden sind (vgl. Trubel 2004: 48). Was als Tabukrankheit wahrgenommen wird, verändert sich im Laufe der Zeit (vgl. Kautsch 2012). Typische Beispiele für Krankheiten unserer Zeit, die einer gesellschaftlichen Stigmatisierung unterliegen, sind Harninkontinenz, Erektionsstörungen, aber auch depressive Erkrankungen, die Menschen in soziale Isolation zwingen. Bei Tabukrankheiten ist Feingefühl seitens aller Beteiligten notwendig (vgl. Kautsch 2012). Tabus werden häufig durch die Verwendung von Euphemismen zum Ausdruck gebracht (vgl. Trubel 2004: 58). Durch die Kulturkompetenz der DolmetscherInnen können kulturspezifische Tabuisierungen erkannt, behandelnde ÄrztInnen darauf hingewiesen und etwaige Schwierigkeiten im Rahmen der Artikulation der Problematik überwunden werden. Ebenso kulturgebunden kann das Überbringen schlechter Nachrichten sein: In manchen Kulturen wird alleine das Reden über schlechte Nachrichten als Gefahr eingestuft, denn das könnte das Schicksal negativ beeinflussen (vgl. Leet et al. 2002). PatientInnen, die nach einem Aufklärungsgespräch keine weiteren Fragen z.B. zu Risiken und Komplikation stellen, haben somit nicht unbedingt ein fehlendes Interesse an ihrer Gesundheit, sondern möchten vielmehr kein Pech anziehen.
Bührig und Meyer (2015: 303ff.) relativieren den Fokus, den andere AutorInnen auf die ethnischen und kulturellen Besonderheiten der AkteurInnen legen. So sind sie der Auffassung, dass es keine direkte oder kausale Korrelation zwischen kultureller Zugehörigkeit und Umgang mit Krankheit geben kann, da Schmerzen wie auch ihre Beschreibung immer individuell sind. Selbst wenn eine gewisse Loslösung von kulturspezifischen Krankheitskonzepten sinnvoll erscheint und kulturelle Zugehörigkeit nicht die individuelle Dimension der Schmerzwahrnehmung und -kommunikation überlagern sollte, sollten im Sinne des biopsychosozialen Modells soziokulturelle Elemente nicht außer Acht gelassen werden. So kann in Bezug auf das oben erwähnte Beispiel des Mittelmeer-Syndroms die Berücksichtigung der soziokulturellen Dimension der Schmerzen dabei helfen, eine besonders emotionale Schmerzensschilderung seitens südländischer PatientInnen angemessen zu interpretieren und diese weder als theatralische Darstellung abzutun noch als akute lebensbedrohliche Situation einzustufen. Illkilic schlägt in diesem Zusammenhang vor, einen Kulturbegriff zu verwenden, „der die Kulturkreise als sich in einem stetigen Wandel befindliche heterogene Bevölkerungsgruppen versteht, die in einer stetigen Interaktion mit anderen Kulturkreisen stehen“ (Illkilic 2010: 35). Sprache, Religion, Traditionen usw. prägen die Wertvorstellungen und weisen oft einen normativen Charakter auf. Interkulturelle Kompetenz kann ÄrztInnen dabei helfen, ethische Konflikte betreffend „die Patientenautonomie, die Familienautonomie, das beste Interesse des Patienten, Leidenslinderung […]“ (Illkilic 2010: 33) zu analysieren und zu lösen.
2.2 Sprachbarrieren im Gesundheitswesen
Wenn das medizinische Personal und die PatientInnen unterschiedliche Sprachen sprechen, können Probleme in der Kommunikation entstehen, was wiederum einen gravierenden Einfluss auf den Erfolg der Behandlung haben kann. Die Überwindung von Sprachbarrieren im Gesundheitswesen ist aus zweierlei Gründen wichtig: Erstens stellt medizinische Kommunikation „Kommunikation und Medizin zugleich“ (Bechmann 2014: 5) dar, und zweitens können das Recht auf Unversehrtheit und Selbstbestimmung sowie das Aufklärungsrecht nur durch eine missverständnisfreie Kommunikation gewahrt bleiben (vgl. Reisewitz 2015: 23ff.).
Zur Analyse der Sprachbarrieren im Gesundheitswesen sollte zuerst ermittelt werden, welche fremdsprachigen PatientInnen sich einer medizinischen Behandlung unterziehen müssen. Hoefert (2008: 107) unterscheidet innerhalb der fremdsprachigen PatientInnen zwischen zwei PatientInnengruppen. In der ersten Gruppe finden sich Menschen mit Migrationshintergrund, die Teil der Bevölkerung des Ziellandes geworden sind. Die zweite Gruppe umfasst hingegen Menschen, die zwecks einer medizinischen Behandlung im Rahmen des Medizintourismus in das Zielland einreisen. Eine Mehrheit der bisher veröffentlichten Untersuchungen zur medizinischen Kommunikation beschäftigt sich mit jener PatientInnengruppe, die einen Migrationshintergrund aufweist. Eine systematische Erfassung der Sprachbarrieren, mit denen diese Gruppe beim Zugang zur medizinischen Versorgung konfrontiert ist, findet sich im deutschsprachigen Raum allerdings nur in wenigen Studien. Eine dieser systematischen translationswissenschaftlichen Studien ist jene von Pöchhacker (2000a bzw. 2013: 109ff.) aus dem Jahr 1996, die die Kommunikation mit nicht deutschsprachigen PatientInnen in zehn Wiener Krankenhäusern untersucht.1 Im Rahmen dieser quantitativen Umfrage wurden ÄrztInnen, TherapeutInnen und Pflegepersonal aus 71 Abteilungen und Kliniken zum Thema Sprachbarrieren befragt. Aus den Antworten ergab sich, dass Kommunikation mit PatientInnen, die nicht Deutsch sprechen, zum Alltag des medizinischen Personals gehört und dass 27 Sprachen verwendet wurden. Während in den gynäkologischen Abteilungen das Ausmaß an Kommunikation mit nicht deutschsprachigen PatientInnen besonders hoch war, fiel der Kommunikationsanteil mit dieser Gruppe in den psychiatrischen Abteilungen deutlich geringer aus. Die Kommunikation mit nicht deutschsprachigen PatientInnen erfolgte bei 7% der Befragten ohne zusätzliche Hilfe, während 90% auf die Hilfe Dritter zurückgriffen. Bei den genannten Dritten handelte es sich meist um Begleitpersonen (häufig die Kinder der PatientInnen), gefolgt von fremdsprachigem Krankenhauspersonal – das häufig das Reinigungs- oder Pflegepersonal und nur selten ÄrztInnen umfasste. Der Einsatz von dolmetschenden Begleitpersonen wurde fast immer als problematisch eingestuft, da diese laut den Befragten keine medizinischen oder terminologischen Kenntnisse besaßen und aufgrund ihrer persönlichen Nähe zu den PatientInnen befangen waren. Hingegen wurde die Einbeziehung des Krankenhauspersonals als Dolmetschende von den Befragten als nicht so problematisch erachtet. Wie Pöchhacker ausführt, bergen diese drei Möglichkeiten zur Überbrückung der Sprachbarrieren einige Gefahren, für die in den Krankenhäusern häufig das Bewusstsein fehlt. Zu diesen Gefahren zählen laut Albrecht (2015: 4) Fehlinformationen bei PatientInnen, Fehldiagnosen aufseiten der ÄrztInnen, zusätzliche Untersuchungen und Wiederholungen der Therapie, längere Verweildauer und höhere Behandlungskosten.
Sprachbarrieren gibt es nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in ärztlichen Praxen. So beschreibt Leitner (2013) anhand einer Fallstudie, die in einer ärztlichen Praxis in Wien durchgeführt wurde, die zur Überwindung von Sprachbarrieren angewendeten Strategien. Die Studie beleuchtet den Alltag in der Praxis von Dr. Daniela Kasparek in Wien, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, die einen hohen Anteil an PatientInnen mit Migrationshintergrund (60% der Eltern) aufweist (vgl. Leitner 2013: 144). In ihrer Praxis stellte die Fachärztin eine häufig fehlende adherence seitens der PatientInnen fest, die auf Sprachbarrieren zurückzuführen war. Darüber hinaus waren nicht selten organisatorische Probleme zu bewältigen: Zu viele PatientInnen suchten die Ärztin in den Abendstunden auf, da ihre dolmetschenden Begleitpersonen meist erst zu dieser Tageszeit zur Verfügung standen. Als Lösungsstrategie wurden Organisationsgehilfinnen mit Migrationshintergrund angestellt, die jene Fremdsprachen beherrschten, die von den PatientInnen der Praxis am häufigsten gesprochen wurden. Für die niedergelassene Ärztin erwies sich die Anstellung mehrsprachiger AssistentInnen ohne Dolmetschausbildung, die als Laiendolmetschende fungierten, als kostengünstiger als die Heranziehung ausgebildeter DolmetscherInnen. In ihren Schlussfolgerungen hält Leitner fest, dass diese Lösungsstrategie zwar zufriedenstellender sei als der Einsatz von dolmetschenden Angehörigen, sie könne aber nicht die Arbeit ausgebildeter DolmetscherInnen ersetzen. Parmakerli (2009) berichtet von einem ähnlichen Beispiel aus Mannheim. Der türkischstämmige Arzt konnte bereits in seiner Kindheit und dann in seiner Studienzeit Dolmetscherfahrung sammeln. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums eröffnete er eine ärztliche Praxis in Mannheim, die er als „Migranten-Praxis“ (Parmakerli 2009: 160) bezeichnet, weil sie überwiegend von türkischsprachigen PatientInnen aufgesucht wird.2 Darüber hinaus ist das gesamte Team – bestehend aus einer Intensivkrankenschwester, einer Diätassistentin, einer Arzthelferin und einer Aushilfe – türkischer Herkunft. Dies ermöglicht eine kompetente Begleitung der ausländischen PatientInnen, für die auch „kultursensibel gedolmetscht“ (Parmakerli 2009: 162) wird. Wichtiger Entscheidungsfaktor für viele niedergelassene ÄrztInnen hinsichtlich der Konsultierung von ausgebildeten DolmetscherInnen bleiben aber nach wie vor deren hohe Kosten, die von den ÄrztInnen oder von den PatientInnen zu tragen wären (vgl. Leitner 2013: 154). Derzeit werden Dolmetschkosten in Deutschland und Österreich weder von gesetzlichen noch von privaten Krankenversicherungen übernommen (vgl. Spickhoff 2015: 14).
Zwei weitere Lösungsstrategien zur Überwindung von Sprachbarrieren in der medizinischen Kommunikation, die häufig umgesetzt werden, sind das Ferndolmetschen und die Verwendung des Englischen als Lingua Franca. In Tab. 5 werden diese Lösungsstrategien zusammengefasst.
| Dolmetschende Begleitpersonen der PatientInnen | Verwandte (auch Kinder), FreundInnen, Bekannte usw. |
| Dolmetschendes mehrsprachiges medizinisches Personal | ÄrztInnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger usw. |
| Dolmetschendes mehrsprachiges nicht medizinisches Personal | Reinigungspersonal, Küchenpersonal usw. |
| DolmetscherInnen vor Ort | Angestellte oder selbstständig tätige DolmetscherInnen |
| DolmetscherInnen aus der Ferne | Angestellte oder selbstständig tätige DolmetscherInnen |
| Lingua Franca | Alle Gesprächsbeteiligten bedienen sich einer Lingua Franca (häufig Englisch) |
Tab. 5:
Lösungsstrategien zur Überwindung von Sprachbarrieren im Gesundheitswesen
Die Vor- und Nachteile der oben dargestellten Möglichkeiten werden in der medizinischen Literatur zur Kommunikation mit fremdsprachigen PatientInnen immer wieder thematisiert (vgl. u.a. Bischoff/Loutan 2004, Hoefert 2008, Bischoff/Hudelson 2010, Kaelin et al. 2013, Spickhoff 2015), wobei häufig Kostengründe und rechtliche Grundlagen im Vordergrund stehen. Hoefert (2008: 105ff.) argumentiert, dass der Einsatz von Begleitpersonen der PatientInnen als Dolmetschende als vorteilhaft zu sehen sei, da sie leicht verfügbar sind und mit den PatientInnen den kulturellen Hintergrund sowie die Kenntnis der Krankenbiografie teilen. Als nachteilig erweisen sich aber deren fehlendes medizinisches Know-how, etwaige Scham und ihr Involviertsein. Diese Einschränkungen oder Probleme aufgrund einer Dolmetschung durch Angehörige können dazu führen, dass gewisse Nachrichten abgeschwächt oder überhaupt nicht übermittelt werden. Das mehrsprachige medizinische Personal ist ebenso leicht verfügbar, verursacht keine zusätzlichen Kosten und besitzt das nötige medizinische Know-how. Allerdings ergibt sich für diese Personen, falls sie als Dolmetschende eingesetzt werden, ein Mehraufwand, und es kann sogar zu Loyalitätskonflikten zwischen dem dolmetschenden Personal, das mit den Landsleuten sympathisiert, und dem Krankenhaus als Arbeitsgeber kommen. Das nicht medizinische Personal ist laut Hoefert ebenso kostenneutral, verfügt allerdings weder über medizinisches Know-how, noch ist es stets loyal und in der Lage, die vollständige Wiedergabe des Gesagten zu gewährleisten. Obwohl der Einsatz von Begleitpersonen und nicht medizinischem Personal für den Aufbau einer Beziehung zwischen ÄrztInnen und PatientInnen hilfreich sein kann, bleiben in beiden Szenarien die Probleme der Unparteilichkeit und der fehlenden Koordinationskompetenz der Kommunikation ungelöst. Neben Pöchhackers Studie (2000a) belegen weitere Untersuchungen (vgl. u.a. Kadrić/Pöchhacker 1999, Pöchhacker 2000b, Bührig/Meyer 2004, Valero-Garcés 2007, Menz et al. 2013), dass Menschen ohne formale Dolmetschausbildung Inhalt und Handlung der ÄrztInnen-PatientInnen-Kommunikation erheblich beeinflussen; dies betrifft sowohl Begleitpersonen als auch medizinisches und nicht medizinisches Personal.
Ausgebildete DolmetscherInnen werden von Hoefert zwar als neutral, genau und pünktlich beschrieben, allerdings erweisen sich die durch sie entstehenden hohen Kosten als problematisch. Hoefert (2008: 125) und Reisewitz (2015: 3) führen als weitere Schwierigkeit das Beispiel von DolmetscherInnen an, die das notwendige Fachvokabular – d.h., die terminologische Kompetenz – nicht hinreichend beherrschen.3 Ebenso scheinen manche MedizintourismusexpertInnen wie Bialk-Wolf et al. (2017: 77) die Vorteile der von ausgebildeten DolmetscherInnen vermittelten Kommunikation nicht zur Gänze zu verstehen und heben neben dem hohen finanziellen Aufwand auch deren angeblich mangelnde Sachkompetenz hervor. Neben den Kosten und der Kompetenzfrage können die Verfügbarkeit und die Wahrnehmung der Dolmetschqualität weitere Kriterien bei der Wahl einer dolmetschenden Person darstellen. In ihrer Studie zur Verständigung mit anderssprachigen PatientInnen in den Genfer Universitätskrankenhäusern betonen Bischoff und Hudelson (2010: 18), dass das zweisprachige medizinische Personal in der Regel sofort verfügbar ist. Ausgebildete DolmetscherInnen würden erst dann beauftragt, wenn andere Lösungsstrategien (Dolmetschung durch Angehörige, nicht medizinisches oder medizinisches Krankenhauspersonal) fehlgeschlagen sind. Auch Bischoff und Hudelson weisen darauf hin, dass der Einsatz von zweisprachigem medizinischen Personal trotz der sofortigen Verfügbarkeit kritisch zu hinterfragen ist, da es für die Dauer der Dolmetschzeit seiner eigentlichen Tätigkeit nicht nachgehen kann (vgl. Bischoff/Hudelson 2010: 18). Des Weiteren sollten die Kosten für dessen Weiterbildung berücksichtigt werden, damit die erbrachte Dolmetschleistung bestimmte Qualitätskriterien erfüllt.
Eine alternative Lösungsstrategie ist das Ferndolmetschen (vgl. u.a. Braun 2015, Brunson 2015, Havelka 2017, Angelelli 2019). Das Ferndolmetschen wird meistens in Form von Telefondolmetschen oder Videodolmetschen realisiert. Beim Ferndolmetschen nehmen die DolmetscherInnen nicht persönlich an der Kommunikation teil: Sie befinden sich entweder bei einer/einem der Gesprächsbeteiligten oder sind räumlich komplett von den Gesprächsbeteiligten getrennt. Da sich nicht alle Kommunikationsbeteiligten am selben Ort aufhalten, fehlt den DolmetscherInnen der „Überblick“ über die Situation. Besonders im Rahmen des Telefondolmetschens erschwert die fehlende visuelle Komponente die Gesprächskoordination. Weitere Faktoren, die die Verdolmetschung (negativ) beeinflussen können, sind unzuverlässige Technologien und ein „lack of interpersonal clues“ (Tipton/Furmanek 2016: 144). Das Videodolmetschen kompensiert zwar teilweise den „lack of interpersonal clues“ sowie die physische Distanz, dennoch stellt das Bild, das die DolmetscherInnen wahrnehmen, nur einen Ausschnitt des gesamten Geschehens dar (vgl. Havelka 2017: 122). Die Verwendung des Ferndolmetschens als Lösung zur Überwindung von Sprachbarrieren ist aus wirtschaftlicher Sicht besonders effizient (vgl. Braun 2015: 347ff., Tipton/Furmanek 2016: 143ff.), da die Kommunikation zwischen ÄrztInnen und PatientInnen wie üblich stattfinden kann, während DolmetscherInnen z.B. mittels Videokommunikation die Gespräche verdolmetschen. In einigen Fällen sind die eingesetzten DolmetscherInnen Angestellte der medizinischen Einrichtungen (vgl. Angelelli 2019: 71), in anderen Fällen arbeiten sie entweder als angestelltes oder freiberufliches Personal eines externen Unternehmens, das Ferndolmetschdienste anbietet. Locatis et al. (2010) stellen fest, dass Ferndolmetschen generell mehr Akzeptanz bei PatientInnen und ÄrztInnen als bei ausgebildeten DolmetscherInnen findet; letztere bevorzugen eher die physische Präsenz.4 Brunson (2015) weist darüber hinaus darauf hin, dass die schnelle Verfügbarkeit der eingesetzten DolmetscherInnen von den medizinischen Einrichtungen sehr geschätzt wird.
Eine weitere Lösung zur Überbrückung von Sprachbarrieren in der medizinischen Kommunikation bietet die Verwendung von Englisch als Lingua Franca. Die Sinnhaftigkeit dieser Lösung hängt allerdings überwiegend von den Sprachkenntnissen aller im Gespräch beteiligten Menschen ab. PatientInnen sind nicht immer in der Lage, den ÄrztInnen die benötigten Informationen auf Englisch zu vermitteln, was in der Folge zu einer Fehldiagnose oder zu einer falschen Behandlung führen kann (vgl. Crezee 2013: 13f.). In ihrer Untersuchung der Anforderungen und interkulturellen Erfahrungen bei der Behandlung medizintouristischer PatientInnen zeigen Bialk-Wolf et al. (2017: 71ff.), dass die Verwendung von Englisch als Lingua Franca keine geeignete Lösung bietet, da keine/keiner der beteiligten AkteurInnen über einen ausreichenden Wortschatz verfügt, um sich angemessen auf Englisch auszudrücken. Der Erfolg der medizinischen Behandlung hängt aber von einer einwandfreien Verständigung ab, die nur auf der Basis einer von interkultureller Kompetenz, Sprachkompetenz und Empathie getragenen Kommunikation gewährleistet werden kann (vgl. Bialk-Wolf et al. 2017: 92).
In der Diskussion über Sprachbarrieren oft außer Acht gelassen, aber zentral für Krankenhäuser und das medizinische Personal ist die rechtliche Frage, „wer das Risiko zu tragen hat, wenn es zu einem Schaden kommt und wer verantwortlich dafür ist, dass ein Dolmetscher herangezogen werden muss“ (Kletečka-Pulker 2013: 46). Aus rechtlicher Sicht ist es notwendig, dass die PatientInnen vor einer Behandlung aufgeklärt werden, damit sie ihre Einwilligung zu dieser Behandlung geben können. Um dies zu gewährleisten, müssen sich alle am medizinischen Gespräch beteiligten Personen verständigen können – das bloße Aushändigen von schriftlichen Unterlagen kann nicht als ausreichend betrachtet werden. Das Aufklärungsrecht sowie die Aufklärungspflicht sind immer gültig, außer bei medizinischen Notfällen (vgl. Spickhoff 2010: 65). Werden die PatientInnen nicht oder nicht ausreichend aufgeklärt, wird deren Einwilligung zur Behandlung unwirksam, und die behandelnden ÄrztInnen tragen die rechtlichen Folgen (vgl. Kletečka-Pulker 2013: 45). Aus diesem Grund müssen die behandelnden ÄrztInnen feststellen, ob die PatientInnen sich mit ihnen ausreichend verständigen können, bevor sie mit ihnen den Behandlungsvertrag abschließen. Sprachbarrieren können ebenso die anschließende Behandlung beeinträchtigen, denn auch für diese benötigen ÄrztInnen bestimmte Informationen vonseiten der PatientInnen (vgl. Spickhoff 2010: 66). ÄrztInnen tragen immer die Beweislast, ob die PatientInnen die Erklärungen, die auf Deutsch vorgetragen wurden, verstanden haben, und ob sie die notwendigen Angaben machen konnten. Die sprachliche Situation wird allerdings nicht immer richtig eingeschätzt, denn in manchen Fällen schaffen es PatientInnen mit geringen Deutschkenntnissen, dem medizinischen Personal gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass ihre Sprachkenntnisse für eine erfolgreiche Kommunikation ausreichen (vgl. Bührig/Meyer 2015: 303). Ergeben sich Behandlungsfehler oder Schäden durch Sprachbarrieren, muss überprüft werden, ob diese hätten vermieden werden können (Kletečka-Pulker 2013: 54). Das Aufklären der PatientInnen kann auch anderen ÄrztInnen überlassen werden, doch tragen die delegierenden ÄrztInnen Anleitungs- und Aufsichtspflichten (vgl. Kletečka-Pulker 2013: 65). Grundsätzlich ist dem nicht medizinischen Personal das eigenständige Aufklären nicht gestattet. Ein für medizintouristische Settings rechtlich relevanter Aspekt ist die Zuständigkeit eines ausländischen Gerichtes in den Fällen, in denen die Aufklärung einer/eines ihrer BürgerInnen in einem anderen Land nicht ausreichend war und aufgrund dessen eine Gesundheitsschädigung entstanden ist (vgl. Spickhoff 2010: 60). Der Zusammenhang zwischen Sprachbarrieren und der Wahrscheinlichkeit medizinischer Fehler wird auch von Wasserman et al. (2014: 2) thematisiert. Zu den möglichen Fehlerquellen zählen sie u.a. die Verwendung nicht qualifizierter Dolmetschender (Personen aus dem Familien- und Freundeskreis) und das Zurückgreifen auf medizinisches Personal, das nur über begrenzte Kenntnisse der Sprache der PatientInnen verfügt. Die AutorInnen der Studie weisen auf die Notwendigkeit hin, die Überwindung von Sprachbarrieren aus Sicht des Risikomanagements und weniger aus einem humanitären Blickwinkel zu betrachten.
Das Gesetz schreibt in Österreich nicht vor, dass nur ausgebildete DolmetscherInnen beim Aufklärungsgespräch dolmetschen dürfen. Haftungsrechtlich gilt es allerdings zu klären, wer die dolmetschende Person beauftragt hat (vgl. Kletečka-Pulker 2013: 66ff.). Ist das Krankenhaus der Auftraggeber, dann „ist ein etwaiges Fehlverhalten des Dolmetschers dem Träger der Krankenanstalt gem. § 1313a ABGB zurechenbar“ (Kletečka-Pulker 2013: 69). Um die Möglichkeit eines Regresses in Anspruch zu nehmen, muss bestimmt werden, ob die dolmetschende Person vom Krankenhaus beauftragt wurde, und ob das Fehlverhalten durch Fahrlässigkeit oder vorsätzlich erfolgte. Wenn externe DolmetscherInnen beauftragt werden, entscheidet die vertragliche Vereinbarung, ob ein Regress möglich ist. Dolmetschen MitarbeiterInnen des Krankenhauses, muss berücksichtigt werden, dass ihr Arbeitsauftrag arbeitsrechtlich nicht die Dolmetschleistung umfasst. Im Fall eines Schadens würde eine bestehende Versicherung diesen nicht decken, da die dolmetschende Person keine geeignete Ausbildung aufweist (vgl. Kletečka-Pulker 2013: 65ff.). „Dies ändert an dem Umstand nichts, dass diese Personen auch als Erfüllungsgehilfen gem. §1313a ABGB dem Träger der Krankenanstalt zuzurechnen sind“ (Kletečka-Pulker 2013: 69). Werden dolmetschende Begleitpersonen eingesetzt, „darf der Arzt auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung vertrauen, soweit aufgrund der Reaktion des Patienten nicht das Gegenteil offenkundig wird“ (Kletečka-Pulker 2013: 63). Wenn ÄrztInnen bemerken, dass die dolmetschende Person selbstständig antwortet, ohne die Frage weiterzuleiten, oder dass die Dolmetschzeit viel kürzer als die Redezeit auffällt, sollte davon ausgegangen werden, dass die Dolmetschung nicht korrekt oder unvollständig ist.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die gängigsten Lösungsstrategien zur Überwindung von Sprachbarrieren wie der Einsatz einer Lingua Franca und das Dolmetschen durch Angehörige bzw. durch medizinisches und nicht medizinisches Personal nicht ausreichend sind, um PatientInnen- und ÄrztInnensicherheit zu gewährleisten. Die Förderung einer Translationskultur in den Krankenhäusern (vgl. Pöchhacker 2000a, Bührig/Meyer 2015: 303), durch die eine strategische und reflektierte Überwindung der Sprachbarrieren erfolgen kann, ist in allen medizinischen Settings notwendig.