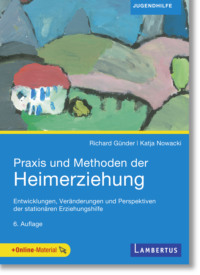Kitabı oku: «Praxis und Methoden der Heimerziehung», sayfa 7
Sozialdatenschutz
Grundsätzlich ist die Praxis der Hilfen zur Erziehung auf Kooperation und Vertraulichkeit mit Familien und Minderjährigen angelegt, die solche Leistungen erhalten. Entsprechend gelten die strengen Vorschriften des Sozialdatenschutzes für die Mitarbeiter*innen freier Träger ebenso wie im öffentlichen Trägerbereich. Soziale Daten und Tatbestände, die im Rahmen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen bekannt und gesammelt werden, dürfen nur mit dem Einverständnis der Betroffenen weitergegeben werden (§ 65 KJHG). Auch betroffene Minderjährige, die über eine entsprechende Einsicht verfügen, müssen vor der Offenbarung ihrer Sozialdaten um ihre Einwilligung gefragt werden (Frankfurter Kommentar 2019, S. 791 ff.). Eine Weitergabe von geschützten Sozialdaten kann beispielsweise bei Hilfeplangesprächen fachlich notwendig sein. Entsprechend der Sozialdatenschutzvorschriften müssen daher die Betroffenen über die Teilnehmer*innen eines Hilfeplangesprächs im Vorhinein informiert werden, damit sie ihre Ablehnung oder Zustimmung äußern können. Bei der Weitergabe von Berichten zwischen öffentlichem und freiem Träger müssen die Vorschriften des Datenschutzes nach §§ 61 ff. SGB VIII genau geprüft werden. Insbesondere die Einwilligung der Betroffenen ist hierbei eine wesentliche Voraussetzung, ein weiterer Rechtfertigungsgrund ist die Gefährdung des Kindeswohls und die Anweisung durch das Familiengericht (s. § 65 SGB VIII).
Betroffenenbeteiligung bei der Hilfeauswahl
Im Gegensatz zum alten JWG, in dem Jugendhilfemaßnahmen überwiegend als Eingriffsmaßnahmen galten, die mehr oder weniger „von oben“ angeordnet wurden, geht das KJHG von Leistungen aus, welche in partnerschaftlicher Kooperation mit den Betroffenen zu klären, abzuwägen und abzustimmen sind. Diese grundsätzlich neue und verbindliche Leitidee findet ihren Niederschlag an verschiedenen Stellen des KJHG: Nach § 5 KJHG haben die Leistungsberechtigten, in der Regel also die Eltern, ein Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Einrichtungen und Dienste verschiedener Träger und bezüglich der Gestaltung der Hilfe. Auf dieses Recht müssen die Betroffenen ausdrücklich hingewiesen werden. Das Wunsch- und Wahlrecht findet dann seine Begrenzung, wenn es mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre. In § 8 KJHG wird geregelt, dass Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind. Gemäß ihrem Entwicklungsstand sind ihre Vorstellungen, Meinungen, Ängste und Wünsche ernst zu nehmen, es soll nicht über sie entschieden werden, sondern in partnerschaftlicher Abwägung sollen gemeinsam zu akzeptierende Lösungen und Perspektiven entwickelt werden.
Nach § 36 KJHG sind die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten, wobei auf mögliche Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen ist.
Wenn Hilfe für einen voraussichtlich längeren Zeitraum zu leisten ist, soll in Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten und im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte (also im Team) über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart entschieden werden. Dies gilt insbesondere bei Erziehungshilfen, die außerhalb der eigenen Familie stattfinden, so z. B. bei der Heimerziehung.
Partizipation von Kindern und Jugendlichen im gesamten Hilfeprozess
Jugendhilfe kann im eigentlichen Sinne nur dann lebenswelt- und ressourcenorientiert sein, wenn die aktive Beteiligung – die Partizipation – der betroffenen jungen Menschen nicht nur gefordert, sondern innerhalb der Praxis systematisch und kontinuierlich realisiert wird.
In den Hilfen zur Erziehung ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zwar gesetzlich normiert, die praktizierte Wirklichkeit des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zeigt allerdings auf, dass trotz der eindeutigen gesetzlichen Regelungen eine erhebliche Diskrepanz zwischen Forderungen und der Beachtung sowie der Realisierung einer Partizipation besteht. Verschiedene empirische Studien zur Betroffenenbeteiligung im Rahmen der Hilfeplanung belegen jeweils äußerst geringe Quoten der Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen am Hilfeplanungsprozess. In einer Befragung von Kindern und Jugendlichen zu ihrer Aufnahme in eine Einrichtung der stationären Erziehungshilfe beschrieben viele Kinder und Jugendliche ein Gefühl der Hilflosigkeit, da sie sich nicht genügend in den Prozess der Entscheidung über die Hilfe einbezogen fühlten. Ihnen fehlten nach ihren Aussagen sogar genügend Informationen zum Hintergrund und Ziel der Unterbringung (Nowacki/Remiorz, 2014, S. 127).
Eine deutliche Erhöhung der Beteiligungsquote wäre alleine nicht ausreichend, wenn die Fachkräfte nicht Haltungen einnehmen und für Rahmenbedingungen sorgen, welche die echte innere Beteiligung eines betroffenen jungen Menschen in vielen Fällen erst ermöglicht. Alles andere wäre nur eine Quasi-Beteiligung oder anders ausgedrückt, eine Alibi-Funktion.
„Für die Kinder- und Jugendhilfe gelten Mitwirkung und Aushandlung als zentrale Maximen. Kinder- und Jugendhilfe hat einen (Einmischungs-)Auftrag, offensiv darauf Einfluss zu nehmen, dass die Beteiligung und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden Bereichen ermöglicht werden“ (Rätz-Heinisch/Schröer/Wolff 2014, S. 275).
Die formal abgesicherten Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte von jungen Menschen, die in den Institutionen der stationären Erziehungshilfe leben, sind eher gering. Wo Kinder, Jugendliche und ihre Eltern auf professionelle Fachkräfte treffen, ist eine Beteiligung auf Augenhöhe eher schwierig (Stork 2017, S. 48). Die Gefahr besteht, dass Fachkräfte die Haltung haben, sie wüssten schon, was für die Kinder und Jugendlichen das Beste sei. Beteiligungen der jungen Menschen sind dann zwar auch anzutreffen, aber diese nehmen eher einen gelegentlichen, zufälligen oder auch vom zeitweisen Wohlwollen der Erwachsenen geprägten Charakter ein. Systematisch zugestandene und auch formal abgesicherte Möglichkeiten und Wege der Partizipation sind unter solchen Verhältnissen nicht anzutreffen.
Für die stationäre Erziehungshilfe ist die Partizipation ein wichtiges Element, da es eine zentrale Grundlage demokratischer Strukturen auch in der Sozialen Arbeit darstellt (Stork 2017, S. 46) und damit auch für das Erleben der Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen ein wesentliches Mittel ist.
Im Zuge der Skandalisierung der Heimerziehung und der sich daraus ableitenden ersten Reformen wurden Instanzen der Partizipation in der Heimerziehung durchaus verwirklicht: In verschiedenen Institutionen bildeten sich beispielsweise Heimräte, es wurden Vollversammlungen einberufen und Gruppen- sprecher*innen gewählt. Die nachhaltigen Reformen und Strukturveränderungen der Heime, die Dezentralisation großer Einrichtungen und die allgemeine liberalere Erziehungspraxis haben solche Instrumentarien der Partizipation zumeist überholt und vergessen lassen. Heimräte oder Gruppensprecher*innen verdeutlichen sehr das Negativbild von Institutionen und es ist zu hinterfragen, ob solche oder andere Mitbeteiligungswege in heute durchweg reformierten und vor allem in kleineren Institutionen überhaupt noch notwendig sind. Kommt es nicht mehr und vor allem auf die Haltungen der pädagogischen Mitarbeiter*innen an, welche die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen wie selbstverständlich akzeptieren und fördern müssen? Andererseits gilt zu bedenken, dass demokratische Errungenschaften – gleich in welchem Bereich – keine Selbstläufer sind. Sie wurden immer mühsam erkämpft; es besteht immer die Gefahr, dass sie schnell beseitigt werden. Klar strukturierte und auch schriftliche fixierte Wege der Partizipation können das Selbstverständnis dieser Errungenschaften verfestigen.
„Beteiligung kann darüber hinaus in den Hintergrund geraten, wenn pädagogische Fachkräfte Machtansprüche nicht aufgeben wollen oder können bzw. wenn Konkurrenzen die Zusammenarbeit stören. Aufseiten der betroffenen Kinder, Jugendlichen oder Eltern kann die Mitwirkungsbereitschaft eingeschränkt sein, wenn sie die Abläufe nicht verstehen und einschätzen können bzw. wenn sie verunsichert oder zu wenig informiert sind“ (Rätz-Heinisch/Schröer/Wolff 2009, S. 230).
Die moderne Heimerziehung gibt gegenwärtig vor, lebensweltorientiert zu sein und die Ressourcen der betroffenen jungen Menschen zu nutzen. Dies setzt unter anderem die aktive Beteiligung nicht nur als gelegentliche zugestandene Möglichkeit, sondern als festgelegtes Grundprinzip voraus. Beispiele solcher festgelegten Beteiligungsrechte, die kontinuierlich überprüft und nachgewiesen werden müssen, könnten sein:
•Kinder und Jugendliche haben Mitspracherechte bei den Gruppenregeln, sie können diese hinterfragen und Änderungen verlangen.
•Bei Urlaubsfahrten sind die jungen Menschen die Hauptbetroffenen. Ihre Vorschläge und Wünsche sind richtungsweisend, „altbewährte“ Urlaubsziele der Gruppe können abgelehnt werden.
•Beim Kauf neuer Möbel wird nicht über den Kopf der Kinder und Jugendlichen hinweg entschieden. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten haben diese immer ein Mitentscheidungsrecht.
•Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen ist regelmäßig die Meinung der Kinder und Jugendlichen einzuholen, ihr Votum kann ausschlaggebend sein.
•Über voraussehbare Neuaufnahmen sollten die Kinder und Jugendlichen informiert werden, ihre Meinung ist wichtig bei der Entscheidung, ob ein bestimmtes neues Kind in der gegenwärtigen Situation in die Gruppe passt.
Die Partizipation von jungen Menschen in stationären Jugendhilfeeinrichtungen wurde auch vom neuen Bundeskinderschutzgesetz berücksichtigt und im Sozialgesetzbuch VIII stärker implementiert. Geregelt wurde beispielsweise das Verfahren der Beteiligung von Minderjährigen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie das Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten (§ 8b SGB VIII). Letzterem kann in der Heimerziehung mit der Implementierung von Ombudsfrauen oder Ombudsmännern Rechnung getragen werden (Meysen/Eschelbach 2012, S. 170). 2012 wurde ebenfalls in § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII aufgenommen, dass für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine (teil-)stationäre Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe „zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden“ müssen. Die gesetzliche Grundlage für Beteiligungsprozesse ist damit klar geschaffen worden. Inhaltlich muss sie aber auch konsequent umgesetzt werden.
„Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe vollzieht sich selten von alleine, sie muss gewollt sein. Die Aufgabe der Wahrnehmung und Erschließung von Teilnahmechancen und Teilgabepotenzialen liegt bei den Fachkräften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass beteiligende Beratung erst gelingen kann, wenn die Fachkräfte an der Basis hierfür Rückendeckung von den Führungskräften sozialer Institutionen erhalten“ (Rieger 2013, S. 33).
Hilfeplanung
Die gemeinsame Planung und Abstimmung der erforderlichen und zu leistenden Hilfe unterstreicht den Kooperationsgrundsatz im Umgang mit und in der Leistung von erzieherischen Hilfen. Wenn Hilfe voraussichtlich über einen längeren Zeitraum zu leisten ist, soll die Hilfeplanung unter Hinzuziehung mehrerer Fachkräfte und mit partnerschaftlicher Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie der Minderjährigen ablaufen. Unter erzieherischen Hilfen, die voraussichtlich für einen längeren Zeitraum geleistet werden, sind insbesondere auch Erziehungshilfen zu verstehen, die außerhalb der eigenen Familie stattfinden, also beispielsweise in einer Vollzeitpflegestelle oder im Rahmen der Heimerziehung. Für diesen Personenkreis sieht das KJHG (§ 37) eine besonders intensive Zusammenarbeit von Pflegepersonen, den Gruppenerzieher*innen eines Heimes, von gruppenübergreifenden Diensten, den zuständigen Fachkräften des Jugendamtes und anderen professionellen Kräften vor, welche die jeweilige Situation des jungen Menschen gut kennen und beurteilen können. Die Personensorgeberechtigten und die Kinder/Jugendlichen sind an diesem Hilfeplanungsprozess integrativ beteiligt. Betroffene und Fachkräfte sollen in gemeinsamer Abstimmung die bisherige erzieherische Hilfe bewerten, neue pädagogische Notwendigkeiten und Ziele formulieren und Lebensperspektiven herausbilden.
Eine solche Hilfeplanung wird in etwa folgenden Schritten ablaufen: Nachdem sich die Personensorgeberechtigten (Eltern) und/oder Minderjährigen mit ihren speziellen Problemen und Hilfebedürfnissen an das Jugendamt gewandt haben, kommt es zunächst zu einem Beratungsgespräch, in welchem der/die zuständige Sozialarbeiter*in umfangreich berät und Vorteile und Nachteile der eventuellen Hilfe offenlegt. Wird die Gewährung einer Hilfe für notwendig gehalten und sind sich alle Beteiligten über Form und Ausgestaltung der Hilfe einig, so kommt es in einem nächsten Schritt zu einem Hilfeplanprozess.
Dieser Hilfeplanprozess besteht in der Regel aus zwei Teilen: dem Fachgespräch und dem Hilfeplangespräch. Am Fachgespräch oder der Expert*innenrunde nehmen die zuständige Fachkraft des Jugendamtes teil und in der Regel weitere Kolleg*innen von öffentlichen oder freien Trägern der Jugendhilfe. Hinzugezogen werden sollen auch Vertreter*innen anderer Fachdienste oder Spezialdienste, so z. B. Psycholog*innen, Ärzt*innen und Lehrer*innen. Nachdem im Fachgespräch eine umfassende Darstellung des individuellen Falles erfolgte und Vorgeschichte, sowie mögliche Ursachen erörtert wurden, beginnt eine Diskussion über mögliche Interventionen.
Bei dem nun folgenden Hilfeplangespräch sind die Eltern und Minderjährigen in jedem Fall zu beteiligen und weitere Vertrauenspersonen können auf Wunsch hinzugezogen werden (z. B. Freund*innen, Verwandte). Insbesondere Entscheidungen über Art und Umfang der zu leistenden Erziehungshilfe sollen von allen Beteiligten mitgetragen werden können und es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen und das Lebensumfeld der Eltern und des Kindes angemessen berücksichtigt werden. Auch haben die Hilfeempfänger*innen ein Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf konkrete Einrichtungen und Träger, dem nachgekommen werden muss, wenn keine erheblichen Mehrkosten dadurch entstehen. In der Praxis sind hier ebenfalls praktische Fragen z. B. der jeweils aktuellen Platzkapazität zu berücksichtigen. Die Erziehungshilfe soll außerdem so angelegt sein, dass sie letztlich Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet.
Der Prozess der Hilfeplanung unterscheidet sich nicht nur im äußeren Ablauf von früheren Formen der Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung von Betroffenen. Fundamental gewandelt sollte sich deren Stellung haben, wenn sie erzieherische Leistungen beanspruchen wollen. Früher waren sie Angehörige aus Problemfamilien, Versager und Bittsteller, denen Hilfen angedroht, verordnet oder mildtätig gewährt werden konnten. Heute sollten betroffene Eltern, Kinder und Jugendliche ernstzunehmende Partner*innen sein, ohne deren Zustimmung und Mitwirkung keine erzieherische Hilfe zu leisten wäre, denn bis an die Grenze „der Kindeswohlgefährdung sind Fachkräfte … auf deren Einverständnis angewiesen“ (Urban 2005, S. 236).
Auch traditionelle Bewertungsmaßstäbe und -verfahren verlieren in einem gemeinsamen und partnerschaftlichen Prozess der Hilfeplanung ihre Bedeutung. Waren Betroffene früher in oft völliger Abhängigkeit von fremdbestimmenden psychosozialen Diagnosen durch außenstehende Expert*innen, sollten sie jetzt aktive Teilnehmer*innen in einem Aushandlungsprozess sein. Die Einschätzung eines jeweiligen Ist-Zustandes können sie im Hilfeplan nun selbst wesentlich mitbestimmen, sie können widersprechen, andere Ansichten und Erklärungen fördern und so zu gemeinsam erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten und zu Perspektivfindungen gelangen, die sie als Betroffene mittragen und akzeptieren können, weil sie selbst mitentschieden haben und nicht über sie entschieden wurde.
Die Vorgehensweise im Prozess der Hilfeplanung wird allerdings in Fachkreisen häufig kritisiert, weil sie eine an der Mittelschicht orientierte Kommunikation voraussetze.
„Für die klassische Klientel der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dieses Verfahren eine permanente Überforderung. Nimmt man diesen Einwand ernst, gerät man schnell in die Gefahr, zur ‚fürsorglichen Belagerung’ zurückzukehren – eine Sichtweise, die nur schwer mit den Grundwerten des Grundgesetzes, aber auch mit dem Gedanken der Koproduktion personenbezogener Dienstleistungen verbunden ist“ (Wiesner 2005, S. 20).
Der Hilfeplanprozess erfordert daher von den Fachkräften eine hohe Professionalität verbunden mit der Fähigkeit zur Empathie und fachlichen Reflexivität. Dies sind entscheidende Voraussetzungen für eine positive Verständigung aller beteiligten Personen (Marquard 2008, S. 167).
„Die Beteiligungsfähigkeit von Eltern und Kindern ist in hohem Maße abhängig von der sozialen Kompetenz der zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, von der Wertschätzung, die sie Hilfe ersuchenden Personen entgegenbringen, von der Fähigkeit, nonverbales Verhalten zu deuten sowie Eltern und Kinder zu motivieren und zu ermutigen“ (Wiesner 2005, S. 20).
Heimerziehung sowie die Betreuung in sonstigen Wohnformen ist eine Form der Erziehungshilfe, die in der Regel langfristig angelegt ist. Ausnahmen hiervon wären z. B. eine Notaufnahme, wenn der betroffene junge Mensch nach schneller Beseitigung des Notzustandes kurzfristig wieder in seine Familie zurückkehren kann oder die ebenfalls nur für kurze Dauer geplante Aufnahme eines Kindes in ein Heim mit dem Ziel einer Vermittlung in eine Pflegefamilie, einschließlich der entsprechenden Vorbereitung. Ansonsten wird Erziehungshilfe in einer stationären Einrichtung durchweg für mindestens ein Jahr gewährt, mit der Möglichkeit der Verlängerung. So verbleiben viele Kinder und Jugendliche für zwei oder auch drei Jahre in einem Heim oder in einer Wohngruppe, andere noch länger, möglicherweise bis zu ihrer Verselbstständigung, wenn gegen die Rückkehr in die Herkunftsfamilie mannigfaltige Gründe sprechen.
Heimerziehung wurde und wird von Außenstehenden häufig als Schicksalsschlag angesehen, als eine fremdbestimmte Maßnahme, die über Betroffene hereinbricht. Nach der Gesetzeslage ist die Hilfe zur Erziehung in einem Heim jedoch ein planbarer und mit allen Betroffenen abgesprochener Prozess. Wie schon zuvor in den Ausführungen zur Hilfeplanung erwähnt, ist in § 37 KJHG festgelegt, dass die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der/die Jugendliche vor Inanspruchnahme einer Hilfe zur Erziehung ausführlich zu beraten sind, insbesondere, wenn die Hilfe für einen voraussichtlich längeren Zeitraum zu leisten ist. In solchen Beratungsgesprächen werden natürlich von den Fachkräften und den Betroffenen auch Alternativen zur stationären Unterbringung überprüft, vor allem auch ambulante Hilfen zur Erziehung. Nur in seltenen Fällen kann zwischen den Personensorgeberechtigten, dem Kind/Jugendlichen und den Fachkräften keine Einigung über die notwendige Hilfe erzielt werden. Wenn das Jugendamt die Unterbringung in einer stationären Einrichtung zum Wohl und/oder zum Schutz des Kindes als unabdingbar notwendig ansieht, dies aber die Eltern verweigern, müsste ein Entzug der elterlichen Sorge beim Familiengericht beantragt werden. Wird diesem Antrag vom Gericht zugestimmt, kann der bestellte Pfleger (z. B. der Amtsvormund) die Hilfe zur Erziehung in einem Heim für das Kind in Anspruch nehmen. In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle ist ein solcher Sorgerechtsentzug allerdings nicht notwendig, weil alle Beteiligten sich äußern können und das Jugendamt die Meinung und Wünsche der Betroffenen ernst nimmt.
Während der Unterbringung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll nach § 36 im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und zusammen mit den Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen regelmäßig ein Hilfeplan erstellt werden. Das in diesem Zusammenhang bedeutsame Hilfeplangespräch soll im Schnitt alle sechs Monate stattfinden und bietet explizit Raum für Partizipation der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien. Teilnehmende sind u. a. die Kinder bzw. Jugendlichen, die Personensorgeberechtigten, also in den meisten Fällen die Eltern oder auch ein (Amts-)vormund, die zuständige Fachkraft des Jugendamtes, die Gruppenerzieher*innen und evtl. die gruppenübergreifenden Dienste bzw. Leitungen sowie weitere Personen, die für die Hilfeplanung wichtig sind (z. B. Vertrauenspersonen der Kinder und Jugendlichen, Lehrer*innen, Therapeut*innen o. ä.). Inhalte von Hilfeplanungsgesprächen können beispielsweise sein:
•Der Entwicklungsstand, Entwicklungsfortschritte des Kindes oder Jugendlichen,
•besondere Ereignisse und Vorkommnisse,
•der Einbezug der Eltern und der Familie,
•Veränderungen in der Herkunftsfamilie,
•die Situation in der Schule oder Ausbildung,
•die Situation des jungen Menschen in der Gruppe,
•die Erörterung der Fragen nach der aktuellen und zukünftigen Erziehungsbedürftigkeit, ob es sinnvoll ist, die stationäre Hilfe fortzusetzen, ob alternative Hilfen angebrachter wären oder ob eine Rückführung in die Familie kurz- oder mittelfristig angestrebt werden kann,
•die Perspektiven des Kindes/Jugendlichen und die seiner Familie.
Wie zuvor bereits angeführt, wurden bislang Beteiligungsprozesse oftmals nicht zufriedenstellend realisiert. Vielfach ist es betroffenen Kindern und Jugendlichen völlig unklar, welche Funktion und Bedeutung ein Hilfeplangespräch hat, die Tragweite von hier getroffenen Entscheidungen können dann von ihnen ebenfalls kaum eingeschätzt werden. Diese mangelnde Identifikation mit den im Hilfeplan festgeschriebenen Zielsetzungen dürfte ein wesentlicher Grund für das Scheitern von Hilfeprozessen sein (Pies/Schrapper 2005, S. 75). Um die Chancen der inhaltlichen Partizipation von Kindern und Jugendlichen beim Hilfeplanungsprozess zu erhöhen, schlägt Petersen verschiedene methodische Ablaufpunkte vor:
•Eine gute Vorbereitung der jungen Menschen auf das Hilfeplangespräch hin ist unerlässlich. Insbesondere müssen dessen Bedeutung – auch die von Entscheidungen –, der zeitliche Rahmen, die Funktion der beteiligten Fachkräfte sowie die anzusprechenden Themen geklärt werden.
•Die Qualität von Hilfeplangesprächen ist in hohem Maße von der Gesprächsatmosphäre abhängig. Kinder und Jugendliche sollten eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen können, die Gesprächsrunde darf nicht zu groß sein, denn sonst könnte sie den jungen Menschen einschüchtern, geradezu „erschlagen“.
•Die anschließende schriftliche Dokumentation des Hilfeplangesprächs sollte so formuliert sein, dass sie auch von Kindern und Jugendlichen verstanden werden kann, und selbstverständlich dürfen sie diese auch lesen (Petersen 2002, S. 920).
Außerdem sollte mit den Kindern und Jugendlichen und auch mit den Eltern überlegt werden, welches Setting für sie eine Beteiligung am besten ermöglicht. Hier können sehr individuelle Lösungen sinnvoll sein wie ein Ort, an dem diese sich wohlfühlen, die Beteiligung von gleichaltrigen Freund*innen, getrennte Gespräche mit den Beteiligten, damit konfliktäre Inhalte besser angesprochen werden können u. v. m. Hier sollten die Wünsche der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern handlungsleitend sein, damit eine individuell sinnvolle und erfolgreiche Hilfeplanung ermöglicht wird.