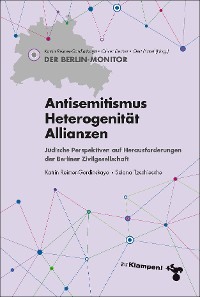Kitabı oku: «Antisemitismus – Heterogenität – Allianzen», sayfa 3
e) Aggressionen: Quellen, Qualitäten und Lebensbereiche
Antisemitische Aggressionen richten sich gegen Menschen, die von ihren Urheber*innen als jüdisch wahrgenommen werden, so dass auch nicht-jüdische Personen betroffen sein können. In diesem Abschnitt werden – bis auf eine Ausnahme und ein Beispiel – Erfahrungen jüdischer Betroffener sowie von Akteur*innen, die über ihre professionelle (oder ehrenamtliche) Funktion Kenntnis einer Vielzahl von Vorfällen haben, wiedergegeben.
Erlebt werden antisemitische Aggressionen in unterschiedlichen Qualitäten von (non-) verbalen Äußerungen bis hin zu tätlichen Angriffen. Solche Vorfälle ereignen sich in der Öffentlichkeit, im beruflichen und privaten Umfeld sowie in Institutionen und Einrichtungen der Stadt, also in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und sie speisen sich inhaltlich und personell betrachtet aus unterschiedlichen ideologischen und politisch-demografischen Quellen.
Der moderne Antisemitismus27 lässt sich „politisch weder allein ‚rechts‘ oder ‚links‘ […] verorten“ (Diner 2015, 273), er verbreitete sich weltweit und ist auch aktuell in unterschiedlichen politischen Lagern und Bevölkerungsgruppen Berlins virulent (vgl. Pickel et. al. 2019, 56 ff. und 118 ff.). Entsprechend nehmen die Gesprächspartner*innen unterschiedliche politisch-demografische Quellen wahr.
Erstens werden Pöbeleien, Angriffe oder Drohungen durch bspw. Hakenkreuz-Schmierereien von neonazistischer und (extrem) rechter Seite von den Betroffenen als erwartbar und wenig überraschend identifiziert. Und auch wenn die Gesprächspartner*innen sich nicht immer sicher sind, als was sie die Täter*innen angegriffen haben – als Jude*Jüdin oder bzw. auch als Migrant*in oder Linke*r –, erfahren sie als Jüdinnen*Juden Aspekte dieser Ereignisse doch als (potenziell) antisemitisch. Als Resultat der relativen Stärke des (extrem) rechten Spektrums wird von Gesprächspartner*innen zudem die Enttabuisierung der öffentlichen Äußerung antisemitischer Ressentiments in der Bundesrepublik Deutschland 28 und in Europa wahrgenommen, so dass im medialen Mainstream wieder klassische Stereotype vom angeblichen Reichtum und der angeblichen Weltverschwörung der Juden auftauchten und per Internet ins Haus kämen. Die antisemitischen Karikaturen von und stereotypen Angriffe auf George Soros 29 werden dabei als „Judenbashing“ verstanden, das exemplarisch an einem in der Öffentlichkeit stehenden, bekannten Juden vollzogen und als „beängstigend“ empfunden werde.
Zweitens beurteilen unsere Gesprächspartner*innen aktuelle antisemitische Bilderwelten und entsprechendes ‚Wissen‘ als Ausdruck des fortwirkenden christlichen Antijudaismus, der „kulturellen DNA Europas“, der sich mit dem rassistischen und nationalistischen Antisemitismus verbunden habe. Der Antijudaismus sei tief in Redewendungen und Imagination der christlich-säkularisierten Bevölkerungsgruppen verwurzelt. Dabei wird von einer*m Gesprächspartner*in eingeschätzt, dass „die Mehrheit aller antisemitischen Vorfälle, […] die ich erlebe, […] aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft [kommen] und […] etwas mit einer christlichen Tradition zu tun [haben], die säkularisiert worden ist.“ Als dritte Quelle werden islamistische Organisationen benannt, etwa mit Blick auf das Skandieren der judenfeindlichen Trope „Kindermörder Israel“ auf Demonstrationen in Berlin. Teils wird viertens von Gesprächspartner*innen formuliert, dass einige jugendliche Deutsche „mit Migrationshintergrund“ sowie ein gewisser Teil von muslimischen Geflüchteten antisemitische Äußerungen mit oder ohne Bezug auf Israel tätigten, so etwa Kinder, die meinten, dass „,alle Juden alle Libanesen töten’“. Fünftens wird von „Wellenbewegungen“ des Antisemitismus innerhalb der Linken i. w. S. berichtet, der sich im Verhältnis zu Israel zeige und sich auch schon konkret gegen Gesprächspartner*innen gerichtet habe. Schließlich wird – sechstens – das nicht-jüdische bürgerlich-konservative Spektrum der Berliner Stadtgesellschaft erwähnt. So formuliert ein*e Gesprächspartner*in mit Blick auf den Berliner Kulturbetrieb, dass diejenigen, die wie sie*er einen Zugang „in die deutsche Gesellschaft oder Kultur“ fanden, in Äußerungen und Verhaltensweisen der nicht-jüdischen Bildungsbürger*innen „das pochende Herz des Antisemitismus entdeckt“ haben, wobei gelte: „Ich sage nicht, dass die Mehrheit so ist, aber vorhanden war es immer.“ Und ein*e andere*r berichtet über seine*ihre Erfahrungen mit antisemitischen Äußerungen von Kolleg*innen in der Berliner Hochschullandschaft (vgl. auch Kapitel I, g).
Antisemitische Aggressionen werden von Jüdinnen*Juden in Berlin in unterschiedlichen Lebensbereichen und dabei in unterschiedlicher Qualität erfahren. In der Öffentlichkeit, „in öffentlichen Verkehrsmitteln eher schon häufiger“, können sie sich in Beleidigungen und Beschimpfungen an der Schwelle zu tätlichen Übergriffen äußern. Exemplarisch schildert ein*e Gesprächspartner*in, am Alexanderplatz „mit hässlichen Wörtern belegt, fast geprügelt“ worden zu sein. Angesprochen wurde am Beispiel der verbalen Attacken auf George Soros bereits antisemitische Bedrohung in bzw. mittels der medialen Öffentlichkeit. Angesichts des Umstands, dass Ressentiments unvermittelt in Aggressionen umschlagen können, können letztere im ‚analogen‘ öffentlichen Raum auch in non-verbalen Interaktionen antizipiert werden. So teilt ein*e Gesprächspartner*in mit: „[A]lso ich habe schon die Erfahrung gehabt, wo ich Angst habe, weil ich Hebräisch lese in der U-Bahn. Ich weiß dann nicht, warum dieser Mann mich so anguckt.“
Am Arbeitsplatz und in der Schule sind den Gesprächspartner*innen antisemitische Aggressionen ebenfalls begegnet. So berichtet ein*e Gesprächspartner*in, dass er*-sie sich von Kolleg*innen, die zur „Crème de la Crème“ der „Charlottenburger Kultur“ gehören, „Sprüche anhören [musste] wie ‚42 war das beste Jahr der deutschen Geschichte‘.“ Ein*e andere*r berichtet, dass eingeworbene Drittmittel als „jüdisches Geld“, das als „Gefallen“ bewilligt worden sei, bezeichnet, geplante Lehrveranstaltungen „zu jüdischen Lebenswelten abfällig kommentiert“ und aushängende Veranstaltungsplakate u. a. mit den Worten „jüdischer Dreck“ und dem Symbol der Identitären beschmiert wurden. Und in der nicht-jüdischen Schule, so berichtet ein*e weitere*r Gesprächspartner*in, sei er*sie mit antisemitischen Stereotypen konfrontiert worden: „[U]nd auf der Schule, auf der ich dann war, gab es schon so Fragen wie ‚Wo ist denn jetzt eigentlich dein Judengold?‘ und so weiter und so fort.“
Aus dem weiteren beruflichen sowie privaten Umfeld wird von Abwehrreaktionen sowie Philosemitismus berichtet. So reagierten, wie ein*e Gesprächspartner*in berichtet, Angehörige von christlich-evangelischen Gemeinden verhalten, als die judenfeindlichen Positionen Martin Luthers angesprochen wurden: „[W]enn man sich vor Augen führt, Luther hat ja gesagt, ‚was würde er mit einem Juden machen, den er taufen wollen würde?’ ‚Ja, mit einem Mühlstein um den Hals in der Elbe’ […]. Im Prinzip hat er diesen rassischen Antisemitismus vorweggenommen, der ja gesagt hat, auch ein Jude, der getauft ist, bleibt ein Jude. […] Und wenn man dann das so darauf anspricht, auf Luther, dann merkt man doch auf welche [empfindlichen Stellen, Anm. d. Verf.] man tritt.“ Auch Kashrut (teils) zu befolgen, kann auf nicht-jüdischer Seite Reaktionen hervorrufen, die sich gegen Juden*Jüdinnen richten. Während andernorts etwa berichtet worden ist, dass diese Praxis als vormodern wahrgenommen und entsprechend infrage gestellt wird (vgl. Bernstein 2017, 58), scheint dieser Reflex im Falle der von dieser*m Gesprächspartner*in erlebten Situation in philosemitischer Manier rationalisiert worden zu sein: „‚Jaja, das sind ja auch Reinheitsgebote, die sind ja total zivilisatorisch und wichtig, und da drückt sich ja die Vernunft aus‘“. Dabei stellt er*sie u. a. klar: „[I]ch will auch gerade von einer deutschen Person nicht ’ne besondere Form von Vernunft zugeschrieben bekommen, weil ich jüdisch bin.“
Auch aus dem Kontext unterschiedlicher politischer Demonstrationen werden antisemitische Aggressionen berichtet. So erläutert ein*e Gesprächspartner*in, wie aus dem christlichen Antijudaismus stammende Bilder und Topoi aktuell in Berlin bei Protesten aufgegriffen werden: „Wenn heute gerufen wird ‚Kindermörder Israel‘, dann greift das zurück auf den Vorwurf des Mittelalters, Juden hätten christliche Kinder zu Pessach ermordet, um aus deren Blut Mazzen zu backen. Oder auch ‚Brunnenvergifter Israel‘, ja, ‚jüdische Brunnenvergifter‘. Das sind die ‚Rothschilds‘ mit den ‚Wucherjuden‘, ja. Also Bilder, die seit zwölfhundert, dreizehnhundert so transportiert werden, die sind einfach da.“ Ein*e andere*r Gesprächspartner*in berichtet von einem Vorfall auf einer Demonstration im Gedenken an den 9. November 1938, den Tag des reichsweiten Pogroms, in dessen Verlauf Juden*Jüdinnen ermordet, gedemütigt und verhaftet sowie ihre Geschäfte und Synagogen zerstört und geplündert wurden. Zu diesem Gedenkanlass trug er*sie eine Israelfahne, um auszudrücken, „dass es einfach ein Land gibt, was Jüd*innen auf der Welt nun mal auch schützt, aus der Erfahrung heraus, dass es eine Zeit gab, in der Jüd*innen eben nicht wussten, wo sie hingehen konnten, weil kein Land sie aufnehmen wollte“.30 Andere Demonstrant*innen verlangten, dass er*sie „die Scheißfahne runternehmen soll und [s]ich verpissen soll“. Die bereits oben angesprochene, tiefgreifende Divergenz von Bedeutungen, die Israel für jüdische und nicht-jüdische Berliner*innen haben kann, wird an dieser Stelle so zugespitzt, dass die Bedeutung Israels als „das virtuelle Obdach für alle erniedrigten und beleidigten Juden der Welt“ (Amery 1982, 156) nicht nur ignoriert, sondern aktiv unsichtbar gemacht werden soll. Dabei schreiben (vermutlich) nicht-jüdische Personen einer jüdischen Person vor, wie diese des Novemberpogroms zu gedenken habe, welches retrospektiv als eine der Vorstufen des Holocaust verstanden wird, – nämlich ohne Bezug auf den Staat, dessen Entstehung Teil der europäischen und insbesondere der deutschen Geschichte des Scheiterns der Emanzipation der Juden und schließlich des Zivilisationsbruchs ist (vgl. Diner 2002). Und im Resultat wird angestrebt, eine jüdische Person vom Gedenken daran auszuschließen (vgl. Kapitel III, m).
Die skizzierten Schilderungen dieser Form von Antisemitismuserfahrungen unserer Gesprächspartner*innen machen Folgendes deutlich:
1. Antisemitische Aggressionen schöpfen inhaltlich betrachtet aus der langen Geschichte der Judenfeindschaft, deren Gehalte (christlich-antijudaistische Dogmen und Bilder, rassistische Ideologien und moderne Verschwörungstheorien etc.) sie tradieren und adaptieren.
2. Aufgrund der Verbreitung von Antisemitismus über das politische Spektrum und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Berlins hinweg sind die Urheber*innen antisemitischer Aggressionen nicht an einem besonderen Profil erkennbar. Entsprechend formuliert ein*e Gesprächspartner*in: „[E]s kann eigentlich aus allen Richtungen kommen, ich hab’ jetzt nicht mehr irgendwie so ’ne Art Profil im Kopf, ich muss mich vor dem Menschen mit dem Bart oder mit der Glatze oder mit den Piercings irgendwie in Acht nehmen, sondern es kann jeder sein.“
3. Schließlich werden antisemitische Aggressionen in mehr oder minder schweren Qualitäten geäußert und erlebt, wobei „es eben total unvermittelt [passiert], ohne dass man sozusagen eigentlich wirklich versteht, was jetzt da gerade vor sich geht“.
4. Und, nicht zuletzt, erfahren jüdische Berliner*innen Antisemitismus (potenziell) in allen Lebensbereichen, am Arbeitsplatz und in der Schule, dem privaten und weiteren beruflichen Umfeld und am Wohnort sowie in der analogen und digitalen Öffentlichkeit. Aus jüdischen Perspektiven und lebensweltlich betrachtet sind die Erfahrung und Antizipation antisemitischer Aggressionen in den genannten Hinsichten – Quellen, Qualitäten und Lebensbereiche – umfassend. Ihnen ist mit einer ebenso umfassenden Gegenwehr zu begegnen, die alle politischen Strömungen und Bevölkerungsgruppen, Institutionen und Einrichtungen Berlins in den Blick nimmt. Dies impliziert auch, dass insbesondere die zum demokratischen Spektrum zählenden Kräfte nicht nur den Antisemitismus der jeweils anderen problematisieren sollten, sondern selbstkritisch auf die jeweils eigenen antisemitischen ‚Traditionen‘ blicken und diesen effektiv begegnen müssten.
f) Bedrohungspotenzial und widerständige Normalität im Alltag
Die jüdischen Einrichtungen in der Stadt sind Sinnbild jüdischer Präsenz und insoweit der Normalität jüdischer Gegenwart in Berlin. In Sicherheitsschleusen, Panzerglas und Polizeischutz materialisiert sich jedoch das massive Bedrohungspotenzial, dem Jüdinnen*Juden in Berlin ausgesetzt sind. Solange diese Maßnahmen notwendig sind, schützen sie Leben und schränken es zugleich ein, wie ein*e Gesprächspartner*in formuliert: „Also es gibt vielleicht zwei Teile, einer ist wirklich diese Sicherheitssache, ja es geht nicht nur um Sicherheit, es ist auch dieses Gefühl, ich bin anders, also weil du hast schon das Gefühl, du gehst hin, wo es Polizisten gibt. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was da drin ist und du gehst so rein.“ Ein*e andere*r Gesprächspartner*in hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, „wenn du aus der jüdischen Schule rausgehst und die Leute hingucken, ist ziemlich klar, also einfach, weil du bist von Polizei umgeben.“
Im Anschlag eines rechtsextremen Terroristen auf die an Yom Kippur versammelte jüdische Gemeinde in Halle (Saale) im Oktober 2019 hat sich das in der Bundesrepublik Deutschland vorhandene antisemitische Gewaltpotenzial manifestiert. Während dieser Anschlag viele Menschen der Mehrheitsgesellschaft überraschte, waren Juden*-Jüdinnen zwar „fassungslos“, aber „[n]icht überrascht“ (Czollek 2019). Mehr noch: Über solche Reaktionen des nicht-jüdischen Umfeldes drückten Gesprächspartner*innen Ärger aus: „[A]lso diese Idee von Überraschung macht mich sehr wütend […]. Also wir denken darüber oft nach (lacht). Wir sehen – also, wenn ich zur Schule komme, gehe ich durch die Sicherheit, es ist Thema, immer. Es ist nicht neu.“ Dabei ist den Gesprächspartner*innen bewusst, dass antisemitischer Terror aus der extremen Rechten und von islamistischen Organisationen droht und angesichts der Geschichte von antisemitischen Anschlägen aus dem linksradikalen Spektrum auch von dieser Seite nicht auszuschließen ist, wie ein*e Gesprächspartner*in andeutete (vgl. Kapitel I, d).31
Zugleich finden die jüdischen Communities und Juden*Jüdinnen in Berlin für sich angesichts des Bedrohungspotenzials einen widerständigen Umgang mit dieser Lage (s. u.) und etablieren eine vorsichtige Normalität: „[W]ir finden nach wie vor, dass jüdisches Leben nicht an jedem Ort Sicherheit braucht, sondern auch eine Normalität braucht, die nicht zwangsläufig mit Security einhergehen muss. Aber es is nicht immer einfach.“
Jüdische Zugehörigkeiten vollends ohne solche Schutzräume alltäglich leben zu können, wäre in einer Berliner Gesellschaft möglich, deren überwiegend nicht-jüdische Stadtgesellschaft endlich zuhört, das Gewaltpotenzial erkennt und bannt. Ein*e Gesprächspartner*in bringt dies als Wunsch zum Ausdruck: „[A]lso ich würd’ es mir wünschen, dass es in unserer Gesellschaft ein größeres Problembewusstsein dafür gibt, in welche Richtung sich die Gesellschaft auch entwickelt, weil die Entwicklungen schon vor langer, langer Zeit benannt worden sind, gerade von jüdischen Gemeinden.“
g) Bedeutungen für Betroffene und Reaktionen Dritter in unterschiedlichen Kontexten
Antisemitismus zu erfahren, bedeutet für die Betroffenen mindestens, wie es ein*e Gesprächspartner*in formuliert, dass „man […] einfach nur, ja, herabgesetzt oder diffamiert [ist].“ Darüber hinaus unterscheiden sich psychosoziale Folgen solcher Vorfälle für die Betroffenen je nach Kontextbedingungen. Dazu zählen insbesondere die Art des Lebensbereichs, in denen sie sich ereignen, sowie die Qualität der Besonderung bzw. Aggression und die Reaktionen Dritter.
Das Erleben von Besonderung im persönlichen Umfeld, wie etwa in philosemitischer Manier als ‚jüdische*r Bekannte*r‘ (s. o., Kapitel I, c) vorgestellt zu werden, wird von Betroffenen im Vergleich zu Beschimpfungen (sich „verpissen zu sollen“, s. o., Kapitel I, e) oder physischen Angriffen32 in der Öffentlichkeit womöglich als weniger bedrohlich erlebt. Die Einbettung eines Vorfalls in ein persönliches Beziehungsgeflecht erschwert indes eine direkte und offensive Gegenwehr, so dass die massive Betroffenheit („im Erdboden versinken“, s. o., Kapitel I, c) kein Ventil findet („runterschlucken“, s. o., Kapitel I, c). Im Unterschied dazu ermöglicht womöglich die Anonymität in öffentlichen Situationen den – für die Betroffenen unbekannten – Urheber*innen, beleidigenden Äußerungen und bedrohlichen Gesten unmittelbar laut und deutlich zu begegnen: „Ich scheue die Auseinandersetzung da nicht. Ich habe keine Angst.“ Getroffen fühlt sich der*die Gesprächspartner*in gleichwohl: „Aber, dass es nervt und dass es natürlich keinerlei Rechtfertigungen dafür gibt, das muss ich an diesem Punkt, glaub’ ich, nicht extra noch erwähnen.“
Am Arbeitsplatz oder in der Schule Antisemitismuserfahrungen zu machen, bedeutet, dass dies in einem Lebensbereich geschieht, an dem die Betroffenen sich regelmäßig und lange aufhalten müssen bzw. wollen. Sofern sie aus dem Umfeld der Peers, Vorgesetzten bzw. Zuständigen keine Unterstützung erfahren, bleibt – neben situativ schlagfertigen Reaktionen, die dem Ärger unmittelbar Ausdruck verleihen können – mittelfristig nur, die Situation auszuhalten oder zu verlassen. Anders als im öffentlichen Raum kann die belastende Situation aber nicht vermieden werden. Ein*e Gesprächspartner*in formuliert es folgendermaßen: „[D]ie Schulsituation ist erst einmal in der Anlage längerfristig, das ist nicht etwas, was sich von heute auf morgen löst, deshalb sind eben da, sagen wir mal, die meisten Probleme.“ Daher können auch subtilere Formen der Abwertung wie die Behandlung als „Ausnahmeerscheinung“ sowie die Konfrontation mit „Witzen“, in denen die antisemitische Zuschreibung großen Reichtums auftauchen (s. o., Kapitel I, e), als tiefer Eingriff in den Alltag erlebt werden und das Wohlbefinden dementsprechend beeinträchtigen.
Tiefgreifende psychosoziale Folgen können Antisemitismuserfahrungen schließlich in Lebensbereichen haben, die Rückzugs- und Schutzraum sind bzw. sein sollten. Dies gilt insbesondere für Vorfälle am oder in der Nähe des Wohnortes. Dort kommt es, so wurde berichtet, zu Sachbeschädigungen und Schmierereien wie „,Juden raus’“, die „das Sicherheitsempfinden der gesamten Familie dann, wenn man eine hat, nachhaltig beeinflussen“. Antisemitismus im politisch linken Spektrum geht in den geschilderten Erfahrungen der sich hier verortenden Gesprächspartner*innen in einem Fall mit Beleidigung und einem Drohpotenzial einher, in anderen mit israelbezogenen Äußerungen und Verhaltensweisen (s. o., Kapitel I, d). In diesem Kontext mit Israel identifiziert und zu einer Distanzierung von bestimmten Aspekten der israelischen Regierungspolitik gezwungen zu werden, kann besonders belastend sein, insofern die Betroffenen sich diesem Spektrum zugehörig fühlen (wollen) und hoff(t)en, dort einen Ort gefunden zu haben, an dem man sich gemeinsam gegen menschenverachtendes Verhalten zur Wehr setzt. Ein*e Gesprächspartner*in beschreibt sein*ihr Erleben hinsichtlich des Umgangs mit dem „Staat Israel“ innerhalb der – i. w. S. zu verstehenden – Linken so: „[D]ieses dünne Eis, das ist schon für mich Teil meines Lebens. Und zwar insgesamt sowieso immer und überall, aber durchaus auch da, wo ich ansonsten schon sage, das ist das Umfeld, was ich am ehesten als meine Welt, auch als mein Refugium, vielleicht sogar ein Stück weit als geschützten Raum betrachten würde. Aber wirklich nur ein Stück weit! Also ganz und gar nicht weitergehend.“
Bedeutungen und Folgen von Antisemitismuserfahrungen unterscheiden sich schließlich auch je nachdem, wie Dritte in solchen Situationen bzw. Konstellationen reagieren. Im Falle von antisemitischen Beleidigungen in der Öffentlichkeit, so berichtet ein*e Gesprächspartner*in, nahm er*sie Passant*innen als „Ewig-Wegguckende“ wahr. In den hier geschilderten Situationen erfuhren Betroffene keine Unterstützung von zufällig anwesenden Dritten. Es wird zudem davon berichtet, dass zuständige Stellen wie die Polizei in einem konkreten Fall zwar teils nicht weiter ermitteln konnten, weil kein Straftatbestand vorlag, die Bedeutung des angezeigten Vorfalls als Abwertungs- und womöglich Bedrohungserfahrung für die Betroffenen aber auch nicht ernst genommen und stattdessen bagatellisiert wurde. Solche Erlebnisse sind einerseits verletzend und können angesichts mehrerer solcher Erfahrungen zu dem allgemeineren Gefühl führen, als jüdische*r Betroffene*r nicht ernst genommen zu werden. Von ausbleibender Unterstützung von Zuständigen berichtet auch diese*r Gesprächspartner*in, nachdem er*sie antisemitische Schmierereien auf Veranstaltungsplakaten rund ums eigene Büro den unmittelbar Vorgesetzten mitgeteilt hatte: „Auf meine Meldung ans Dekanat wurde weder von Seiten der Fachbereichsverwaltung noch von den Dekan*innen reagiert.“
Über das Ausbleiben von Unterstützung hinaus wird auch von sekundären antisemitischen Aggressionen 33 berichtet, bspw. als antisemitische Vorfälle an Schulen angesprochen wurden. Als ein*e Expert*in das Mobbing eines jüdischen Schülers mit dem*der Direktor*in besprach, wurde ihm*ihr in Täter-Opfer-Umkehr entgegnet, es sei ja auch kein Wunder, der Schüler habe sein Jüdischsein ja auch so herausgekehrt. Und im Fall eines Kindes, welches im Anschluss an ein Referat über seinen Sommerurlaub in Israel von der Lehrkraft „als einziges Feedback zu dem ganzen Vortrag“ die Rückmeldung erhielt: „‚Naja, man muss ja auch sagen, dass die Juden den Palästinensern das Land weggenommen haben‘“, bekamen unterstützende Personen bei den verantwortlichen Stellen lediglich die Reaktion, die Kritik sei doch sachlich korrekt gewesen.
Antisemitische Besonderungen und Aggressionen sind einerseits unabhängig von ihren Spezifika verletzend. Andererseits variieren psychosoziale Folgen solcher Ereignisse für die Betroffenen je nach Kontextbedingungen. Mitentscheidend ist dabei, in welchen Lebensbereichen solche Vorfälle auftreten und insbesondere auch, wie Dritte reagieren. In der Gesamtschau aller von den Gesprächspartner*innen berichteten Antisemitismuserfahrungen fällt auf, dass von unterstützenden und solidarischen Reaktionen kaum berichtet wird. Diese Leerstelle ist insofern symptomatisch, als dass sie auf mangelnde Unterstützung seitens des nicht-jüdischen Umfeldes verweist. Zudem wird dezidiert von ausbleibenden Reaktionen oder gar sekundären Aggressionen berichtet. Insoweit diese Konstellationen in den Kontexten, in denen Antisemitismus erfahren wird, vorliegen, bedeuten sie, dass Juden*Jüdinnen und nicht-jüdische Betroffene den virulenten Antisemitismus weitgehend auf sich gestellt bewältigen (müssen).