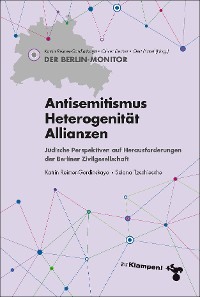Kitabı oku: «Antisemitismus – Heterogenität – Allianzen», sayfa 4
h) Einschränkung der Möglichkeitsräume jüdischen Alltagslebens
Die Virulenz von Antisemitismus, der sich aus verschiedenen ideologischen und politisch-demografischen Quellen, in unterschiedlichen Qualitäten und in potenziell allen Lebensbereichen gegen Juden*Jüdinnen (und andere Betroffene) in Berlin richtet bzw. richten kann, wird von unseren Gesprächspartner*innen entsprechend wahrgenommen und als potenzielle Erfahrung antizipiert. Und in dem Maße, wie auf die Unterstützung Dritter, ob als Bystander oder als professionell Zuständige bzw., weiter gefasst, als nicht-jüdische Zivilgesellschaft, nicht (hinreichend) gezählt werden kann, bleibt ihnen oft lediglich die Möglichkeit, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
In Konsequenz verzichten jüdische Berliner*innen unfreiwillig auf unterschiedliche Formen der Performanz jüdischer Zugehörigkeiten: Orte werden gemieden, religiöse und säkulare Zeichen der Zugehörigkeit nicht offen getragen. So berichtet ein*e Gesprächspartner*in, der*die den Magen David im öffentlichen Raum sichtbar trägt, er*sie würde von anderen Jüdinnen*Juden regelmäßig anerkennend darauf angesprochen, da diese „sich das selber nicht trauten“. Ein*e Gesprächspartner*in schildert, dass er*sie selbst zur Studienzeit, also in der Berliner Hochschullandschaft „nicht an die große Glocke“ hängte, jüdisch zu sein, und fährt mit Blick auf die aktuelle Situation im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen fort: „[J]a und auch die meisten werden eben nicht, wenn sie zu einer Behörde gehen, direkt dranhängen, ‚Ich bin Jude.‘ Aus vielen Gründen.“ Dass Antizipation und Vermeidung von Antisemitismus auch zum familiären Alltag und Schulleben der Betroffenen gehören, formuliert ein*e Gesprächspartner*in etwa so: „Sich den Alltag so anzupassen, sich zu überlegen, was erzähle ich meinen Kindern oder wie erzähle ich meinen Kindern, wie sie in der Schule mit dem Jüdischsein umgehen sollen et cetera.“ Und bei Feierlichkeiten ohne Sicherheitspersonal wird beispielsweise die Adresse nur intern bekanntgegeben: „Also immer nachdenken“, kommentiert ein*e Gesprächspartner*in diese Konstellation.
Der virulente Alltagsantisemitismus schränkt in Kombination mit der unzureichenden solidarischen Unterstützung seitens des nicht-jüdischen Umfelds die Möglichkeitsräume soweit ein, dass jüdische Zugehörigkeiten in Berlin nicht selbstbestimmt und demnach nur eingeschränkt gelebt werden können. Dieser Umstand ist als solcher ein massives, antisemitismusbezogenes Problem.34 Und dass Vermeidungsverhalten zum eigenen Schutz in allen Lebensbereichen als Umgangsweise genutzt wird bzw. werden muss, führt dazu, dass antisemitische Besonderung, Bedrohung und Aggressionen in der nicht-jüdischen Öffentlichkeit und Forschung unterschätzt werden. So fasst ein*e Gesprächspartner*in die Situation folgendermaßen zusammen: „[W]enn die Leute jetzt nicht von sich aus darauf hinweisen, dass sie jüdisch sind, dann fällt es nicht auf. […] Also von daher erfahren wir es nicht, sie und oder die Menschen werden dann nicht unbedingt anders behandelt, weil sie eben ihr Jüdischsein verdecken“.
Umgangsweisen der Vorsicht und Vermeidung sind Formen der aktiven, wenn auch ‚defensiven‘ Handhabung dieser fremdbestimmten Konstellation (s. u., Kapitel I, j). Dass in einem solchen Umfeld ein (auch) jüdischer Alltag gelebt und organisiert wird – ob kulturell, sozial oder religiös –, ist Ausdruck jüdischer Selbstbestimmtheit in Berlin.
Diese widersprüchliche Konstellation bringt ein*e Gesprächspartner*in wie folgt auf den Punkt: „[M]an muss inzwischen schon mehr als mutig sein und es ist einfach schwierig, in eine jüdische Gemeinde zu gehen und ich find’s oder ich bin sehr begeistert davon oder sehr beeindruckt, wie viele Menschen das tun unter den gegebenen Bedingungen, unter dem wie es ist, das ist doch ein starker Ausdruck davon, wie positiv besetzt eben jüdisches Leben und jüdische Identität eben auch ist“.
i) Wahrnehmung, Bewertung und Kommunikation von Antisemitismuserfahrungen
Ohne die individuelle Wahrnehmung35, Bewertung und Kommunikation von Ereignissen als Antisemitismus kann entsprechendes Problemwissen weder innerhalb jüdischer Communities und ihrer Formen der Gegenwehr gegen Antisemitismus (vgl. u. a. Kapitel III, e) zu kollektivem Erfahrungswissen verdichtet noch in die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft kommuniziert werden.
Dabei unterscheiden sich individuelle und kollektive Perspektiven auf Antisemitismuserfahrungen zunächst insofern, als jüdische Berliner*innen (und andere Betroffene) individuell und unmittelba r jeweils von bestimmten Formen betroffen sind bzw. sein können und von anderen nicht. In der obigen Darstellung sind solche unterschiedlichen individuellen Erfahrungs- und Antizipationsweisen zu einem über-individuellen Bild von antisemitismusbezogenem Alltagsgeschehen in Berlin verbunden worden. Auch in jüdischen Communities wird durch kollektive Verständigung versucht, Virulenz und Dynamik von Antisemitismus in Berlin insgesamt einzuschätzen und auf dieser Grundlage Problembeschreibungen auch in die nicht-jüdische Berliner Zivilgesellschaft und Politik zu kommunizieren.36 Dass in diesen kollektiven Verständigungs- und Kommunikationsprozess einschlägige Ereignisse bzw. Ereigniskonstellationen nicht eingehen, hat auch mit Unterschieden in Bezug auf die Wahrnehmung und Bewertung von Antisemitismus seitens Betroffener sowie die (nicht) gewünschte Kommunikation nach außen zu tun.
Die Wahrnehmung von Antisemitismus variiert aus subjektwissenschaftlicher Perspektive nicht aufgrund inter-individueller Merkmalsunterschiede als Ursachen.37 Vielmehr ist die Sensibilität dafür, Ereignisse als antisemitisch zu empfinden und zu begreifen, auch in kulturellen Selbstverständlichkeiten begründet, die mit der Heterogenität jüdischer Lebenswelten und (familiär) tradierter Geschichtserfahrungen zu tun haben. So berichtet ein*e schon lange in Berlin lebende*r Gesprächspartner*in, dass „Alltagsantisemitismus“ in seinem*ihrem Umfeld aufmerksam registriert werde, ebenso von jüdischen Israelis, die ihn zudem sehr selbstverständlich und bestimmt zurückweisen. Vor dem Hintergrund der Erfahrung eines institutionalisierten Antisemitismus in der UdSSR 38 bestehe bei jüdischen Migrant*innen aus den GUS-Staaten eine ausgeprägte Sensibilität hinsichtlich der sie betreffenden Entscheidungen in Ämtern und Behörden, Alltagsantisemitismus werde aber aus dieser Personengruppe hingegen seltener als relevant genug erachtet, gemeldet oder angezeigt zu werden. Hier wird deutlich, dass die Wahrnehmung von Ereignissen mit deren kulturell vermittelter Bewertung und Kommunikation nach außen verknüpft ist. So wird am Maßstab unterschiedlicher Normalitätserwartungen entschieden, ob ein antisemitischer Vorfall als so gravierend empfunden wird, dass er mitgeteilt wird.
Unabhängig davon, ob ein antisemitischer Vorfall nach außen kommuniziert wird oder nicht, gehört zur Wahrnehmung auch die emotionale Bewertung in dem Sinne, dass unterschiedliche Formen des Antisemitismus Menschen aus unterschiedlichen Gründen individuell besonders treffen. Dabei kann eine Rolle spielen, wie die Betroffenen den Motivationshintergrund der Urheber*innen einschätzen. So berichtet ein*e Gesprächspartner*in, nach einem Angriff von „Sportnazis“ unabhängig davon, ob er*sie für diese als Jüdin*Jude erkennbar gewesen sei, gedacht zu haben: „Ah, ja. Da ist eh ’ne Feindschaft.“ Wiederum geht mit der radikal antisemitischen Ideologie der extremen Rechten ein Bedrohungserleben einher: „Und so bürger-ähnlich ich jetzt ausseh’, is’ es halt immer noch so ’ne Form von Angstmoment.“ Anders stellt sich die emotionale Bedeutung für ein*e Gesprächspartner*in dar, wenn es sich um Kolleg*innen, liberal gesinnte Personen oder Kinder und Erwachsene, die monokulturell aufgewachsen sind bzw. leben, handelt: „Obwohl wie gesagt, dieses Gefühl, diese Kleinigkeiten, man fühlt die. Diese – auch mit Kollegen, wo es besonders stört […].“ Die angedeutete Wahrnehmung auch von ‚Kleinigkeiten‘, die vielleicht auf bestimmte Formen der Besonderung verweisen, hat hier mit der bereits angesprochenen sozialen Nähe – Kolleg*innen im beruflichen Umfeld – zu tun. Darüber hinaus geht es aber auch darum, dass von gebildeten und vom Selbstverständnis her liberalen Personen erwartet wird, ein ‚normales‘ Verhalten im Umgang mit dem*der Gesprächspartner*in an den Tag zu legen: „Es stört mich viel mehr, wenn es jemand [ist], der ausgebildet ist und sich als eine sehr offene, weiß nicht was, liberale Person sieht, als wenn es von ein- nicht nur Kind, sondern auch Elternteil kommt, von einem Hintergrund, wo ich auch gut verstehen kann, dass er nie einen Juden oder Israeli kennengelernt hat, dass er mit bestimmten Ideen aufgewachsen ist.“ Hier wird demnach die Erwartungshaltung gegenüber nicht-jüdischen Dritten gemäßigt, wenn Menschen aufgrund mangelnder Kontakt- und Bildungsmöglichkeiten keine Gelegenheit hatten, ein reflexiveres Verhältnis zu Juden*Jüdinnen zu entwickeln. Andere wiederum stören stereotype Repräsentationen von Juden*Jüdinnen, die im öffentlichen Diskurs verbreitet werden: „Wenn ich in die Medien gucke, welche Bilder über Juden und Jüdinnen gibt es denn da? Da tauchen Menschen wie ich oder mein Freundeskreis einfach überhaupt nicht auf. Wir sind aber die Mehrheit. Und das ist halt so ’n bisschen (lacht), das find ich sehr absurd.“ Je nach emotionaler Bewertung unterscheidet sich womöglich die Dringlichkeit, bestimmte Formen des Antisemitismus zu kommunizieren (s. u.).
Die als angemessen empfundene Kommunikationsstrategie antisemitischer Vorfälle unterscheidet sich allerdings nicht nur aus den skizzierten Gründen, sondern ist in Teilen kontrovers. Der folgende Vorfall mag verdeutlichen inwiefern: So berichtet ein*e Gesprächspartner*in, dass die (als Rationalisierung eines antisemitischen Impulses interpretierte) Qualifizierung der Kashrut als Ausdruck besonderer Zivilisiertheit von dem*der Urheber*in gleichzeitig dafür genutzt wird, anderen Nicht-Christ*innen ihre Zivilisiertheit abzusprechen: „Und die Art und Weise, wie gleichzeitig über Muslima und Muslime gesprochen wurde, die ja ähnliche Essensgebote zum Beispiel haben, war dann eher so ‚Naja, aber die haben ja auch einen anderen Lebensstandard, die leben ja auch in ganz anderen Wohnungen, die können ja auch ganz anders hausen‘ quasi.“ Diese Instrumentalisierung von Juden*Jüdinnen für eigene Zwecke – hier die Ausschmückung eines anti-muslimischen Narrativs – wird als Zumutung empfunden: „[W]eißt du, das sind halt genau die Debatten, die ich nicht aushalten will.“ Dieses Beispiel macht darauf aufmerksam, dass mit der Kommunikation über Antisemitismus in die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft hinein mit einem dominanzkulturellen Diskurs zu rechnen ist, der Berliner*innen, die muslimisch sind bzw. als Muslim*innen kategorisiert werden, marginalisiert.
Diese diskursiven Kräfteverhältnisse können es für Betroffene problematisch machen, einen angemessenen Umgang mit allen Quellen und Urheber*innen antisemitischer Vorfälle zu finden. So macht etwa diese*r Gesprächspartner*in die Erfahrung, dass Geflüchtete bzw. Muslim*innen im eigenen Umfeld entgegen der eigenen Wahrnehmung als bedrohlicher eingeschätzt werden als bspw. Rechtsextreme. Er*sie werde gefragt: „‚Hast du aber keine Angst mit Geflüchteten, mit Muslimen zu arbeiten?‘; ‚Hast du keine Angst, wenn du [zu Ort XY] gehst und die wissen, dass du [Jude*Jüdin] bist und da arbeitest?‘.“ Tatsächlich bewegt sich der*die Gesprächspartner*in in diesem Umfeld nicht ganz selbstverständlich auch als Jude*Jüdin: „Ja okay, manchmal ist es unangenehm, manchmal habe ich schon Angst, aber ich muss sagen, in [Bezirk in Ost-Berlin] hatte ich mehr Angst. Und wenn jemand mich [vor dem terroristischen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle an Yom Kippur nach dem Urheber des nächsten antisemitischen Terroranschlags, Anm. d. Verf.] gefragt hätte, also: ‚Ein Terrorist, einen Islamisten oder Rechtsextremen?‘, hätte ich höchstwahrscheinlich gesagt: recht-rechtsextrem (lacht).“ Dass Antisemitismus in einer Dominanzgesellschaft, deren Rezeptionshorizont antimuslimisch grundiert ist, mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn er von Geflüchteten und/oder Muslim*innen ausgeht bzw. diesen zugeschrieben wird 39, führt hier wie im folgenden Fall womöglich auch dazu, diese Erfahrungen zu relativieren. Die Erfahrung, dass ein „türkischer oder arabischer“ Klassenkamerad auf Anweisung seiner Eltern nicht mit einer jüdischen Deutschen spielen durfte, wird als „a banal sort of experience, sort of a mundane, everyday experience of anti-Semitism, like not necessarily – I mean it’s something that’s – that’s wrong, something to be condemned, but at the same time not necessarily exceptionalized“ umschrieben. Die beiden Gesprächspartner*innen stehen vor dem Dilemma, zur Unsichtbarkeit ihrer Antizipation oder Erfahrung von Antisemitismus beizutragen oder Gefahr zu laufen, diese Bereiche des Alltagsantisemitismus einer politischen Instrumentalisierung preiszugeben. Andere Gesprächspartner*innen benennen hingegen ohne weitere Problematisierung, dass sie von ihnen als ‚muslimisch‘ gekennzeichnete Menschen als zahlenmäßig relevante Urheber*innen von Antisemitismuserfahrungen wahrnehmen und problematisieren eher, dass dies nicht registriert werde. Wie in solchen Fällen Antisemitismuserfahrungen angemessen wahrgenommen und kommuniziert werden können, wird demnach unterschiedlich gesehen und ist teils kontrovers.
Für die interne und externe Kommunikation über Antisemitismuserfahrungen lässt sich vor diesem Hintergrund ‚mitnehmen‘, dass die Verständigung über das (variierende) Spektrum subjektiver Erfahrungen und deren Bewertung nicht durch das Anlegen definitorischer Kriterien ersetzt werden kann. Vielmehr scheint es sinnvoll und angebracht, Begründungszusammenhänge unterschiedlicher Formen der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung von Ereignissen zu verstehen. Eine solche Verständigung, zu der etwa die Systematisierung von entsprechendem Wissen bspw. in der Beratung beitragen könnte, kann sowohl intern als auch extern sukzessive dazu beitragen, das antisemitismusbezogene Alltagsgeschehen im Dialog miteinander zu objektivieren. Auf unterschiedliche Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen von bzw. über Antisemitismuserfahrungen, die von Geflüchteten und Muslim*innen ausgehen bzw. diesen zugeschrieben werden, kommen wir zurück (vgl. Kapitel III, l).
j) Individuelle Umgangsweisen: Ausweichen und Konfrontation zwischen Fremd- und Selbstbestimmung
Der Alltag jüdischer Berliner*innen vollzieht sich, wie gezeigt, in einer Mehrheitsgesellschaft, in der latenter und manifester Antisemitismus 40 sich u. a. in Formen der Besonderung, Bedrohung und Aggression äußert. Insoweit solche Antisemitismuserfahrungen auf der Basis entsprechender Wahrnehmungen und Bewertungen gemacht oder antizipiert werden, müssen die Betroffenen einen Umgang damit finden. Dabei bewegen sich individuelle Umgangsweisen aus unterschiedlichen Gründen zwischen eher defensiven 41 und eher offensiven Varianten.
So wird den Urheber*innen antisemitischer Vorfälle teils nicht unmittelbar offensiv begegnet. Im persönlichen (privaten und beruflichen) Umfeld kann eine Thematisierung schwierig sein, weil es so scheinen könnte, als ob der*die Betroffene dadurch die Etikette eines höflichen Umgangs miteinander verletzt. Und weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Gegenüber Kritik anzunehmen versteht, kann die Konsequenz einer berechtigten Intervention auch sein, ggf. wichtige Beziehungen zu verlieren. Insbesondere mag dies gelten, wenn die Urheber*innen Vorgesetzte sind oder diese sich auf die Seite der Urheber*innen stellen. In solchen Konstellationen müssen die Betroffenen also in gewisser Weise zwischen zwei problematischen Optionen ‚wählen‘: die Verletzung und Wut in der Situation still zu ertragen oder womöglich private und/oder berufliche Kontakte aufs Spiel zu setzen (vgl. Kapitel I, g). Mitentscheidend dafür, in bestimmten Situationen nicht offensiv zu reagieren, ist auch das Haushalten mit der eigenen Kraft. So formuliert ein*e Gesprächspartner*in: „Es ist eine schwierige Arbeit und ich muss auch meine Energie halten und ich muss dann entscheiden, wo macht es Sinn (lacht).“ Ob es Sinn macht, hängt zudem von der Einschätzung des Gegenübers mit Blick auf dessen Reflexionsfähigkeiten ab: „Und man muss auch wählen, es gibt auch Leute, wo du denkst, es macht gar nichts, wenn ich jetzt eine Stunde mit dem rede. Aber- und, also es kommt drauf an, unterschiedlich.“ Während hier im Falle einer antizipierten ‚Wirkungslosigkeit‘ diese der Grund dafür ist, eine Auseinandersetzung erst gar nicht zu beginnen, wird im folgenden Fall von Gesprächspartner*innen von einer Reaktion abgesehen, weil man dem*der Urheber*in zufällig begegnet ist und daher einschätzt: „bringt nichts, lohnt sich nicht, man trifft die Person nie wieder“. Und schließlich macht ein*e Gesprächspartner*in darauf aufmerksam, dass es „definitiv auch ein Handlungsmoment [sei] zu merken, ok, ich kann die Situation einfach auch verlassen“. Solche unterschiedlich begründeten, defensiven Umgangsweisen können also als aktive Handhabung von Antisemitismuserfahrungen verstanden werden. Sie sind unter den jeweils benannten Umständen subjektiv funktional, gehen aber ggf. mit Kosten für die Betroffenen einher. Diese werden im Vergleich mit offensiven Umgangsweisen noch deutlicher.
So meint etwa der*die zuletzt zitierte Gesprächspartner*in, dass es „irgendwie netter [ist], mit den Leuten in Diskussion zu gehen, meistens. Und wenn man das kann, mache ich das ganz gerne.“ Umgekehrt gelte: „das Gespräch abbrechen [lässt] einen in irgendeiner Form von Machtlosigkeit dann irgendwie auch zurück“, so dass es ein Lernprozess war, auch das Verlassen der Situation als Ausdruck einer Form von Handlungsmacht zu empfinden. Teils wird den Urheber*innen antisemitischer Vorfälle also offensiv-argumentativ begegnet. So wird etwa in Reaktion auf die Frage nach der Herkunft mit Rückfragen reagiert: „Und ich spiele dann gern das Spiel zurück: ‚Ahja, wo denkst du denn, dass ich herkomme? Ahja, welche Aufladung hat das denn für dich? Warum fragst du mich denn genau nach dem Land, wenn es doch auch das Land sein könnte. Du bist dir ja da auch nicht ganz sicher…‘.“ Ein*e andere Gesprächspartner*in meint mit Blick auf seine*ihre Entgegnung auf antisemitische ‚Witze’: „Witzig sein (lacht), in manchen Momenten ist ein wichtiger Coping-Mechanismus.“
Während im o. g. Fall ein*e Gesprächspartner*in sich bei Zufallsbegegnungen nicht auf eine direkte Auseinandersetzung einlässt, weil sich dadurch im eigenen Alltag nichts ändern würde, werden andere im öffentlichen Raum laut. Es erleichtert Betroffenen den emotionalen Umgang mit Antisemitismuserfahrungen, wenn sie ihre Verletztheit in Wut umwandeln können: „Verletzendere Momente ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich damit einen guten Umgang habe. Ich werde dann sauer, ich schreie dann die Leute an. Genau, und wenn ich die Leute nicht einmal anschreien kann, dann ist es immer ein scheiß Moment.“ Im öffentlichen Raum gehört dazu durchaus eine Portion Mut, wie diese*r Gesprächspartner*in ausdrückt: „Aber ich bin […] von äußerster Zivilcourage und ich scheue die Auseinandersetzung da nicht. Ich habe keine Angst.“ Dass es auch darum geht, das Gegenüber „ein bisschen wach zu rütteln“, verweist darauf, dass vielen Urheber*innen der Umstand, antisemitisch agiert zu haben, nicht bewusst ist. Und so können die Lautstärke und der Wechsel des Sprachregisters (s. u.) das Ausmaß der Übergriffigkeit spiegeln, die im antisemitischen Akt liegt. Offensiv-konfrontative Reaktionen ermöglichen Betroffenen zudem, das Gegenüber die eigene „Handlungsmacht“ spüren zu lassen, also die ihnen im antisemitischen Akt zugedachte Position mindestens zurückzuweisen. Und schließlich erhöhen sie die Sichtbarkeit des Vorfalls als eines antisemitischen auch mit Blick auf das weitere Umfeld: „Also, die verbale Auseinandersetzung, die wird dann durchaus auch mal gröber. Also da pfeife ich auf den elaborierten Code, den verlass ich dann und ich werde dann auch laut. Also gar nicht mal unbedingt, weil ich immer vor Zorn glühe, sondern weil ich der Meinung bin, desto lauter solche Auseinandersetzungen ausgetragen werden, umso eher werden auch die Ewig-Wegguckenden, und sie gucken immer weg, auch mal hellhörig.“ Offensiv-argumentative Reaktionen erfüllen also verschiedene wichtige Funktionen, zu denen die mögliche Überzeugung des Gegenübers, die Sichtbarmachung von Antisemitismus für das Umfeld und die Rückgewinnung von Handlungsmacht gehören. Zugleich sind sie, wie im Vergleich mit den defensiven Umgangsweisen deutlich wird, unter gegebenen Umständen nicht in jeder Situation und für jede Person ohne weiteres realisierbar.
Wie eingangs bemerkt, müssen Juden*Jüdinnen in Berlin nicht nur einen Umgang mit einer großen Bandbreite von Antisemitismus erfahrungen finden, sondern auch mit der Antizipation antisemitischer Besonderung, Bedrohung und Aggression in unterschiedlichen Lebensbereichen. Eine sehr weitreichende Umgangsweise ist, die eigene jüdische Zugehörigkeit in (bestimmten Bereichen) der eigenen Lebenswelt unsichtbar zu halten bzw. zu machen, soweit dies möglich ist. In öffentlichen Debatten vielfach erwähnt wird die Praxis von Männern, die Kippa im öffentlichen Raum nicht zu tragen bzw. mit anderen Kopfbedeckungen unsichtbar zu machen. In ähnlicher Weise wird auch der Magen David nicht offen getragen, um möglicher Besonderung oder Aggression vorzubeugen (s. o.). In anderen Lebensbereichen, wie normalisierten Schulen, Hochschulen und Ämtern, wird die eigene Zugehörigkeit deshalb gar nicht oder nur vertrauenswürdigen Personen mitgeteilt (s. o.). Neben diesen bereits ausführlicher dargestellten Umständen gehört zu der Strategie, sich als Jude*Jüdin unsichtbar zu machen, etwa auch, sich im Falle eines servierten „Schweinebratens“ als Vegetarier*in auszugeben, um Debatten um das Einhalten von Speisevorschriften zu vermeiden. Und an Orten, die, wie bestimmte S- und U-Bahnstationen, zu bestimmten Zeiten als gefährlich eingeschätzt werden, entschied ein*e Gesprächspartner*in, „dass ich mich nicht mehr ohne die [sehr blonde Freund*innen-Clique] bewege, nachts in der Stadt.“
Angesichts der oben beschriebenen Bedrohungslage werden Zusammenkünfte anlässlich von jüdischen Feiertagen, für die keine (zu bezahlende) Security zur Verfügung steht, von alternativen Vorsichtsmaßnahmen begleitet: „[M]eine Kinder gehen zu jüdischen Schulen und wenn es einen jüdischen Feiertag gibt und es ein Event gibt, also es ist, man muss immer planen, denken, Adresse nicht geben, dass niemand- wenn es keine Sicherheit gibt, dann lieber, dass nicht alle es wissen. Also immer nachdenken.“
Die Beispiele ergänzen den bereits oben beschriebenen Umstand, dass jüdische Zugehörigkeiten in Berlin angesichts von antisemitischer Besonderung, Bedrohung und Aggression nicht unbehelligt gelebt werden können. An dieser Stelle steht jedoch im Vordergrund, die benannten Strategien der Vermeidung und Unsichtbarmachung als Aspekte einer aktiven und bewussten Handhabung dieser Konstellation zu begreifen. Ihre Funktion liegt darin, die eigene Person, Familie und Community in bestimmten Lebensbereichen vor antisemitischer Besonderung, Aggression und Bedrohung zu schützen, ohne die vielfältigen jüdischen Lebensweisen aufzugeben. Vielmehr wird jüdisches Alltagsleben auch in widerständiger Weise bzw. dem virulenten Antisemitismus zum Trotz organisiert.
Defensive und offensive Umgangsweisen mit Antisemitismuserfahrungen sowie der Antizipation von Antisemitismus können als aktive und flexible Handhabung solcher Zumutungen verstanden werden. Dabei sind auch defensive Umgangsweisen unter jeweils spezifischen Umständen subjektiv funktional. Allerdings gehen defensive Umgangsweisen mit psychischen Kosten einher und Vorsichtsmaßnahmen mit der unfreiwilligen Unsichtbarmachung jüdischen Alltagslebens. Dass Juden*Jüdinnen in Berlin sich in einer von der Mehrheitsgesellschaft geprägten Konstellation wiederfinden, in der defensive Handlungsstrategien subjektiv begründet sind und es notwendig ist, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, verletzt das Recht auf Gleichheit und Differenz. Es gilt, diese Konstellation so zu verändern, dass derartige Strategien überflüssig werden und alle Juden*Jüdinnen in Berlin auch ihre jüdischen Zugehörigkeiten selbstbestimmt leben können. Und während die Dekonstruktion und Abwehr von Antisemitismus primäre Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft ist, aus der heraus Juden*Jüdinnen besondert, bedroht und aggressiv angegangen werden, bleibt das Empowerment der Betroffenen eine davon zunächst unabhängige Herausforderung der jüdischen Communities. Dabei erlauben kollektive Zusammenschlüsse es, in Überschreitung der individuellen Umgangsweisen, das antisemitismusbezogene Geschehen zu verarbeiten und der Mehrheitsgesellschaft deutlicher vor Augen zu führen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.