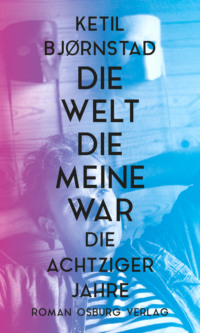Kitabı oku: «Die Welt, die meine war», sayfa 3
7.
Robert Mugabe kehrt nach fünfjährigem Exil nach Rhodesien zurück. Ich sitze zusammen mit Tore Olsen im Frognervei. Im großen Wohnzimmer im ersten Stock. Tore kommt von nirgendwo und wird in viel zu wenigen Jahren in dieselbe Richtung verschwinden, auf einer kurvenreichen Winterstraße zwischen Schweden und Norwegen. Alle haben ihn geliebt. Er ist ein sogenannter Loner unter den Musikjournalisten. Deshalb scharen die sich um ihn. Er ist Redakteur der Musikzeitschrift Puls. Dort schreiben die Leute mit den jungen, starken Meinungen. Für kurze Zeit glaubte ich, einer von ihnen zu sein, aber ich stand zu sehr auf der anderen Seite. Ich war nicht der, der zuhörte. Ich war der, der spielte. Dennoch wurden wir aufeinander zugetrieben, als sich die Zeitungen für Rock und Pop öffneten. Ich schrieb für Aftenposten. Tore wollte für Blikk schreiben, die neue Zeitung von Trygve Hegnar. Er wollte mich mit ins Boot holen. Ich zögerte. Ich wollte eigentlich nicht schreiben. Nicht so. Als Pionier. Für den neuen, unabhängigen Musikjournalismus kämpfen. Wie kann man unter Trygve Hegnar unabhängig sein. Bei Puls ist das anders. Alle neuen Generationen entwickeln ein dichtes Netz von mehr oder weniger Intellektuellen, die die Prämissen setzen. So war es zu Hans Jægers Zeit, zu Johan Borgens Zeit, zur Zeit der Studentenbewegung. Diese selbstsicheren jungen Journalisten machten eine Musikzeitschrift, wie sie in Norwegen bisher noch niemand gesehen hatte. Bisher hatten wir Melody Maker, Down Beat und New Musical Express gelesen. Jetzt lasen wir Puls und die fähige Konkurrentin Nye Takter. Die Botschaft von beiden war klar: Don’t bore us. Come to the chorus. Für mich, der sich mit Klavierkonzerten und Symphonien beschäftigt hatte, die niemals weniger als dreißig Minuten dauerten, war es noch immer seltsam, eine Welt zu betreten, in der jedes Lied nach höchstens vier Minuten zu Ende war. Ich hatte die Methode für Leve Patagonia und Och människor ser igjen und teilweise auch bei Tidevann angewandt. Strophe und Refrain. Strophe und Refrain. Aber das war nicht genug. Was zählte, war der Inhalt. Diese jungen und begabten Journalisten wussten, wie die Musik zu klingen hatte, was gut war und was schlecht. Das Arroganzniveau war so hoch und oft so erschreckend, dass es mir unvorstellbar erschien, jemals mit einer dieser Meinungstrompeten gemeinsame Sache zu machen, ja, sie sogar in den neunziger Jahren heiraten zu sollen. Diese Mischung aus Faye Dunaway, Kim Novak, Jane Fonda und Catherine Deneuve. Die Allererste, die genauso war wie eben sie. Die blonde Bombe an sich, C., die ich später Cruella de Vil nennen sollte, das war in scherzender Stimmung, zugleich aber kam ich mir vor wie ein ängstlicher, schwanzwedelnder Dalmatiner. Bewunderung und Ehrfurcht. Denn ich hatte schon angefangen, um diese Menschen herumzuscharwenzeln, versuchte, mich hip und urban zu machen. Hatte angefangen, mich von den selbstgestrickten Pullovern zu verabschieden, war in meine erste Matinique-Boutique gegangen und hatte Hose und Hemd aus mercerisierter Baumwolle erstanden. Immer, wenn ich in Oslo war, wollte ich mit diesen Menschen zusammen sein, wollte ein Teil der guten Gesellschaft werden, der neuen Profilgruppe, diesmal in der Welt der Musik. Sie ließen das aber nicht einfach zu. Sie konnten einen Speichellecker schon auf meilenweite Entfernung entlarven. »Aal in einem Eimer voll Rotz«, wie einer von ihnen sagte. Sie standen nicht auf der Bühne. Sie saßen im Dunkeln und hörten zu. Wenn wir auf dem Podium standen, wussten wir nie, wo im Saal sie waren. Sie blieben für sich. Hatten ihren Geheimcode und waren auch keine Modelöwen der oberflächlichen Sorte. Wenn sie sich dazu herabließen, etwas zu kaufen von dem Geld, das sie vermutlich nicht hatten, dann etwas Teures. Sie waren eine eng verwobene, rauchende Clique mit Büro irgendwo in der Nähe von Bankplassen. Sie waren der neue Wein und die stinkenden Socken zugleich. Sie befanden sich irgendwo zwischen Sexbombe und Brillennerd, mit dem brutalen und zugleich so unwiderstehlichen Tore Olsen und seinem Freund Tom Stiklesæther, dem es gelang, Grünerløkka aussehen zu lassen wie die Lower East Side, wenn er nur durch die Thorvald Meyers gate ging. Mit dem filmstardunklen Jan Omdahl, der wie eine Kreuzung aus Elvis Presley und Robert de Niro wirkte. Wenn ich gewusst hätte, dass der Bluesprofessor Øyvind Pharo mein Verlagslektor werden sollte, hätte ich mich gefragt, ob mir jemand LSD untergeschoben hatte. Was sie miteinander verband, war die Liebe zur Musik. Die Verachtung des Mittelmäßigen, des Pompösen und des Lächerlichen. Alles, was ich nicht wusste, rettete mich. Deshalb sitzt Tore Olsen an einem Vormittag im Februar bei mir zu Hause und zögert. Er mochte nicht als einer von vielen ins Hotel Ambassadør kommen, zusammen mit verachtenswerten Publikationen wie Dagbladet und VG. Er musste trotz allem mit einem Minimum an Respekt behandelt werden, wie er mit einem Lächeln sagte. Dieser seltsame und melancholische Mann, der mich bisweilen an Humphrey Bogart erinnerte. Ich habe ihm soeben das Titelstück vorgespielt, Tidevann.
»Doch, das ist gut. Natürlich ist das gut.« Er zieht eine fast unsichtbare Grimasse. Als ob er sich darauf vorbereitet, eine faule Tomate runterzuschlucken.
»Ja, sind die Musiker nicht hervorragend? Die Begleitung durch Venaas und Thowsen? Riisnæs und Eberson, die sich gegenseitig hochspielen?«
Noch heute kann ich meine junge, naive Stimme hören. Die Teetassen auf dem weißen IKEA-Tisch. Tore, der ein Nicken andeutet, auch wenn er eigentlich den Kopf schüttelt.
»Das gefällt dir wirklich?«, fragt er freundlich. Ich bemerke den Spott nicht sofort. Ich tappe nichtsahnend in die Falle. Er ist genau wie Rowan Atkinson und Griff Rhys Jones in Not the Nine O’Clock News, wo dem armen Mel Smith, der ein Grammofon kaufen will, am Ende Ketchup ins Gesicht gespritzt wird.
»Als wir diese Spur gemischt haben, habe ich gedacht, alles andere hätte ungeschehen bleiben können«, sage ich und schlucke eilig. Ein sicheres Anzeichen für plötzliche Unsicherheit.
»Du bist nicht auf den Gedanken gekommen, es könnte zu gut sein?« Tore Olsen zieht wieder diese unheilverkündende Grimasse.
»Wie kann irgendwas zu gut sein?«
Er zögert. Schluckt ebenfalls. Bestimmt um ein spöttisches Lächeln zu verbergen, denke ich. Er ist der Kritiker, der seinen Standpunkt finden will. Den Kipp-Punkt. Er ist der Wiener Kritiker Eduard Hanslick, der fand, Tschaikowskis Violinkonzert stinke. Plötzlich begreife ich, worauf er hinauswill. Vielleicht habe ich es zum ersten Mal geschafft, sein umwerfendes Ego zu erkennen. Ich bin zwar selbst Kritiker, sehe mich aber nur als jemanden, der den Lesern den Weg weist. Tore Olsen will auch die Musiker beeinflussen. Aus diesem Gedanken ergibt sich die selbstverständliche Überzeugung, dass der Kritiker die Bedingungen vorgibt. Es ist die verdammte Pflicht der Musiker, sich danach zu richten. So hat sich die Kritik von Kunst, Musik und Literatur ohnehin immer schon verhalten, und jetzt mehr denn je. Aber die Besten, die Reflektiertesten und Präzisesten haben eine Botschaft. Sie werden respektiert, weil ihre Meinungen auch für die von Bedeutung sind, die kritisiert werden. Sie sind nicht wie ihre Kollegen, die Schlagzeilenlieferanten. Die Mobber. Die, an die ich denke, während ich im Flughafen von München schreibe, auf dem Heimweg zum Jubiläumskonzert eines lieben Freundes und Musikers. Der Kritiker, der es damals gewagt hat, ihm von sechs möglichen Punkten einen zu geben. Der, der nicht gut genug zugehört hatte. Torheit, verkleidet als Wissen. Wie das Geräusch eines Luftballons, wenn er seinen Inhalt aus sich herauszischt, in die Luft und hinein ins Rampenlicht jagt, um danach zu Boden zu fallen wie ein undefinierbares Häuflein.
»Das gefällt mir nicht«, sagt Tore Olsen, plötzlich ein bisschen verlegen.
»Aber hörst du nicht, dass Pete und Ebers die Dreigriff-Gitarristen, die du mit deinem verdammten Polizeikorps die ganze Zeit hochjubelst, in Grund und Boden spielen?«
»Doch, die sind natürlich tüchtig.«
»Tüchtig!? Und was ist mit Pål, Terje, Trond und Knut? Eine bessere Band findest du nirgendwo. Knut ist im Moment vielleicht einer der weltweit besten Saxophonisten. Pål macht Paul Motian zu einem Tanzkapellenmusiker, Terje lässt Jaco Pastorius lächerlich wirken, und Trond Villa ist ein Geschenk an die Menschheit.«
»Doch, die sind alle tüchtig. Auf ihrer Weise.« Tore rutscht im Sessel hin und her.
»Du wirst uns also eine zurückhaltende Kritik schreiben und stattdessen die Superlative für eine Drecksband aus Rakkestad aufsparen, wo der Drummer so angeknallt ist, dass er mit den Stöcken nie das Becken trifft?«
»Ich kann verstehen, dass du aufgebracht bist«, sagt Tore Olsen peinlich berührt. »Aber ich muss doch meine Meinung sagen. Das ist meine verdammte Pflicht. Dass etwas gut ist, rein technisch, bedeutet nicht, dass der Inhalt gut ist. Sieh dir nur die übelsten naturalistischen Maler an. Überdeutliche Metaphorik.«
»Du klingst jedenfalls mitfühlend«, sage ich tröstend, ohne zu wissen, wen ich hier überhaupt zu trösten versuche.
Er beunruhigt mich. Er ist Verbündeter und Widersacher zugleich. Und dennoch wird er nie zu meinem Freund. Nicht auf die tiefe, vertrauliche Weise. Egal, was Ole macht, ich werde sein Freund sein. Ich werde seine Entscheidungen akzeptieren, so unmöglich sie auch sein mögen. Ich werde durch dick und dünn mit ihm gehen. Er wird das auch für mich tun. In dieser Art Freundschaft gibt es keinen Platz für scharfe Kritik. Aber für Tore Olsen ist etwas anderes wichtiger. Die Wahrheit über die Musik, so wie er sie erlebt. Manchmal, wenn er den Kopf hebt und meinen Blick sucht, liegt dort etwas Suchendes, als erwarte er eine Kapitulation oder vielleicht ein Eingeständnis: »Ja, das ist wirklich schlecht. Ich weiß, dass du die Wahrheit sagst.« Und wenn ich etwas sage, huscht ein Hauch von Erstaunen über sein Gesicht. Etwas fast Verwirrtes. Als habe er allen Ernstes geglaubt, dass ich mich nach all diesen Monaten der Vorbereitungen und der Aufnahmen seinem Gedankensystem einordnen und sagen könnte: »Ja, sicher. Du hast recht. Das ist wirklich schlecht. Schade, dass wir das nicht schon im Studio begriffen haben. Jetzt werde ich die Polygram bitten, die ganze Kiste zurückzuziehen.«
Aber das sage ich nicht.
»Noch Tee?«
»Nein, danke.«
Er steht auf. Wischt sich die Krümel der Rosinenbrötchen ab.
»Gute Rosinenbrötchen kannst du immerhin backen«, sagt er.
»Die habe ich bei Møllhausen gekauft«, sage ich.
»Die sind trotzdem gut«, sagt er.
8.
Vielleicht wird es in diesem Buch mehr um Kritik und Kritiker gehen als in den beiden vorigen. Denn der Kampf um das Überleben wurde gerade in diesem Jahrzehnt intensiver. Ich und einige der Musiker, mit denen ich nach und nach spielte, wie auch Schriftsteller, die ich kennenlernte – wir fühlten uns oft so getroffen, als stünden wir direkt am Rand des Abgrundes.
Ich kannte die Kritiker in zwei Welten. In der Musik und in der Literatur. Ich war selbst Kritiker. Aber ich hielt mich auch darüber auf dem Laufenden, was Theaterkritiker schrieben und die, die sich mit bildender Kunst beschäftigten. Ich erkannte die Methoden. Ich registrierte die unterschiedlichen Menschentypen. Die Annäherung. Mit jedem Jahr wurden sie deutlicher. Ich konnte die Ergebnisse beurteilen, mit den Verurteilten sprechen. Ich war Richter und Verurteilter zugleich.
Es war damals, in den besten Jahren, dass alles gleichzeitig passierte. Glücklich ist, wer auf solche Jahre zurückblicken kann. Man denkt an sie und träumt für den Rest des Lebens von ihnen. Es kann in den Teenagerjahren sein oder gleich nachdem man zwanzig geworden ist. Diese Periode ist die intensivste. Lebt man mit vierzig noch immer so intensiv, wird das Krise genannt, und bist du achtzig und hast noch ebenso große Visionen, wirst du als Trottel bezeichnet. Wenn du jung bist, darfst du. Manche jungen Leute aber haben mehr Glück als andere. Wir, die um 1950 geboren wurden, erlebten, dass die eigene persönliche Befreiung mit einer kulturellen Befreiung zusammenfiel, die sich in der gesamten westlichen Welt ausbreitete. Die Schöpfungsjahre des Rock. Der Durchbruch des Avantgardismus. Die Erneuerung des Jazz. Es ist nicht immer so. Nicht alles ist zu allen Zeiten immer gleich spannend. Das Energieniveau hebt und senkt sich im Rhythmus der Geschehnisse in Politik und Kulturleben. Die Bohèmiens der 1880er Jahre lebten intensiv, denn die Zeit war intensiv. Weil die Konflikte real waren. Weil jemand den Mut hatte, etwas zu sagen. Die Studentenbewegung 1968. Jugend auf den Barrikaden. Wer stand auf den Barrikaden in den acht Jahren, in denen Ronald Reagan regierte? Die Punks? Und in den Jahren von George Bush? Doch, ja, da kam der Hip-Hop. Aber die politische Opposition war schwächer. Das Gefühl, nützlich zu sein, etwas ausrichten zu können. Etwas zu erschaffen. Eine Stimme zu haben, die gehört wird. Bei den Ersten zu sein. Heute kannst du nicht das Radio einschalten, ohne ein junges Mädchen zu hören, das singt wie Joni Mitchell. Aber im Fernsehen sieht man bekannte Personen Dinge tun, von denen sie keine Ahnung haben. Doku-Soaps haben die Sendezeit übernommen, die früher den Kulturprogrammen zukam. Keine Fernsehspiele mehr. Keine großen Konzertübertragungen vom Jazzfestival in Molde. Die stundenlangen Konzerte auf der Lorelei. Im Jahre 2017 fragen wir: Wer soll raus? 1980 fragten wir: Wer soll rein? Es wurde gefragt: Wo ist das Neue? Wohin geht jetzt der Weg? Wer kommt mit? Hat irgendwer die neue LP von David Bowie schon gehört? Was macht der jetzt? Was hast du gesagt? Nile Rodgers?
Seht euch 1980 näher an. Als diese Begegnung mit Tore Olsen stattfand, hatte Norwegens staatliche Filmkontrolle soeben Life of Brian wegen des blasphemischen Inhalts verboten. Alfred Hitchcock stirbt. Barbra Streisand singt Woman in Love und Kate Bush singt Babooshka.
Jemanden herausnehmen. Jemanden hereinholen. Das war die Aufgabe der Kritiker. Ich schrieb nicht mehr so viele Rezensionen wie vorher. Außerdem machte ich einen Bogen um norwegische Musiker, mit wenigen Ausnahmen. Die eigentliche Schlussfolgerung war mir unbehaglich. Warum soll gerade die den Kritikern vorbehalten sein, wenn alle anderen Glieder in der Kette, Schriftsteller, Musiker, Produzent, Verleger wissen, dass kein Urteil über ein Kunstwerk absolut sein kann? Das Fragezeichen liegt immer näher an der Wahrheit als das Ausrufezeichen. Außerdem hat das Fragezeichen Ähnlichkeit mit einem F-Schlüssel.
Eines Tages werde ich mich zwingen, noch einmal alle meine alten Rezensionen zu lesen. Ich weiß, dass es mir furchtbar peinlich sein wird. Ich bin früheren Kritikern begegnet, die sich nicht einmal mehr daran erinnern können, was sie geschrieben haben. Wir kommen alle nicht ungeschoren davon. Ich weiß, dass ich oft bereuen werde, was ich in der Zeitung geschrieben habe. Öfter, als ich das bereuen werde, was ich in Romanen geschrieben habe. Ich werde nicht immer stolz sein, auch wenn ich nie die Schlachterschürze vorgebunden habe.
Jemanden hereinholen. Jemanden herausnehmen. Das klingt fast militärisch. Aber darauf basieren die heutigen Reality-Serien. Jemand muss entfernt werden. Verschwinden. Am Ende ist nur eine einzige Person übrig. Der Sieger oder die Siegerin. Jemanden verschwinden zu lassen bedeutet auf gut Norwegisch eigentlich: jemanden umbringen. Aber nichts ist eindeutig. In Libyen haben norwegische Jagdflieger viele Wochen lang Menschen verschwinden lassen, ohne auch nur zu wissen, was sie bombardierten. Das heißt, sie ließen sie nicht verschwinden, sie ließen sie einfach in einer Blutlache in der Wüste liegen, während sie ihr Tempo steigerten, hoch oben am Himmel, und zum nächsten Ort weiterflogen, wo sich jemand bewegte. Aber nach der Bombe im Regierungsviertel und dem Massaker auf Utøya sprachen wir nur über Gemeinschaft, darüber, dass jedes Leben unersetzlich ist. »Ist es nicht an der Zeit, dass wir anfangen, uns wie Menschen zu benehmen?«, fragte der Philosoph Arne Næss, als er sich anschickte, die Organisation Fremtiden i våre hender zu gründen. Nun zitierten wir Nordahl Grieg: »Still bewegt sich das glitzernde Band der Granaten. Haltet ihren Zug in den Tod an, haltet ihn mit Geist auf.« Musik ist Geist. Das hätten auf jeden Fall meine alten Lehrer an der Waldorfschule gesagt. Als uns die Ausmaße der Katastrophe aufzugehen begannen, und als die Zahlen der Toten von Utøya bekanntgegeben wurden, brachte der NRK die ganze Zeit Musik.
Musik ist immer die Rettung, wenn wir anfangen, über die Wörter zu stolpern.
9.
Movitz liegt mit riesigen Wunden im Sessel von Hødnebø. Immer wieder leckt er sich die offenen roten Fleischflächen. Wir haben es aufgegeben, ihn zum Tierarzt zu schaffen. Nicht einmal ein Trichter um den Hals hindert ihn daran, seine Freiheit zurückzuerobern. Seine Methode ist: beißen, kratzen, reißen, kämpfen und danach lammfromm werden. An diesen Winterabenden nehme ich ihn oft auf den Schoß und denke, dass er es geschafft hat, seine Mutter zu schwängern, dass er das vielleicht noch mehrere Male tun wird, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Er wird zwischen meinen Händen auf meinem Schoß zu einem Kätzchen. Er schaut aus zusammengekniffenen Augen zu mir hoch, vertrauensvoll wie ein Kind. Weiß er, wie sehr ich über ihn bestimmen kann? Dass ich mit ihm zum Tierarzt gehen und um eine Giftspritze bitten kann? Aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen ihn so lange wie möglich behalten. Viele der Liebkosungen, die wir einander geben, gehen über ihn. Wenn wir Movitz streicheln, streicheln wir uns gegenseitig und streicheln zugleich das Haus, in dem wir wohnen, das uns beschützt und einen Rahmen um unsere Leben zieht.
Eines Morgens liegt ein Brief im Briefkasten. Ich erkenne die Handschrift. Es ist die von Lill Lindfors. Keine andere schreibt so schön und frei, mit großen, verführerischen Schlingen, die doch immer scharf und zielgerichtet sind. Eine Frau, die ihrer selbst sicher ist und weiß, was sie will. Wenn ich nur auch so wäre.
An diesem Abend sitze ich neben der Anderen vor dem Kamin und zeige ihr den Brief. Er ist so persönlich und vertrauensvoll. Eine ganze LP, nur mit meinen Texten und Melodien. Aufnahmen schon im Mai in Stockholm.
»Selbstverständlich musst du das tun«, sagt die Andere.
Nichts ist selbstverständlich, denke ich.
Der Brief kam in einer Zeit der kreativen Auflösung. Keine neuen Ideen. Kein Wille. Nur das übergeordnete Ziel: Noch mehr abnehmen. Straff werden. Hart. Stark.
Ich antworte ihr, zitternd und bewegt. Eine Ehre. Eine große Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ich danken soll. Das Vertrauen, das sie mir erweist.
Ich werde also wieder Lieder schreiben. Hatte gedacht, ich würde einen Roman schreiben, aber der kann warten. In Lake Placid gewinnt der Schlittschuhläufer Eric Heiden aus den USA bei den Olympischen Spielen über alle Herrendistanzen. Ich sitze abends mit Tore zusammen und sehe mir diese wahnwitzige Degradierung an, die Schlittschuhnorwegen in die Verzweiflung treibt, bis Bjørg-Eva Jensen auf 3000 Meter Gold holt. An jedem Tag denke ich an den Sänger, der besser Elvis singen konnte als der Meister selbst. Jetzt liegt er im Krankenhaus und stirbt. Anne Lise hatte ihn besucht, als Freundin und als Vertreterin der Plattenfirma.
»Kann ich irgendetwas für dich tun?«, hatte sie gefragt.
»Nichts«, hatte er geantwortet. »Ich wünschte nur, ich könnte leben, bis die Olympischen Spiele zu Ende sind.«
Sowie Anne Lise mir von diesem Gespräch erzählt hatte, verspürte ich eine neue und fast beängstigende Traurigkeit. War das Todesangst? Bei jedem neuen Lauf, bei jedem neuen Gold, näherte sich der Elvis-Junge weiter seinem Ende. Was, wenn er bis zur Abschlussfeier lebte? Und bis zur Zeit danach? Die doppelte Leere. Alle Geschehnisse waren erledigt, bei den Olympischen Spielen und in seinem Leben. Per Hansson, Oles alter Freund, hatte zwei Jahre zuvor darüber geschrieben, in Den siste veien, über den 22 Jahre alten krebskranken Ola, der wusste, dass er sterben würde, dem aber eine letzte Auslandsreise geschenkt wurde. Der Schmerz, als er nach Hause kam. Der Tod, der wartete. Ola sagte: »Worauf kann ich mich denn jetzt noch freuen?«
Es ist der Abend, an dem die Bohrinsel Alexander Kielland in der Nordsee umkippt. Ein wilder Sturm tobt. Die Bohrinsel wurde von der französischen Werft CFEM als Bohrinsel gebaut, aber die Reederei Stavanger Drilling II AS benutzt sie schon seit langer Zeit zum Wohnen. Eine Rohrleitung zum Meeresgrund hat es unmöglich gemacht, alle zehn Verankerungsstreben einzusetzen, die die französische Werft für die Verwendung in einem sturmreichen Meeresgebiet voraussetzt. Nur acht sind in Gebrauch. Plötzlich knickt ein Bein ab. Zwischen den Beinen C und D gibt es keine Streben wie zwischen den anderen Beinen. Dort sollte Platz geschaffen werden für die Versorgungsschiffe. Aber das D-Bein bricht. Ohne Vorwarnung kippt die riesige Konstruktion zur Seite und nur Sekunden später liegen die Ölarbeiter im Meer, sind in den Wellen vollkommen hilflos. Ein Hubschrauber ist fünf Minuten entfernt, doch dem wird der Befehl zum Umkehren erteilt. Ein Freund von mir ist an Bord. Schichtwechsel. Einige sollten die Bohrinsel verlassen. Andere sollten dort abgesetzt werden. Aber jetzt ist die Bohrinsel umgekippt. Im eiskalten Wasser kämpfen viele um ihr Leben. 123 von diesen Menschen finden den Tod.
Eine Nachbarin kommt weinend hereingestürzt.
»Die Alexander Kielland«, ruft sie. »Die ist umgekippt!«
Wir wissen, was das bedeutet. Unser Freund. Ist er nicht gerade dort draußen?
Wir schalten Radio und Fernseher ein. Lauschen auf beides. Draußen in der Nordsee scheint sich ein furchtbares Drama abzuspielen. Unser Freund. Kämpft er mit den Wellen? Ist er schon tot? Werden wir ihn niemals wiedersehen? Ich habe den Tod durch Ertrinken immer für den entsetzlichsten gehalten. Sich nicht über Wasser halten können. Aufgeben müssen. Der Schock, wenn man nicht mehr durchhalten kann, wenn der Körper sagt, dass man atmen muss. Der Augenblick, wenn man Waser schluckt, spürt, dass sich die Lunge füllt, dass diese Bewegung, die jeder Mensch ausführt, Tausende Male an einem Tag, jetzt die Vorankündigung des Todes ist. Wie lange arbeitet das Bewusstsein? Kann man noch begreifen, dass man ertrinkt? Gibt es keine Versöhnung? Nur den kalten, salzigen, düsteren Tod? Trond-Viggo hat mich auf ein Lehrbuch der Rechtsmedizin aufmerksam gemacht. Sowie er davon erzählt hatte, rief ich bei Norli in der Universitetsgate an und bestellte ein Exemplar. Als das Buch im Briefkasten lag, packte ich es mit zitternden Händen aus. Was würde ich darin finden?
Die Bilder waren schlimmer als alles, worauf ich vorbereitet war. Ich hatte bisher erst einmal einen toten Menschen gesehen, als einer der älteren Nachbarn auf dem Küchenboden zusammenbrach, nachdem er nach einer Beerdigung in der Kirche von Dypvåg, von der er soeben nach Hause gekommen war, die Flagge gehisst hatte. Wir hörten den Aufprall bis zu uns, mehrere hundert Meter weit weg. Als wie angerannt kamen, stand die Tür offen. In der Küche lag er auf dem Rücken, mit gläsernen Augen, die in die Ewigkeit starrten. Wir standen nur da und glotzten, unschlüssig, trauten uns nicht, ihn anzufassen, etwas zu tun. Aber eine andere Nachbarin, die in Bergen Narkoseschwester gewesen war, kam angestürzt und fiel neben ihm auf die Knie, öffnete seinen Mund und begann mit Wiederbelebungsversuchen, schickte ihren eigenen Atem in seine Lunge, presste ihm die Brust, tat alles, was in einer solchen Situation richtig ist, wozu wir jedoch nicht in der Lage waren. Wir standen nur da, sahen zu und schämten uns. Und als ich das Buch der Rechtsmedizin aufschlug, verspürte ich dasselbe Gefühl des Unbehagens. Was ich dort sah, war so entsetzlich. Menschen, die sich erhängt hatten, die mich anstarrten, mit hängender Zunge, Menschen, die sich den halben Kopf weggeschossen hatten. Aber das Schlimmste waren die Ertrunkenen, das offene Entsetzen, das noch immer ihre Gesichter prägte, die Schaumblasen um die Lippen. Die Überraschung im Blick, als ob der Todeskampf noch nicht zu Ende wäre. Es war einfach nicht zu ertragen.
Auch in dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Wo war unser Freund jetzt? Lag er auf dem Meeresgrund? Hatte er Schaum vor dem Mund? Würden die, die ihn vielleicht irgendwann herausholten, das Entsetzen in seinen Augen sehen? Ich wartete auf Movitz, hörte aber nicht den Aufprall auf der Veranda. Sicher war er wieder auf Mädchenjagd gezogen.
Ich dachte daran, was Caryl Chessman geschrieben hatte, ehe er im Gefängnis von San Quentin mit Gas ermordet wurde: Dass der Tod zu groß war, um erfasst zu werden, dass ihm schwindlig wurde, wenn er nur daran dachte.
Die ganze Nation scheint getroffen worden zu sein. Das Öl ist unsere neue Identität. Diese Industrie war bisher von fast visionärem Optimismus geprägt. Während Landwirtschaft und Fischerei von Konflikten und internationalen Vorschriften, Zollschranken und Verordnungen geprägt sind, die wir nicht begreifen, die nicht einmal die begreifen, die mit am Verhandlungstisch sitzen, hat das Öl, mit Statoil und dem Inselnachbarn Arve Johnsen an der Spitze, die schlichte Botschaft verkünden können: Da unten auf dem Meeresgrund liegt schwarzes, gleißendes Gold. Es braucht nur hochgeholt zu werden. Wir alle werden an diesem neuen, unvorstellbaren Reichtum teilhaben, und die, die das Glück haben, dort draußen zu arbeiten, leben wie im Luxushotel. Von den Tauchern ist nie die Rede. Denen, die in unvorstellbare Tiefen versenkt werden und deren Leben zerstört wird. Nein, wir reden über die anderen. Die, die an sogenannten Elektronengehirnen sitzen und sich Zahlen und Kurven ansehen. Die, die Rohre zusammenstecken, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Die, die zum Frühstück frisch gebratene Schweinerippe bekommen, Räucherlachs und Rührei, Räucherlamm, Lutefisk, Kabeljau und Speck. Frisch aufgebrühten Kaffee, Cola und Sprite, Schokolade mit Sahne und Darjeelingtee. Der Wohlstand kennt keine Grenzen. Sie haben in der Lotterie gewonnen. Der Arbeitsplatz weit draußen im Meer war ein Kulturprodukt. Alexander Kielland. Einer der vier Großen. Der Garman und Worse geschrieben hat. Der den Literaturnobelpreis hätte bekommen können. Dass die riesigen Bohrinseln solche Namen erhalten, dass eine Ölgesellschaft sich Saga nennt, sagt nur, dass Selbstvertrauen und Abenteuer zu einem Teil der norwegischen Identität geworden sind.
Nun ist das Schlimmste passiert. Bei einem Flugzeugunglück tritt der Tod oft augenblicklich ein. Aber der bloße Gedanke an die vielen Menschen, die dort mit den riesigen Wellen gerungen haben, macht gewaltigen Eindruck. Ministerpräsident und König finden fast keine Worte. Die Trauerfeiern werden zu Ritualen der Ohnmacht, in denen die Wenigsten Trost finden. Das Mitgefühl der offiziellen Stellen erreicht uns nicht. Die hatten gesagt, das könne nicht passieren. Alles sei sicher. Jetzt war es passiert. Die Alexander Kielland schwimmt noch. Aber die Bohrinsel liegt kopfunter im Wasser.
Einige Tage später spreche ich mit unserem Freund. Er erzählt von dem Sturm, wie schrecklich das war, wie sie sich der Alexander Kielland genähert hatten, es waren nur noch fünf Minuten bis zur Landung, als der Pilot den Befehl zur Umkehr erhielt.
»Wir wussten nicht, was passiert war«, sagt er. »Wir haben eben kehrtgemacht. Ich hatte so viele Freunde dort draußen.«