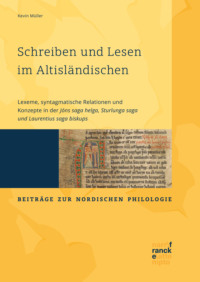Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 13
5.3. skrifa aptr ‚zurückschreiben‘
In der Laurentius saga biskups ist skrifa zweimal mit dem Adverb aptr ‚zurück, rückwärts‘ (vgl. Baetke 2002: 22) belegt, welches in beiden Fällen eindeutig in den Korrespondenzframe gehört und darin eine weitere Dimension eröffnet. Das ONP (skrifa) nennt zu diesem Partikelverb nur drei Belege aus norwegischen Urkunden aus der ersten Hälfte des 14. Jh., die aber nur in Abschriften aus der Zeit um 1700 erhalten sind (vgl. Dipl. Norv. VIII, 127, 140, IX, 121). Somit wären die Belege der Laurentius saga biskups die ältesten. Die Konstruktion mit dem Adverb aptr hat aber ältere Belege aus dem späten 13. Jh. mit rita, die im vorliegenden Korpus nicht vorkommt (vgl. ONP rita, Hødnebø 1960: 58, 1291; Jónsson 1925: 20, 1280). Der eine Beleg aus der Laurentius saga biskups, welcher nur in der A-Redaktion vorliegt, weil an dieser Stelle in der B-Redaktion das Verb skrifa fehlt, betrifft die Antwort des Priesters Hafliði Steinsson auf das Schreiben von Bischof Laurentius, in dem er Hafliði um Rat bittet:
a) skrifade hann so aptur. til hans. ad hann skylldi aptur fara. j þvi skipe sem broder Biorn og hitta so erchibyskup. og kors brædur. jafn fram odrum. enn bad þess […] (LSB 42f.).
Er [= Hafliði] schrieb ihm [= Laurentius] dann zurück, dass er im gleichen Schiff wie Bruder Bjǫrn zurückfahren und dann den Erzbischof und die Chorherren im gleichen Masse treffen solle, und bat […] (Übers. KM).
Subjekt des aktiven Verbs ist das Personalpronomen hann ‚er‘, welches auf den ABSENDER, Priester Hafliði, verweist. Die BOTSCHAFT ist einerseits im at-Satz zusammengefasst und wird im Folgesatz mit dem Sprechaktverb biðja ‚bitten‘ im Hauptsatz noch ausgeführt. Auf den EMPFÄNGER Bischof Laurentius referiert das Präpositionalobjekt til hans. Diese Füllungen sind typisch für den Korrespondenzframe. Das Adverb aptr steht für eine Gegenrichtung und impliziert somit eine Richtung, die durch das Schreiben von Bischof Laurentius gegeben ist (vgl. Kap. II.5.2.8.3.a.). Dieses Adverb dient also dazu, die beiden Schreibrichtungen auseinanderzuhalten. Der Korrespondenzframe wird verdoppelt, weil das Adverb aptr bereits auf einen ersten Korrespondenzframe verweist, in welchem die Attribute ABSENDER und EMPFÄNGER vertauscht sind. ABSENDER1 ist somit EMPFÄNGER2 und EMPFÄNGER1 ABSENDER2. Ausserdem ist zwischen BOTSCHAFT1 und BOTSCHAFT2 zu unterscheiden. Entsprechend muss es auch ein SKRIPT1 und SKRIPT2 geben, für die es im Kontext aber keinen Wert gibt.
Der andere Beleg verhält sich gleich und stammt aus der A-Redaktion, während in der B-Redaktion das Adverb aptr fehlt (vgl. Kap. II.5.2.8.1.f.). Der Priester Páll Þorsteinsson überreicht dem Bischof Jón einen Brief von Bischof Laurentius, so dass ABSENDER1 und EMPFÄNGER1 bekannt sind (vgl. LSB 111f.):
b) Sira Pall spurde þa Jon byskup huortt hann [vi]lldi nockud aptur skrifa. sem hann hafdi adur [j] fyr[stu] skrifat a[t hann mun]di [n]or[d]ur r[id]a [enn] um sumarit yfer at dæma Modru ualla maalum. Enn sira Pall sagdist ecki hirda ad fara med þeim brefum. byskupinn sagdizt ecki munde skrifa annath (LSB 112).
Priester Páll fragte dann Bischof Jón, ob er etwas zurückschreiben wolle, wie er vorher zuerst geschrieben hatte, dass er im Sommer nach Norden reiten würde, um über die Mǫðruvellir-Angelegenheit zu urteilen. Aber Priester Páll sagte, dass er nicht beabsichtige die Briefe mitzunehmen. Der Bischof sagte, dass er nichts anderes schreiben wolle (Übers. KM).
Das Verb ist aktiv und hat Personalpronomen hann als Subjekt, welches auf Bischof Jón, den ABSENDER2 verweist. Das Akkusativobjekt ist durch das Indefinitpronomen nokkut ‚etwas‘ besetzt, welches einerseits generisch für die BOTSCHAFT2 oder elliptisch mit bréf, mit dem es kongruiert, für das SKRIPT2 stehen kann. Für das SKRIPT1 ist das Substantiv bréf im Kontext belegt (vgl. LSB 111f.). Der durch sem eingeleitete Komparativsatz fasst die BOTSCHAFT2 zusätzlich zusammen. Der EMPFÄNGER2 bleibt zwar eine Leerstelle, es muss sich aber um den ABSENDER1 handeln. Der BOTE Priester Páll erschliesst sich aus dem Kontext und bleibt in beiden Frames identisch. Das im Zitat enthaltene Kompositum Mǫðruvalla-mál ‚Mǫðruvellir-Angelegenheit‘ gibt einen Wert für das Attribut ANGELEGENHEIT, welcher für beide Schreibrichtungen gilt und die Werte der BOTSCHAFT einschränkt.
In obigem Zitat gibt es noch zwei weitere Belege von skrifa, welche mit dem ersten zusammenhängen. Der erste hat das Personalpronomen hann im Subjekt, welches auf Bischof Jón verweist. Wegen des durch sem eingeleiteten Komparativsatzes muss er dieselbe Rolle als ABSENDER wie beim ersten Beleg einnehmen. Der Objektsatz paraphrasiert die BOTSCHAFT. Die Adverbien áðr ‚vorher‘ und í fyrstu ‚zuerst‘ deuten darauf hin, dass die Korrespondenz zwischen Laurentius und Jón schon länger besteht, so dass skrifa e-t hier eine Ellipse von skrifa e-t aptr til e-s darstellt. Der zweite Beleg ist Teil einer AcI-Konstruktion, deren Agens wieder Bischof Jón ist. Das Thema ist das Numerale annat, welches generisch für die BOTSCHAFT2 oder als Ellipse für annat bréf ‚einen anderen/zweiten Brief‘ für das SKRIPT2 aufgefasst werden kann, und diese von der Botschaft, dem Skript und dem Schriftträger im Komparativsatz unterscheidet. Die übrigen Attribute ergeben sich aus dem ersten Beleg skrifa e-t aptr.
Die Konstruktion skrifa e-t aptr erweitert den Korrespondenzframe um eine zweite Schreibrichtung und impliziert die erste. Dadurch werden alle Attribute des Korrespondenzframes verdoppelt, jedoch können gewisse Paare abhängig von der Situation denselben Wert haben, wie oben die Attribute BOTE und ANGELEGENHEIT gezeigt haben.
5.4. skrifa fram ‚schriftlich mitteilen‘
In drei Belegen der Laurentius saga biskups ist skrifa mit dem Adverb fram ‚vorwärts, voran (lok. u. temp.)‘ (vgl. Baetke 2002: 159) ergänzt, die alle eng miteinander zusammenhängen, weil sie denselben Brief von Bischof Jǫrundr an den Erzbischof betreffen, und klar in den Korrespondenzframe gehören. Allerdings fragt sich, was für eine Rolle das Averb fram hat. Das ONP (skrifa) erwähnt nur einen Beleg aus der B-Redaktion der Laurentius saga biskups (LSB 47) für das Partikelverb skrifa fram, das in Baetke und Fritzner fehlt.
Der erste Beleg ist nach der A-Redaktion zitiert, welche sich nur unwesentlich von der B-Redaktion unterscheidet: a) „byd eg þier þad. sira Laur(encius) ad vit leggium nidur ockur mala ferle. og skrife satt giarnaliga. huor med odrum vier framm med þier: til erchibyskups“ (LSB 46). ‚Ich biete dir an, Priester Laurentius, dass wir unseren Rechtsstreit niederlegen und wir geben dir in gegenseitigem Einverständnis ein Schreiben voraus an den Erzbischof mit‘ (Übers. KM). Die Form skrife ist hier vermutlich ein Verschrieb, weil für die 1. Person Plural beim Verb eine Endung -im oder -um zu erwarten wäre. Noreen (1970: 364, § 536, Anm. 2) erwähnt in seiner Grammatik drei Belege von Konjunktiv Präsens 1. Pl. mit der gleichen Endung aus dem Stockholmer Homilienbuch. In der B-Redaktion steht dagegen skrifum (vgl. LSB 46). Das Verb ist aktiv und hat das Personalpronomen vér ‚wir‘ als Subjekt, welches auf den Sprecher der direkten Rede, den ABSENDER Bischof Jǫrundr verweist. Auf den angesprochenen Priester Laurentius verweist das Präpositionalobjekt með þér ‚mit dir‘, der hier BOTE und dessen Fall zugleich Teil der BOTSCHAFT ist, welche hier eine Leerstelle bildet. Im ersten Satz des Zitates ist der Wert málaferli ‚Rechtshandel, Prozess‘ (vgl. Baetke 2002: 402) für das Attribut ANGELEGENHEIT enthalten, welcher den Wert der BOTSCHAFT einschränkt. SCHRIFTTRÄGER und SKRIPT fehlen hingegen auch im Kontext. Das Präpositionalobjekt til erkibiskups ‚an den Erzbischof‘ liefert den Wert für den EMPFÄNGER. Eine weitere Ergänzung ist das Modaladverb sáttgjarnliga ‚versöhnlich, verständigungsbereit‘ (vgl. Baetke 2002: 520) mit der abhängigen Konstituente hvárr með ǫðrum ‚jeder von beiden mit dem anderen‘, welches die Beziehung zwischen Jǫrundr und Laurentius ausdrückt, was sich wiederum auf die Gestaltung der BOTSCHAFT auswirkt. Zuletzt bleibt das direktionale Adverb fram. Dieses gibt, so weit es sich anhand dieses Belegs beurteilen lässt, keine zusätzliche Information, weil bereits die Konstituente til erkibiskups eine Richtung vorgibt.1
Beim zweiten Beleg, der narratologisch an den ersten anschliesst, sind die Verhältnisse ähnlich. Zwischen Jǫrundr und Laurentius kommt es zu keiner Einigung und Jǫrundr schreibt an den Erzbischof. Die beiden Redaktionen unterscheiden sich an dieser Stelle; als erstes wird die A-Redaktion analysiert: b) „var þui mest truad sem Jor(undur) byskup hafdi skrifat. fram til erchibyskups og kors brædra“ (LSB 47). ‚Es wurde dem am meisten geglaubt, was Bischof Jǫrundr „voraus“ an den Erzbischof und die Chorherren geschrieben hatte‘ (Übers. KM). Das Verb skrifa ist aktiv und Teil eines Relativsatzes. Subjekt ist der ABSENDER Bischof Jǫrundr. Die Relativpartikel sem besetzt die Position des Akkusativobjekts und bezieht sich auf das Demonstrativpronomen því (Dat. Sg. n.) im Hauptsatz, welches generisch für eine BOTSCHAFT oder auch mit dem Substantiv bréf (n.) kongruiert, das einen Wert für das SKRIPT oder den SCHRIFTTRÄGER darstellt. Dritte Ergänzung ist das Präpositionalobjekt til e-s mit dem Erzbischof und den Chorherren als EMPFÄNGER. Vierte Ergänzung ist wieder das Adverb fram, dessen Rolle auch hier unklar ist, weil durch die Präposition til schon eine Richtung gegeben ist. Aus dem Kontext ist noch der BOTE Bruder Bjǫrn bekannt.
Die B-Redaktion unterscheidet sich neben der Graphie auch lexikalisch und syntaktisch: c) „uar þo þeim flutningi mest trvat sem Jorundr biskup hafdi fram skrifat“ (LSB 47). ‚Es wurde aber dem Bericht am meisten geglaubt, den Bischof Jǫrundr „voraus“ geschrieben hatte‘ (Übers. KM). Das Verb skrifa ist ebenfalls aktiv mit Bischof Jǫrundr, dem ABSENDER, als Subjekt. Die Relativpartikel sem besetzt wieder das Akkusativobjekt, verweist hier aber auf das Lexem flutningr ‚Bericht‘ im Hauptsatz, welches einen Wert für die BOTSCHAFT bildet. SCHRIFTTRÄGER und SKRIPT ergeben sich erst später in der Erzählung, wie unten noch zu sehen ist. Der EMPFÄNGER bildet im Gegensatz zur A-Redaktion eine Leerstelle, es muss sich aber um denselben handeln, was ebenfalls für den BOTEN gilt. Bei diesem Beleg kommt das Adverb fram in seiner direktionalen Funktion tatsächlich zum Zug, weil im Satz sonst nichts den Korrespondenzframe eindeutig evoziert.
Der dritte Beleg hat nur in der B-Redaktion das Adverb fram (s.a. Kap.II.5.2.8.1.d.) und unterscheidet sich in den Ergänzungen: d) „þa uoru lesinn bref þau sem Jorundr biskup hafdi fram skrifat honum til þunga“ (LSB 51f.). ‚Dann wurden jene Briefe gelesen, welche Bischof Jǫrundr ihm zu Lasten geschickt hat‘ (Übers. KM). Skrifa fram ist aktiv mit dem ABSENDER Bischof Jǫrundr als Subjekt. Die Position des Akkusativobjekts besetzt die Relativpartikel sem, welche auf das Substantiv bréf im Hauptsatz verweist, das somit einen Wert für die Attribute SKRIPT und SCHRIFTTRÄGER bildet. Das Adverb fram ist Teil der Rekurrenz und erfüllt wohl dieselbe Funktion wie oben, dass die Richtung hervorgehoben wird, weil das Präpositionalobjekt mit til fehlt. EMPFÄNGER und auch BOTE sind Leerstellen, es muss sich aber um dieselben Personen wie in den obigen Belegen handeln. Als letztes kommt die in der Analyse der A-Redaktion schon besprochene (vgl. Kap. II.5.2.8.1.d.) Konstituente honum til þunga ‚ihm zu Lasten‘ für den ZWECK vor.
Die Funktion des Adverbs fram kann anhand dieser Belege nicht sicher beurteilt werden, weil die Angabe der Richtung bereits die Präposition til bei einigen Belegen erfüllt. Dies erinnert an Richtungsadverbien wie suðr ‚nach Süden‘ oder sunnan ‚von Süden‘, welche für das ZIEL oder die HERKUNFT stehen und zusammen mit til vorkommen, aber im Gegensatz zu fram einen Ort implizieren, welcher für das Verständnis entscheidend sein kann. Fram hebt als Ergänzung zu skrifa also die Richtung hervor, ohne einen bestimmten Ort anzugeben, aber um den Korrespondenzframe wahrscheinlich zu betonen. Die Attribute sind gleich wie bei den übrigen Konstruktionen von skrifa, die den Korrespondenzframe evozieren. Dazu gehören: ABSENDER mit dem Wert biskup, EMPFÄNGER mit dem Wert erkibiskup, SKRIPT bzw. SCHRIFTTRÄGER mit dem Wert bréf, BOTSCHAFT mit den Werten flutningr und sáttgjarnliga, ZWECK mit dem Wert þungi, ANGELEGENHEIT mit dem Wert málaferli und BOTE mit den Werten prestr und bróðir. Im Falle des Priesters Laurentius ist der Bote keine Vertrauensperson des Absenders oder Empfängers, während Bruder Bjǫrn in Beziehung zum Erzbischof steht. So weit es sich anhand dieser Belege beurteilen lässt, unterscheidet sich skrifa fram in Bezug auf die Attribute nicht von skrifa, ausser dass es eindeutig den Korrespondenzframe evoziert.
5.5. skrifa til ‚anschreiben‘
Das Verb skrifa mit der Präposition til für den Empfänger, das Ziel oder den Zweck des Schreibens ist häufig belegt. In der Laurentius saga biskups gibt es allerdings auch einen Beleg mit til als Adverb, an einer Stelle, die wegen einer Lakune in der A-Redaktion nur in der B-Redaktion erhalten ist: „uakti herra Petur bonord uidur skyllda frænkonu kongsins. uar hun austur i Uik. beidizt hann at kongurinn skrifadi henni til“ (LSB 14). ‚Herr Pétr brachte bei einer Verwandten des Königs seine Werbung vor. Sie war im Osten in Vík. Er bat darum, dass der König sie anschreibe‘ (Übers. KM). Das Partikelverb skrifa til ist aktiv und hat den König als Subjekt. Daneben gibt es noch ein Dativobjekt mit dem Pronomen henni, welches auf die Verwandte des Königs verweist. Weder Baetke noch Fritzner führen ein Partikelverb skrifa til auf. Das ONP (skrifa) führt fünf Belege an, die alle aus Handschriften nach der Mitte des 14. Jh. stammen, so dass es sich bei skrifa til um eine jüngere Konstruktion handelt. Die Belege stammen alle aus einem Korrespondenzkontext mit dem EMPFÄNGER im Dativobjekt. Es lässt sich nicht entscheiden, ob der Absender auch Schreiber war. In der Ǫsvalds saga sind bréf ‚Brief‘ als Akkusativobjekt belegt und das Präpositionalobjekt um þeira ørendi beggja (vgl. Loth 1969: 78) ‚über ihrer beider Anliegen‘ belegt, das wie bei skrifa auf das Attribut ANGELEGENHEIT verweist. Der Wert konungsdóttir ‚Königstochter‘ des Attributs ABSENDER ist ebenfalls bemerkenswert, weil Frauen im Rahmen der Schriftlichkeit kaum erwähnt werden.
Wahrscheinlich ist skrifa til wie lesa upp und lesa yfir (vgl. Kap. III.3. und 4.) eine Entlehnung aus dem Niederdeutschen, wo ein Verb toschriven ‚durch Zuschrift wissen lassen‘ belegt ist (vgl. Schiller/Lübben 1969: IV, 585). Diese Bedeutung träfe auch gut auf den obigen Beleg zu, weil Herr Pétr den König darum bittet, seine Verwandte durch Zuschrift wissen zu lassen, dass er um sie wirbt. Der König fordert Herrn Pétr darauf auf, einen Brief schreiben zu lassen, und bietet ihm dafür sein Siegel an. Dann bittet Herr Pétr den Priester Laurentius, den Brief zu verfassen (vgl. LSB 14, Kap. II.5.2.2., Kap. II.6.2.b.). Der König fungiert mit seinem Siegel als ABSENDER, Laurentius und Pétr sind am Verfassen und Schreiben des Briefes beteiligt. Die im Kontext vorhandenen Attribute ABSENDER, SKRIPT, SCHRIFTTRÄGER, SIEGEL, BOTSCHAFT und EMPFÄNGER lassen sich auch bei der Konstruktion skrifa til e-s finden, so dass skrifa e-m til eine jüngere synonyme Konstruktion darstellt, die wie skrifa e-t fram eindeutig den Korrespondenzframe evoziert.
5.6. skrifa upp ‚auf-/abschreiben‘
Das letzte Partikelverb ist skrifa upp, welches weder in Baetke (2002: 564) noch Fritzner (1886–96: III, 380) als Lemma zu finden ist. Das ONP (skrifa) führt hingegen drei Belege unter skrifa upp an, welche ähnlich wie bei skrifa til aus Handschriften nach der Mitte des 14. Jahrhunderts stammen, so dass es sich ebenfalls um eine jüngere sprachliche Konstruktion handelt. Deren Vorbild ist wahrscheinlich mnd. upschriven ‚aufschreiben, durch ein Schreiben aufkündigen‘ (vgl. Schiller/Lübben 1969: V, 128). Skrifa upp ist in der Laurentius saga biskups in der A-Redaktion im selben Abschnitt zweimal belegt, in dem aus Bischof Laurentius’ Alltag berichtet wird:
fyrst for hann þa j sitt studium og studerade hann j bokum. skrifade hann vpp aa vax spialld. nỏteranndi þad sem hann | villde hafa serliga vr bokum. og þar epter skrifade Einar diakne vpp j kuaterne edur bok so a[d] byskupinum var til tæk nær hann villde aa lita og þad framme hafa (LSB 101).
Zuerst ging er in sein Studierzimmer und studierte in den Büchern. Er schrieb auf einer Wachstafel ab, indem er kennzeichnete, was er besonders aus den Büchern haben wollte, und danach schrieb Diakon Einarr es in ein Heft oder Buch ab, so dass es dem Bischof zur Verfügung stand, wenn er es lesen und davon Gebrauch machen wollte (Übers. KM).
Die beiden Belege sind fast gleich strukturiert: Beide Verben sind aktiv, beim ersten ist Bischof Laurentius das Subjekt, beim zweiten der Diakon Einarr. Daneben sind sie mit der Zielangabe, welche den Schriftträger beinhaltet, ergänzt, beim ersten Verb á vaxspjald ‚auf eine Wachstafel‘ und beim zweiten í kvaterni eðr bók ‚in ein Heft oder Buch‘. Diese beiden Präpositionalobjekte kommen auch bei rita und skrifa vor, wo á e-t/e-u für den SCHRIFTTRÄGER und í e-t/e-u für das SKRIPT steht, was auch bei diesem Beleg zutrifft, denn die Wachstafel dient als Schriftträger für Notizen und das Buch stellt ein Skript dar, das wahrscheinlich Exzerpte enthält.
Das Akkusativobjekt fehlt bei beiden Verben. Auf den INHALT verweist das Akkusativobjekt þat ‚das‘ des Verbs notera, welches als Partizip Präsens ein Attribut zum ersten Subjekt darstellt. Das Demonstrativpronomen þat ist durch einen Relativsatz ergänzt, welcher Intention und Quelle beschreibt. Die Bedeutung des Verbs notera ist an dieser Stelle unklar. In Baetke fehlt ein passendes Lemma, Fritzner (1886–96: II, 837) übersetzt es als ‚bezeichnen‘ („betegne, mærke“), was der Bedeutung des lateinischen notare ‚kennzeichnen, bezeichnen‘ (Georges 1998: II, 1194f.) entspricht, auf welches das altnordische Verb zurückgeht (vgl. Blöndal 2008: 674). Es ist anhand des Kontexts nicht ersichtlich, wie Laurentius kennzeichnet und was er tatsächlich auf die Wachstafel schreibt. Wahrscheinlich schreibt er auf der Wachstafel Stichworte auf, mithilfe derer Einarr die Stellen wiederfindet, die er abschreiben muss. Dafür spricht das Proadverb þar eptir, welches nicht nur temporal als ‚danach‘, sondern auch modal als ‚demgemäss‘ verstanden werden kann, d.h. Laurentius’ Notizen geben vor, was Einarr abzuschreiben hat. Was auf der Wachstafel und schliesslich im Heft oder Buch aufgeschrieben wird, sind gewisse Teile aus vorliegenden Büchern, welche Laurentius auswählt. In beiden Fällen hat skrifa upp eine QUELLE als Leerstelle, beim ersten Beleg die Bücher, aus denen Laurentius ‚etwas haben will‘, und beim zweiten dieselben Bücher oder die Wachstafel, so dass skrifa upp ‚abschreiben‘ bedeuten muss.
Der Kernframe von skrifa upp á e-t/í e-t umfasst folglich die Attribute SCHREIBER mit den Werten biskup und djákni und SCHRIFTTRÄGER mit dem Wert vaxspjald oder SKRIPT mit den Werten bók und kvaterni. Das Proadverb þar eptir verweist möglicherweise auf das Attribut QUELLE. Das Attribut TEIL bildet eine Leerstelle. Skrifa upp unterscheidet sich also in der Struktur des Frames und der Valenz nicht erkennbar von skrifa, so dass bei diesem Partikelverb die Rolle des Adverbs wieder unklar ist.
Dies gilt auch für die drei Belege aus dem ONP (skrifa), in dem der obige Beleg nicht vorkommt. Von den dreien ist jener aus Stjórn am ergiebigsten: „Eptir þat taladi gud til Moysen. Skrifa þenna sigr til æfinligs minnis upp aa þa bok.“ (Unger 1862: 296). ‚Danach sprach Gott zu Moses: „Schreibe diesen Sieg zum ewigen Andenken in diesem Buch auf!“‘ (Übers. KM). Der SCHREIBER im Subjekt ist Moses, das Akkusativobjekt sigr ‚Sieg‘ steht für den INHALT oder TEIL, die beiden Präpositionalobjekte til æfinligs minnis ‚zum ewigen Andenken‘ und á þá bók ‚in dieses Buch‘ für den ZWECK und den SCHRIFTTRÄGER. Der AUFTRAGGEBER guð ‚Gott‘ ergibt sich aus dem Kontext. Weder die semantische noch die syntaktische Valenz unterscheidet sich in diesem Beleg von jener des Verbs skrifa. Wie bei skrifa fram und til ist auch hier anzunehmen, dass Adverb upp das Problem der Polysemie von skrifa löst, indem es eindeutig den Schreibframe evoziert.