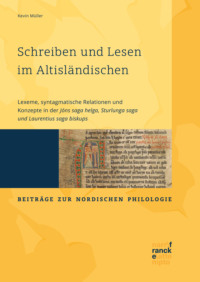Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 14
6. dikta
Das Verb dikta bedeutet laut Baetke (2002: 86) ‚verfassen, abfassen‘. Fritzner (1886–96: I, 245) umschreibt es als „sætte i Stil“ ‚schriftlich aufsetzen‘, „forfatte“ ‚verfassen‘, übersetzt es mit lat. componere und concipere, führt es auf lat. dictare zurück und sieht es als Synonym zu setja saman. Das ONP (dikta) ist in der semantischen Analyse mit sechs Bedeutungen am ausführlichsten. Von denen ist 1) für diese Arbeit am relevantesten: „nedfælde, formulere skriftligt (på latin), digte, forfatte ‖ commit to writing, formulate in writing (in Latin), compose“. Die Bedeutung 4) „(jur.) koncipere, affatte, afgive/afsige (dom) ‖ (jur.) formulate, draw upp, pass (judgement)“ lässt sich von 1) abgesehen vom juristischen Kontext nicht klar abgrenzen. Die Bedeutungen 2) ‚erfinden, dichten‘, 5) ‚verurteilen‘ und 6) ‚erschaffen‘ haben sich aus Bedeutungsverschiebungen ergeben und sind für diese Arbeit nicht relevant. In der Bedeutung 3) „diktere, foreskrive, indgive ‖ dictate, prescribe, inform“ wirkt noch das ursprüngliche Konzept DIKTIEREN des lat. dictare nach, das im vorliegenden Korpus aber nicht nachgewiesen werden kann. Die Entlehnung erfolgte nicht direkt aus dem Latein, sondern geschah über mnd. dichten ‚schriftlich fassen; ersinnen, erdichten‘ (vgl. Schiller/Lübben 1969: I, 514). Auch in anderen älteren germanischen Sprachen sind Kognaten belegt wie ahd. dihtōn, aengl. dihtan (Blöndal 2008: 113f., de Vries 1962: 76). Aisl. dikta kann aus lautgesetzlichen Gründen kein Kognat der westgermanischen Verben sein, da der Doppelkonsonant -ht- zu -tt- assimiliert worden wäre. Laut Blöndal (2008: 113f.) könnte es aber auch germanischen Ursprungs sein (mhd. tichen, nisl. deigur), er erklärt es aber nicht näher. Gärtner (2006: 67f.) führt ahd. tihtōn ohne Zweifel auf lat. dictare zurück. Dieses ist ein Intensivum zu dicere ‚sagen‘ und hat vorerst die Bedeutung ‚wiederholt sagen, vorsagen; diktieren‘. In spätantiker Zeit ist es auch ein Synonym zu scribere. Ahd. tihtōn bedeutet neben ‚vorschreiben‘ und ‚diktieren‘ aber auch ‚verfassen, dichten‘. Diese drei Bedeutungen leben in mhd. tihten fort, das auch weitere Bedeutungen wie ‚schaffen, erfinden‘ erhält. Wegen dieses Bedeutungswandels kommt im 15. Jh. lat. dictare nochmals als diktieren ins Neuhochdeutsche (vgl. Gärtner 2006: 67–75).
Die ältesten Belege von dikta, welche das ONP (dikta) erwähnt, stammen aus der Zeit um 1300. Somit ist es 20 bis 30 Jahre jünger als setja saman. Dies widerspiegelt sich auch im vorliegenden Korpus, denn dikta fehlt in den älteren Texten, der S-Redaktion der Jóns saga helga und der Sturlunga saga.
6.1. Jóns saga helga
In der L-Redaktion der Jóns saga helga ist dikta zweimal belegt. Der erste Beleg bezieht sich wie schon ein Beleg von setja saman (vgl. Kap. II.8.1.a.) auf den Mönch Gunnlaugr Leifsson, den Autor der lateinischen Vorlage der Saga (vgl. Foote 2003: CCXV, CCLXXXIII):
a) Ock at goðum monnum se fram settr biartr speghill fagrligs eptirdæmiss þeim sem eptir uilia lickia dyrðarfullu siðferði þessa aagǫta byskups hofum wer þessa frasogn segir Gunnlaugr munckr siðughr maðr ok godrar minningar *er laatinu soguna dicktat hefuir af oss ellrum monnum ok meirhaattar numit ok eigi af einni samann uorre ofdirfd ok huat uise þetta uerk vpp byriat. helldr at bodi ok aa eggian werdligs herra Gudmundar byskups (JSH 57).
„Und damit den guten Leuten der glänzende Spiegel des schönen Vorbilds vorgesetzt sei, welche den erhabenen Lebenswandel dieses wunderbaren Bischofs nachahmen wollen, haben wir diese Erzählung,“ sagt der Mönch Gunnlaugr, ein wohlgesitteter Mann mit gutem Gedächtnis, welcher die lateinische Geschichte verfasst hat, „von älteren Leuten auch mehrheitlich vernommen und nicht nur durch unsere Verwegenheit und Unbesonnenheit dieses Werk begonnen, sondern auf Geheiss und Drängen des ehrwürdigen Bischofs Guðmundr“ (Übers. KM).
Subjekt von dikta ist die Relativpartikel er, welche sich auf den AUTOR Gunnlaugr Leifsson bezieht. Als Akkusativobjekt steht das Kompositum, bestehend aus der TEXTSORTE saga als Kopf und der SPRACHE latína als Modifikator. Der bestimmte enklitische Artikel in sǫguna verweist auf den vorliegenden Text, die Jóns saga helga. Das Lexem saga ‚Geschichte, Saga‘ ist also metonymisch zum Text verschoben und somit ein Wert des Attributs TEXT. Im Kontext befindet sich eine Reihe weiterer Attribute: der AUFTRAGGEBER Guðmundr biskup ‚Bischof Guðmundr‘, die QUELLE ellri menn ‚ältere Leute‘, der STOFF siðferði biskups ‚Lebenswandel des Bischofs‘ und der ZWECK eptirdœmi ‚Vorbild‘, sondern es gibt auch diverse Anhaltspunkte zum Attributframe. Der AUTOR zeichnet sich durch einen guten Lebenswandel (siðugr) und ein gutes Gedächtnis (góð minning) aus. Die QUELLE setzt sich nicht nur aus einem ZEUGEN bzw. AUTOR ellri menn, sondern auch aus einem TEXT frásǫgn ‚Erzählung‘ zusammen. Dies muss kein Hinweis auf Mündlichkeit sein, weil die Erzählungen auch schriftlich überliefert sein können.
Der zweite Beleg beschreibt Ríkinnis dichterisches Talent: b) „Rikini var klerkr godr bædi dictaði hann ual ok uerssaði. ok sua glauggr uar hann I songlist ok minnigr at hann kunne utanbokar allann song aa tolf maanvðum“ (JSH 86). ‚Ríkinni war ein guter Kleriker. Er verfasste gute Texte und auch Verse. Er war so scharfsinnig in der Gesangskunst und hatte ein so gutes Gedächtnis, dass er jedes Lied in zwölf Monaten auswendig konnte‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Kleriker Ríkinni. Ein Akkusativobjekt fehlt, so dass der TEXT eine Leerstelle bildet. Es gibt aber noch eine zweite Füllung, das Adverb val ‚gut‘, ein Wert des Attributs QUALITÄT. Auch hier besteht wieder ein Constraint zwischen den Werten der QUALITÄT und jenen des AUTORS, der sich als guter Kleriker (klerkr góðr) auszeichnet, denn val/vel ist das Adverb des Adjektivs góðr. Man kann nur mutmassen, worauf diese positiven Werte abzielen. Bei einem guten Kleriker müssen der Lebenswandel und die Bildung eine Rolle spielen, beim Text die Sprache, welche im Falle des Lateinischen mit der Bildung einhergeht. Wie oben (s. Beleg a.) wird sowohl hier als auch bei setja saman (vgl. Kap. II.8.3.a.) das gute Gedächtnis (minnigr) des Autors hervorgehoben. Bei diesem Beleg lässt sich nicht ausschliessen, dass dikta ‚dichten‘ bedeutet und synonym mit versa wäre. Somit handelte es sich um eine Paarformel. Dichten ist aber nichts anderes als das Verfassen einer bestimmten Textsorte, so dass dieser Beleg für die Analyse relevant bleibt.
Der Kernframe des Verbs dikta besteht in der Jóns saga helga aus den Attributen AUTOR und TEXT. Die Autoren sind Geistliche, welche sich durch einen guten Lebenswandel und ein gutes Gedächtnis auszeichnen, worauf die Werte klerkr bzw. munkr, sowie siðugr und minnigr hinweisen. Diese könnten folglich Attribute eines Attributframes bilden. Der TEXT hat den Wert saga. Das Attribut QUALITÄT mit dem Wert val kommt nur bei einem Beleg vor. Beim anderen könnte über Constraints ein ähnlicher Wert erwartet werden, da beide Autoren als gute Geistliche beschrieben werden. Im Kontext befinden sich diverse bekannte Attribute wie AUFTRAGGEBER mit dem Wert biskup, SPRACHE mit dem Wert latína, QUELLE mit dem Wert ellri menn, der STOFF mit dem Wert siðferði und der ZWECK mit dem Wert eptirdœmi. Es kann auf der Grundlage dieser beiden Belege nicht beurteilt werden, ob diese Attribute im Kontext zum Frame von dikta gehören, weil sie als Ergänzungen des Verbs nicht nachgewiesen werden können.
6.2. Laurentius saga biskups
Die Laurentius saga biskups enthält 14 Belege mit dem Verb dikta, die in den beiden Redaktionen ungleich verteilt sind. In der B-Redaktion ist es zehn und die A-Redaktion viermal belegt. Dies liegt u.a. daran, dass es sich um Teile der B-Redaktion handelt, welche in der A-Redaktion Lakunen sind. Im erhaltenen Text der A-Redaktion stehen an den betreffenden Stellen zum Teil andere Lexeme. Lediglich an drei Stellen kommt dikta in beiden Redaktionen parallel vor. Die grösste Gruppe von Belegen mit vier Textstellen, von denen nur eine auch in der A-Redaktion erhalten ist, hat Laurentius selbst als Agens. Eine weitere Gruppe mit zwei Stellen teilen das Thema latínubréf ‚Lateinbrief‘ und das Adverb heiðarliga ‚ehrenvoll‘.
Der erste Beleg von dikta in der Saga überhaupt ist nur in der B-Redaktion erhalten und erinnert stark an den zweiten Beleg aus der Jóns saga helga (vgl. II.6.1.b.): a) „Svo giordizt hann þa framur j klerk dome at dikta ok versa at hann giordi suo skiott vers sem madur taladi skiotazt latinu“ (LSB 10). ‚So wurde er dann herausragend in der Gelehrsamkeit, zu verfassen und Verse abzufassen, dass er so schnell Verse machte, wie ein Mann am schnellsten Latein sprach‘ (Übers. KM). Das Verb dikta ist hier Teil eines Infinitivsatzes. Das Agens ist der Schüler Laurentius, für den das Pronomen hann ‚er‘ im Subjekt des finiten Verbs im Hauptsatz steht. Das Akkusativobjekt bleibt eine Leerstelle, der Wert vers für das Attribut TEXT kann aber aus dem nachfolgenden Nebensatz inferiert werden. Der Fokus liegt wie in der Jóns saga helga auf der geistlichen Gelehrsamkeit, worauf das Lexem klerkdómr ‚Gelehrsamkeit‘ verweist (vgl. Baetke 2002: 328), die sich in der Fähigkeit Texte zu verfassen äussert. Sie geht auch mit der Kunst Verse abzufassen einher, was ebenfalls in der Jóns saga helga der Fall ist (vgl. JSH 86). Dikta ok versa kann tatsächlich als Paarformel aufgefasst werden, weil die Textsorte vers im Kontext genannt wird. Trotzdem kann dikta [vers] als ‚Verse verfassen‘ verstanden werden. Das Konzept DICHTEN stellt lediglich eine Bedeutungsverengung dar, welche in anderen Belegen nicht zutrifft.
Laurentius’ Talent wird auch an einer weiteren Stelle thematisiert, die ebenfalls nur in der B-Redaktion erhalten ist und an der das Verb dikta gleich viermal vorkommt. Bis auf einen Beleg erscheint es immer zusammen skrifa, so dass sich die beiden Verben hier gut kontrastieren werden können:
b) uakti herra Petur bonord uidur skyllda frænkonu kongsins. uar hun austur i Uik. beidizt hann at kongurinn skrifadi henni til. bad hann herra Petur lata skrifa ok dikta brefit. enn sagdizt mundu gefa fyrir jnsiglit. þa kalladi herra Petur Laur(encium) til sin ok bad hann dikta ok skrifa þetta bref aa latinu sem hann kunni bezt. […] Næsta dag eptir syndi hann herra Petre brefit skrifat ok diktat. Geck herra Petur þa til kongsins med brefit ok syndi honum. kongurinn lofadi miog letur ok diktan brefsins. eptir spyriandi huerr giort hefdi. hann svarar honum at islenskur prestur einn hafdi giort. […] kongurinn tok honum blidliga. ok spurdi huort hann ueri sa p(restur) sem herra Petri hafdi dicktat brefit (LSB 14).
Herr Pétr brachte bei einer Verwandten des Königs seine Werbung vor. Sie war im Osten in Vík. Er bat darum, dass der König sie anschreibe. Dieser hiess Herrn Pétr, den Brief schreiben und verfassen zu lassen, sagte aber, dass er sein Siegel dafür geben werde. Dann rief Herr Pétr Laurentius zu sich und hiess ihn, diesen Brief auf Latein zu verfassen und zu schreiben, was er am besten konnte. […] Am nächsten Tag zeigte er Herrn Pétr den geschriebenen und verfassten Brief. Herr Pétr ging dann mit dem Brief zum König und zeigte ihn ihm. Der König lobte die Schrift und den Inhalt des Briefes sehr und fragte, wer ihn gemacht habe. Er antwortet ihm, dass ein isländischer Priester ihn gemacht habe. […] Der König empfing ihn freundlich und fragte, ob er der Priester sei, der für Herrn Pétr den Brief verfasst habe (Übers. KM).
Der erste Beleg ist eine Kausativkonstruktion mit dem Causer Herrn Pétr als Subjekt. Das Agens ist eine Leerstelle und das Akkusativobjekt enthält bréf, also einen Wert für die Attribute TEXTSORTE oder SCHRIFTTRÄGER, der metonymisch zum TEXT verschoben ist. Der zweite Beleg ist in einem Infinitivsatz mit dem Priester Laurentius als Agens, das sich aus dem Akkusativobjekt des Hauptsatzes ergibt, in dem Herr Pétr wiederum Subjekt ist. Wegen der mit dem Kausativ verwandten Konstruktion (AcI) ist die Rollenverteilung hier gleich, mit dem AUFTRAGGEBER Herrn Pétr, dem AUTOR Laurentius und dem Brief als TEXT. Als Viertes kommt die SPRACHE im Präpositionalobjekt mit á latínu ‚auf Latein‘ hinzu. Der dritte Beleg ist das Partizip Präteritum diktat mit einer passiven und perfektiven Funktion als Attribut zu bréf, so dass hier nur die Füllung TEXT vorkommt. Bei diesen ersten drei Belegen kommt dikta immer zusammen mit skrifa vor (vgl. Kap. II.5.2.2. und 5.2.4.b.). Folglich ist Laurentius nicht nur AUTOR, sondern auch SCHREIBER, und bréf ist nicht nur ein Wert für den TEXT, sondern auch für das SKRIPT. Die Attribute AUFTRAGGEBER und SPRACHE hingegen teilen sich die Frames von dikta und skrifa. Beim vierten Beleg schliesslich fehlt das Verb skrifa. Die Frage des Königs nach dem Verfasser lässt darauf schliessen, dass er die Fähigkeit lateinische Briefe zu verfassen höher gewichtet. Die Position des Subjekts bei diesem Beleg besetzt die Relativpartikel sem, welche für Laurentius steht. Das Akkusativobjekt ist wiederum bréf. Daneben gibt es noch ein Dativobjekt mit Herrn Pétr dem AUFTRAGGEBER.
In allen vier Belegen sind die Attribute gleich verteilt: AUFTRAGGEBER, AUTOR, TEXT und SPRACHE. Je nach Diathese werden sie mit unterschiedlichen Kasus realisiert. Wie schon bei skrifa (vgl. Kap. II.5.2.2.) thematisiert, bleibt der INHALT eine Leerstelle und somit eine Präsupposition. Aus rhetorischer Perspektive war Laurentius sicher für die elocutio und womöglich auch für die dispositio verantwortlich, während Herr Pétr sich an der inventio beteiligte.
Die Begabung des Priesters Laurentius ist auch an der dritten Stelle Thema, die nur in der B-Redaktion erhalten ist und zwei Belege von dikta enthält. Der Erbischof will Laurentius’ Talent als Schreiber und Dichter prüfen und sagt:
c) Enn kom til vor ȧ morgin og sẏn oss letr þitt, og ef þú kannt nockud ad dẏckta. Næsta dag epter kom sẏra Laur(entius) til erchi byskups, halldandi ȧ einne rollu̇. Erchi byskupinn leẏt ȧ og lofadi letrid, og mællti, les fyrer oss þad er þu̇ hefur dẏcktad. hann las þar af vers er hann hafdi giort til fru̇ Hallberu̇ abbadẏsar ad Stad. (LSB 16).
„Und komm morgen zu Uns und zeig Uns deine Schrift, und ob du etwas dichten kannst.“ Am nächsten Tag danach kam Priester Laurentius zum Erzbischof und hielt eine Rolle [in seinen Händen]. Der Erzbischof schaute darauf und lobte die Schrift und sagte: „Lies Uns das vor, was du gedichtet hast!“ Er las von ihr den Vers, den er zu Ehren der Äbtissin Hallbera von Staðr gemacht hatte (Übers. KM).
Beide Belege von dikta in obigem Abschnitt sind gleich aufgebaut. Subjekt ist der Priester Laurentius und das Akkusativobjekt ist durch die Pronomina nokkut ‚etwas‘ und þat ‚das‘ besetzt, welche auf den TEXT oder INHALT referieren können. Trotz der wenigen Ergänzungen können einige Leerstellen mithilfe des Kontexts geschlossen werden: Der AUFTRAGGEBER ist der Erzbischof, der SCHRIFTTRÄGER eine Schriftrolle (rolla), die TEXTSORTE ein Gedicht (vers) und der STOFF die Äbtissin Hallbera. Wie zuvor stehen VERFASSEN und SCHREIBEN im Kontrast. Auf letzteres wird mit dem polysemen Lexem letr ‚Buchstabe, Schrift, Inschrift, Geschriebenes, Text, Dokument, Brief‘ (vgl. Fritzner 1886–96: II, 487, ONP letr) verwiesen. In diesem Kontext trifft am wahrscheinlichsten eine Bedeutung ‚Skript‘ zu, dessen Visualität die Verben sýna ‚zeigen‘ und líta á ‚anschauen‘ verdeutlichen.
Die vierte Stelle kommt in beiden Redaktionen vor und zeigt wieder den Kontrast zwischen VERFASSEN und SCHREIBEN. Das Zitat richtet sich nach der A-Redaktion, welche sich nur unwesentlich von der B-Redaktion unterscheidet: d) „var sa bolle oræktur adur aa Holum enn Lauc(encius) let bua hann og diktade sialfur þau vers sem þar eru grafinn aa“ (LSB 93). ‚Diese Schale stand vorher unbeachtet in Hólar, bis Laurentius sie herrichten liess und die Verse selbst verfasste, welche darauf eingeschrieben sind‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Bischofskandidat Laurentius, welcher den Goldschmied Stefán Hauksson eine Inschrift auf einer Schale (bolli) anfertigen lässt (vgl. LSB 93). Der SCHRIFTTRÄGER ist somit aus dem Kontext schon bekannt. Das Akkusativobjekt enthält den TEXT vers, den Laurentius als AUTOR verfasst. Der INHALT dieser Verse ist nicht bekannt. Ein AUFTRAGGEBER erübrigt sich hier, weil Laurentius zwar die Schale und die Inschrift in Auftrag gibt, aber die Verse selbst (sjálfr) verfasst. In welcher Form der Vers an Stefán Hauksson gelangt, wird nicht erzählt, entweder hat Laurentius ihn diktiert oder eine Vorlage für ihn angefertigt oder möglicherweise anfertigen lassen. Das Verfassen muss einen schriftlichen Entwurf also nicht ausschliessen. Dikta kann an dieser Stelle neben ‚verfassen‘auch tatsächlich ‚diktieren‘ bedeuten.
Die bisherigen Belege waren durch den Autor Laurentius verbunden. Die nächste Beleggruppe, welche sich auf zwei Stellen in beiden Redaktionen verteilt, hat immer latínubréf als Thema und bis auf eine Ausnahme das Adverb heiðarliga als weitere Ergänzung. Die erste Stelle hat in den Redaktionen je einen Beleg von dikta, deren Kontexte sich leicht unterscheiden. Das erste Zitat richtet sich nach der A-Redaktion:
e) enn prestar og lærder menn sau brefit fest aa kirkiu hurdina a Holum. og lasu var þetta latinu bref heidarliga diktad. sem audsynazt matte. fraberligr klerkdomur Jons byskups. var þad efni j sogdu brefi. at […] (LSB 114).
Aber die Priester und Gelehrten sahen den Brief an der Kirchentür in Hólar befestigt und lasen ihn. Dieser lateinische Brief war auf ehrenvolle Weise verfasst, was die hervorragende Gelehrtheit Bischof Jóns offenbarte. Der Inhalt in besagtem Brief war, dass […] (Übers. KM).
In diesem Beleg ist dikta passiv, weshalb das Agens eine Leerstelle bildet. Im Subjekt ist das Kompositum latínubréf für den TEXT enthalten, welches zugleich den SCHRIFTTRÄGER bzw. die TEXTSORTE (bréf) und die SPRACHE (latína) impliziert. Daneben gibt es das Adverb heiðarliga als Ergänzung, welches für die QUALITÄT steht. Der Autor des Briefes, Bischof Jón ergibt sich aus dem Kontext. Dieser ist als Absender des Briefes auch zugleich AUFTRAGGEBER. Wie schon beim ersten Beleg von dikta in dieser Saga spielt die Gelehrtheit (klerkdómr) des Autors eine wichtige Rolle. Das Adverb heiðarliga ‚ehrenvoll, Ehre gebend, machend‘ (vgl. Baetke 2002: 239) bezieht sich wahrscheinlich auf diese Gelehrtheit, indem der Brief so formuliert ist, dass es dem Autor Ehre gibt. Dies verdeutlicht auch das Latein, weil die Beherrschung dieser Sprache Bildung erfordert und mit Prestige verbunden ist. Das Lexem efni steht bei diesem Beleg nicht für das Attribut STOFF, sondern für den INHALT, weil der nachfolgende Explikativsatz diesen paraphrasiert.
Die B-Redaktion ist in einzelnen Punkten etwas knapper, wobei der Satz mit dikta bis auf das Demonstrativpronomen þat/þetta und die Graphie gleich wie in der A-Redaktion aussieht, so dass dieselben Füllungen wie oben vorkommen: f) „Enn prestar at Holvm sau brefit aa kirkiv hvrdunne. uar þat latinv bref heidarliga diktat. þat ef<n>e halldanda at […]“ (LSB 114). ‚Aber die Priester in Hólar sahen den Brief an der Kirchentür. Dieser lateinische Brief war ehrenvoll geschrieben und enthielt den Inhalt, dass […]‘ (Übers. KM).
Anders als in der A-Redaktion wird auch die hervorragende Gelehrtheit des Absenders, in deren Zusammenhang das Adverb heiðarliga steht, in der B-Redaktion nicht erwähnt. Die Werte zur QUALITÄT des Textes beschränken jene zur Bildung des AUTORS, so dass das Adverb heiðarliga dafür ausreicht. Wie in der A-Redaktion wird im Folgenden auch das Lexem efni für den INHALT erwähnt.
Die Kollokation dikta bréf heiðarliga rekurriert in der Saga an der zweiten Stelle, die in beiden Redaktionen erhalten ist, sich aber jeweils deutlich unterscheidet. Das lange Zitat aus der A-Redaktion gibt interessante Einblicke in das Verfassen der Briefe:
g) erchibyskup […] let kalla til sin einn af kors brædrum þann sem bedst kvnne latinu bref. at giora og sagdi honum efni: huert vera skylldi. skal sira Eigill vera hia þier og segia þier alla vnnder stodu malsins. gerdi hann meistarinn bod erchibyskups. og var sira Eigill hia honum. annann dag epter synndi kors brodurinn erchibyskupinum brefit. var þad latinu bref heidarliga diktad. og epter so giortt. þackadi erchibyskupinn þeim fyrer diktann brefsins (LSB 128).
Der Erzbischof […] liess einen der Chorherren zu sich rufen, der am besten lateinische Briefe ‚machen‘ konnte, und erzählte ihm die Situation, wie sie sein sollte: „Priester Egill soll bei dir sein und dir die ganzen Umstände der Angelegenheit sagen“. Der Magister führte den Befehl des Erzbischofs aus und Priester Egill war bei ihm. Am folgenden Tag zeigte der Chorherr dem Erzbischof den Brief. Dieser lateinische Brief war auf ehrenvolle Weise verfasst und dementsprechend ausgeführt. Der Erzbischof dankte ihnen für das Verfassen des Briefes (Übers. KM).
Das Verb dikta steht im Passiv und hat mit dem Subjekt latínubréf einen schon bekannten Wert für den TEXT. Daneben gibt es nur noch das oben auch schon besprochene Adverb heiðarliga. Das Agens bildet in der Passivkonstruktion eine Leerstelle. Aus dem Kontext ergibt sich, dass am Verfassen drei Personen beteiligt sind: 1. Der Erzbischof erklärt die Situation (efni), – efni bezieht sich also auch in diesem Kontext nicht auf das Attribut STOFF. 2. Der Priester Egill erklärt die Angelegenheit (mál) und 3. der sehr lateinkundige Chorherr verfasst den Text. Die sprachliche Bildung stimmt hier wieder mit dem Adverb heiðarliga überein. Aus rhetorischer Perspektive waren der Erzbischof und Egill für die inventio und der Chorherr für die dispositio sowie elocutio zuständig. Es wird nicht erwähnt, wer das Skript erstellte. Der Zusatz eptir svá gjǫrt könnte darauf hinweisen, weil gera sowohl Schreiben als auch Verfassen beinhaltet (vgl. Kap. II.9.3.c.), wegen des Passivs ist das Agens aber unbekannt. Dass Egill und der Chorherr zusammen am Verfassen beteiligt waren, wird nochmals verdeutlicht, als der Erzbischof ihnen (þeim) für das Verfassen (diktan) dankt. Der AUFTRAGGEBER ist zwar eine Leerstelle, aber der Kontext nennt eindeutig den Erzbischof als solchen. Zudem zeigt sich, dass der Auftraggeber an der inventio beteiligt ist.
Die B-Redaktion ist in der Erzählung knapper, hat aber zwei Belege für dikta:
h) Liet hann einn þann kors brodur sem bezt kunne latinu at dickta brefit enn sira Eigill skylldi seigia honum efne ok unndir stodu malanna. annann dag eptir syndu þeir honum brefit. var þat latinubref heidarliga dicktat (LSB 128).
Er liess den Chorherrn, der am besten Latein konnte, den Brief verfassen, und Priester Egill sollte ihm die Situation erklären und die Umstände der Angelegenheiten. Am Tag danach zeigten sie ihm den Brief. Dieser lateinische Brief war auf ehrenvolle Weise verfasst (Übers. KM).
Dikta ist hier Teil der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. Causer und AUFTRAGGEBER ist der Erzbischof, Agens und AUTOR der Chorherr und bréf ist Thema und TEXT. Im Relativsatz ist auch die SPRACHE latína erwähnt. Im nachfolgenden Satz erklärt der Priester Egill dem Chorherrn Situation (efni) und Angelegenheiten (mál), d.h. der Erzbischof war hier an der inventio gar nicht oder nur indirekt beteiligt, weil er den Priester Egill sie dem Chorherrn erklären liess. Auch bei diesem Beleg steht efni nicht für den STOFF, aber für etwas Vergleichbares. Im Brief werden nicht überlieferte Stoffe verarbeitet, sondern der Brief bezieht sich als Teil der Kommunikation auf eine Situation, welche in den meisten Fällen eine juristische Angelegenheit (mál) beinhaltet. Das Lexem mál bezeichnet also das Attribut ANGELEGENHEIT, efni hingegen ist weiter als Bezeichnung für die SITUATION zu verstehen. Da der Inhalt des Briefes nicht näher bekannt ist, ist es unmöglich diese beiden Attribute voneinander zu unterscheiden. Es lässt sich nur soweit festhalten, dass beide den Inhalt einschränken.
Der zweite Beleg von dikta im Passiv an dieser Stelle ist gleich strukturiert wie in der A-Redaktion (s.o.), wobei das Agens wahrscheinlich nur der Chorherr ist, weil er dies schon beim ersten Beleg von dikta ist, so dass es sich aus rhetorischer Perspektive vor allem auf die elocutio beschränkt. Entweder verhält sich dies in der A-Redaktion gleich, oder dikta ist dort Teamarbeit und umfasst inventio, dispositio und elocutio. In der B-Redaktion gibt es ebenfalls keine Hinweise darauf, wer das Skript erstellt hat.
Der letzte Beleg lässt sich keiner der beiden Gruppen zuordnen und ist nur in der A-Redaktion vorhanden: i) „bæna hallz madur var hann so mikill. þuiat hann [songh] þridiungh af vorar fru psalltara. er hinn helge. Annselmus erchibyskup hefer diktad“ (LSB 70). ‚Er [= Bischof Auðunn] war ein sehr frommer Mensch, denn er sang ein Drittel des Marienpsalters, welchen der heilige Erzbischof Anselmus verfasst hat‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Erzbischof Anselm von Canterbury, das Akkusativobjekt enthält die Relativpartikel er, welche auf die Konstituente várrar frú psaltara ‚der Psalter unserer Frau‘ im Hauptsatz verweist. Dieser lateinische Marienpsalter wurde im Mittelalter Anselm von Canterbury zugeschrieben (vgl. Grímsdóttir 1998: 328, Anm. 2). Die Attribute INHALT, TEXTSORTE und SPRACHE werden somit als bekannt vorausgesetzt. Da der Text Anselm zugeschrieben wurde, nimmt er die Rolle als AUTOR ein.
Die Valenz von dikta ist in der Laurentius saga biskups relativ eng. Im Zentrum stehen AUTOR als Agens und TEXT als Thema. Die Werte zum AUTOR sind ausschliesslich geistliche Ränge: biskup, erkibiskup, klerkr, munkr und prestr. Jene für den Text teilen den Aspekt der Textsorte: bréf, saga und vers. Der Wert várrar frúar psaltari bezeichnet schon einen bestimmten Text. Diese Vielfalt von Textsorten spricht gegen eine gesonderte Bedeutung ‚dichten‘, die im Deutschen und den modernen skandinavischen Sprachen erst durch eine Bedeutungsverengung entstanden ist. Dikta schliesst das Konzept DICHTEN nicht aus, es stellt lediglich das Verfassen einer bestimmten Textsorte wie z.B. vers dar.
Daneben gibt es die Attribute AUFTRAGGEBER, SPRACHE und QUALITÄT. Auf den AUTRAGGEBER kann einerseits das Dativobjekt verweisen oder in einer Kausativkonstruktion das Subjekt. Auf die SPRACHE verweist das Präpositionalobjekt á e-t mit dem Wert latína. Derselbe Wert tritt auch im Kontext häufig auf. Auf die QUALITÄT verweist mehrfach das Adverb heiðarliga. Zwischen den Werten der Attribute QUALITÄT und AUTOR, sowie zwischen jenen der Attribute SPRACHE und TEXT bestehen Constraints, zumal die Kompetenz des Autors sich auf die Qualität auswirkt und bestimmte Texte in einer bestimmten Sprache geschrieben sind.
Im Kontext wurden viele weitere Attribute (ANGELEGENHEIT, INHALT, SCHRIFTTRÄGER, SITUATION) angetroffen, die sich im Gegensatz zu rita und skrifa nicht als Ergänzung von dikta nachweisen liessen.