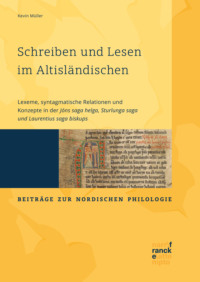Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 18
9.3. Laurentius saga biskups
Die Kollokation gera bréf ist in der Laurentius saga biskups achtmal belegt. Wegen des Umfangs und der unterschiedlichen Diathesen werden die Belege in diesem Kapitel nach Aktivum, Passivum und Mediopassivum geordnet. Die ersten beiden Belege im Aktivum kommen an einer Stelle in der B-Redaktion vor, die in der A-Redaktion wegen einer Lakune fehlt:
a) Geck herra Petur þa til kongsins med brefit ok syndi honum. kongurinn lofadi miog letur ok diktan brefsins. eptir spyriandi huerr giort hefdi. hann svarar honum at islenskur prestur einn hafdi giort (LSB 14).
Herr Pétr ging dann mit dem Brief zum König und zeigte ihn ihm. Der König lobte sehr die Schrift und den Inhalt des Briefes und fragte, wer ihn gemacht habe. Er antwortet ihm, dass ein isländischer Priester ihn gemacht habe (Übers. KM).
Subjekt beider Belege ist der Priester Laurentius. Das Akkusativobjekt ist eine Leerstelle, welche auf das Lexem bréf verweist. Bei diesen beiden Belegen wird besonders deutlich, dass gera ein Hyperonym von skrifa und dikta darstellt, weil Laurentius den Brief geschrieben (skrifat) und verfasst (diktat) hat (vgl. LSB 14).
Der dritte Beleg im Aktivum ist in beiden Redaktionen überliefert, die sich bis auf die Graphie nur darin unterscheiden, dass in der B-Redaktion bei Jón noch der Beiname flæmingi ‚Flame‘ erwähnt wird. Das folgende Zitat stammt aus der A-Redaktion: b) „<E>jnn dagh let erchibyskupinn kalla Laur(encium) til sin so seigiande, hier er bref er Ion hefer giortt epter voru bode“ (LSB 19). ‚Eines Tages liess der Erzbischof Laurentius zu sich rufen und sagte Folgendes: „Hier ist der Brief, den Jón auf Unser Geheiss gemacht hat“‘ (Übers. KM). Gera hat Jón Flæmingi als Subjekt, ein grosser Kleriker (klerkr mikill), Jurist (mikill juristi) und Magister (meistari), der gemäss der Saga in Paris und Orléans studiert hat und Laurentius im Kirchenrecht unterrichtet (vgl. LSB 15, 17). Die Relativpartikel er besetzt das Akkusativobjekt, welche sich auf bréf, als Wert für die Attribute SKRIPT, TEXTSORTE und SCHRIFTTRÄGER im Hauptsatz bezieht. Die BOTSCHAFT ist die Exkommunikation dreier Chorherren, die später in der Saga erwähnt wird, ausserdem sind diese Chorherren die EMPFÄNGER und Laurentius der BOTE (vgl. LSB 20). Dritte Ergänzung ist die Konstruktion eptir boði e-s ‚gemäss jds. Auftrag‘, welche auf den AUFTRAGGEBER und ABSENDER referiert. Das Possessivpronomen várr ‚unser‘ steht hier für den Erzbischof. Jón flæmingi ist demzufolge nicht ABSENDER, sondern der VERFASSER und wahrscheinlich auch SCHREIBER des Briefes. Es ist zu vermuten, dass der Erzbischof an der inventio beteiligt war.
Der vierte Beleg im Aktivum kommt nur in der A-Redaktion vor, während in der B-Redaktion das Akkusativobjekt nicht bréf, sondern áminningar ‚Erinnerungen‘ enthält (vgl. LSB 38): c) „Laur(encius) giordi bref med aa minningum. til Þorualls ad […]“ (LSB 38). ‚Laurentius machte einen Brief mit Erinnerungen an Þorvaldr [Geirsson], dass […]‘ (Übers. KM). Das Verb gera hat Laurentius als Subjekt, der als Priester den Brief wohl selber verfasst und geschrieben haben dürfte. Aus dem Kontext ergibt sich, dass Laurentius auch Absender des Briefes ist. Im Akkusativobjekt befindet sich wieder bréf als Wert die Attribute SKRIPT, TEXTSORTE und SCHRIFTTRÄGER. Darauf folgen zwei Präpositionalobjekte, das erste mit með für die BOTSCHAFT des Briefes mit dem Substantiv áminningar ‚Erinnerungen‘, welches in der B-Redaktion das Akkusativobjekt besetzt, und das zweite mit til für den EMPFÄNGER Þorvaldr Geirsson.
Der fünfte Beleg im Aktivum und der erste Beleg im Passivum kommen an derselben Stelle in der A-Redaktion vor, während in der B-Redaktion dikta anstelle von gera steht (s. a. Kap. II.6.2.h.):
d) erchibyskup […] let kalla til sin einn af kors brædrum þann sem bedst kvnne latinu bref. at giora og sagdi honum efni: huert vera skylldi. skal sira Eigill vera hia þier og segia þier alla vnnder stodu malsins. gerdi hann meistarinn bod erchibyskups. og var sira Eigill hia honum. annann dag epter synndi kors brodurinn erchibyskupinum brefit. var þad latinu bref heidarliga diktad. og epter so giortt. þackadi erchibyskupinn þeim fyrer diktann brefsins (LSB 128).
Der Erzbischof […] liess einen der Chorherren zu sich rufen, der am besten lateinische Briefe machen konnte, und erzählte ihm die Situation, wie sie sein sollte: „Priester Egill soll bei dir sein und die ganzen Umstände der Angelegenheit sagen“. Der Magister [d.h. der Chorherr] führte den Befehl des Erzbischofs aus und Priester Egill war bei ihm. Am folgenden Tag zeigte der Chorherr dem Erzbischof den Brief. Dieser lateinische Brief wurde auf ehrenvolle Weise verfasst und nachher so gemacht. Der Erzbischof dankte ihnen für das Verfassen des Briefes (Übers. KM).
Das Subjekt des ersten Beleges von gera ist mit der Relativpartikel sem besetzt, welche auf den Chorherrn (kórsbróðir) verweist. Akkusativobjekt ist das Kompositum latínubréf ‚Lateinbrief‘ mit den Werten bréf für die Attribute SKRIPT, SCHRIFTTRÄGER und TEXTSORTE sowie latína ‚Latein‘ für die SPRACHE. Dritte Ergänzung ist das Adverb bezt ‚am besten, sehr gut‘, welches auf die QUALITÄT des Textes verweist, wegen des Modifikators latína insbesondere auf die sprachliche. Im Folgenden wird erzählt, wie dieser Chorherr und Priester Egill den Brief schreiben. Egill war vermutlich für die inventio zuständig, da er die Situation (efni) kannte, und der lateinkundige Chorherr insbesondere für die elocutio wie auch die dispositio, obwohl diese zu einem beträchtlichen Teil durch das Formular des Briefes vorgegeben sein musste. Das Verb gera rekurriert noch einmal im Passiv. Das Subjekt ist hier eine Leerstelle, das Partizip gjǫrt (n. Sg.) kongruiert mit latínubréf (n. Sg.), so dass die Leerstelle darauf verweist. Das Agens ist vermutlich dasselbe wie beim ersten Beleg, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass Priester Egill auch dazu gehörte. Gera verweist im Kontrast zu dikta wohl auf die ganze Ausführung des Schreibauftrages inklusive Niederschreiben des Textes, jedoch ohne Siegeln, was erst danach geschieht (vgl. LSB 128). Neben dem SIEGEL ergeben sich aus dem Kontext der ABSENDER und AUFTRAGGEBER Erzbischof, der BOTE Priester Egill, der EMPFÄNGER Bischof Laurentius, die SITUATION (efni) und die ANGELEGENHEIT (mál), wobei die BOTSCHAFT nicht explizit erwähnt wird (vgl. LSB 128f.).
Der zweite Beleg im Passivum ist nur in der A-Redaktion erhalten, weil die B-Redaktion an der Stelle eine Lakune aufweist:
e) <V>oru þa giord bref þau sem fram skillde fara til erchibyskups. Birte herra L(aurencius) fyrer þeim ad betur mundi henta kirkiunne. lærdum og leikum j Hola byskups dæme. at hafa jslenskan byskup. enn norrænan (LSB 140).
Dann wurden die Briefe gemacht, welche an den Erzbischof gehen sollten. Herr Laurentius offenbarte diesem, dass es der Kirche und den Geistlichen und Laien im Bistum Hólar dienlicher sei, einen isländischen als einen norwegischen Bischof zu haben (Übers. KM).
Das Verb gera hat bréf als Subjekt, das Agens bildet eine Leerstelle. Die Werte des Korrespondenzframes sind alle im Kontext vorhanden: Bischof Laurentius als ABSENDER, der Erzbischof als EMPFÄNGER, der Brief als SCHRIFTTRÄGER, SKRIPT und TEXTSORTE sowie der SPRECHAKT birta ‚offenbaren‘ und der INHALT, dass es besser sei, einen isländischen Bischof zu haben, als BOTSCHAFT. Einzig der BOTE bleibt unbekannt. Dieses ‚Machen‘ umfasste wohl wie oben (s. Beleg d.) das Verfassen des Textes (dikta) und das Aufschreiben (skrifa), wofür andere Personen als der Absender zuständig waren (vgl. Ludwig 2005: 150–52). Dazu erwähnt die Laurentius saga biskups in der A-Redaktion, wo die B-Redaktion eine Lakune aufweist, zwei Personen, den Mönch Árni, Sohn des Bischofs Laurentius, und den Diakon Einarr Hafliðason: „var broder Arne hinn bedste klerkur og versificator. […] hafde hann og jncigle byskupsins og *brefa giorder og Einar diakne“ (LSB 103). ‚Bruder Árni war ein sehr guter Kleriker und Versifikator. […] Er hatte auch das Siegel des Bischofs und war für das Briefeschreiben verantwortlich und auch Diakon Einarr‘ (Übers. KM). Das Kompositum bréfagerð ‚Briefeschreiben‘ (vgl. Baetke 2002: 66) ist eine Substantivierung der Kollokation gera bréf. Die separate Erwähnung des Lexems innsigli ‚Siegel‘ zeigt, dass wie oben (vgl. Beleg d.) das Siegel nicht zum Frame gehört. Bruder Árni wird wie sein Vater als sehr guter Kleriker und Dichter beschrieben (hinn bezti klerkr ok versificator), während Diakon Einarr Laurentius beim Aufschreiben von Exzerpten hilft (vgl. LSB 101). Die gute geistliche Bildung ist vor allem bei den Verfassern (vgl. Kap. II. 6.2.) eine häufig erwähnte Eigenschaft.
Der letzte Beleg von gera bréf steht im Mediopassivum und kommt ebenfalls in dieser Form nur in der A-Redaktion vor, während in der B-Redaktion ferð ‚Reise‘ als Akkusativobjekt von gera steht: f) „sijdan giordist. Laur(encius) bref heima aa Modru vollum. og for til Muka þverar“ (LSB 39). ‚Dann machte sich Laurentius einen Brief zu Hause in Mǫðruvellir und reiste nach Munkaþverá‘ (Übers. KM). Subjekt von gerask ist Priester Laurentius und bréf das Akkusativobjekt. Beim Mediopassiv ist nicht immer klar, ob das Subjekt Agens wie im Aktiv oder Patiens bzw. Thema wie im Passiv ist (vgl. Faarlund 2004: 126f.). Die Endung -sk, -st, -z des Mediopassivs, welche durch Enklise der Reflexivpronomina sik (Akk.) oder sér (Dat.) entstanden ist, kann für einen Akkusativ oder Dativ stehen. Wenn schon ein Akkusativobjekt wie im obigen Zitat vorhanden ist, muss die Endung also für einen Dativ stehen, in dem Sinne, dass Laurentius den Brief ‚für sich machte‘. In der normalisierten Edition wird gjörðiz hingegen zu gjörði korrigiert (vgl. Grímsdóttir 1998: 279). Im Vergleich mit den obigen Belegen, ist es am wahrscheinlichsten, dass Laurentius als Priester den Brief verfasste und selbst schrieb, da ihm noch keine Sekretäre wie später als Bischof zur Verfügung standen, so dass die Mediopassivendung entweder als Dativ interpetiert werden darf, in dem Sinne dass Laurentius für sich den Brief ‚machte‘, oder es handelt sich wie von Grímsdóttir (1998: 279, Anm. 1) angenommen und einen Verschrieb. Wie in der Saga weiter zu lesen ist, vereint bei diesem Beleg Priester Laurentius die Attribute ABSENDER, VERFASSER, SCHREIBER und auch BOTE. Das Mediopassiv verweist möglicherweise auf diese Tatsache, dass der VERFASSER und SCHREIBER Laurentius den Brief für den ABSENDER Laurentius machte. Diese Rollenverteilung entspricht gera bók e-m in der Jóns saga helga, wo das Dativobjekt auf den AUFTRAGGEBER verweist. Dem Kontext ist zu entnehmen, dass die BOTSCHAFT des Briefes ein Urteil (órskurðr) ist und der EMPFÄNGER offen bleibt, worauf das Adjektiv opit ‚offen‘ hinweist (vgl. LSB 39).
Die Kollokation gera bréf ist Teil des Korrespondenzframes, deckt aber nicht alle dazu gehörigen Handlungen ab. Beim Agens kann nicht in allen Fällen entschieden werden, ob die Person den Text nur verfasste oder ihn auch schrieb. Die Werte sind alles geistliche (klerkr, kórsbróðir, prestr) und akademische Titel (juristi, meistari). Es handelt sich also um Kleriker und Akademiker, jedoch nicht um hohe Geistliche wie Bischöfe oder Erzbischöfe, welche i.d.R. als Absender und Auftraggeber agieren. Wahrscheinlich beinhaltete das ‚Machen‘ sowohl Verfassen (dikta) als auch Schreiben (skrifa). Mit Verfassen ist vor allem die elocutio gemeint, weil die dispositio durch das Briefformular und die inventio durch den Absender in der Regel vorgegeben waren. Das Agens von gera bréf ist also gleichzeitig VERFASSER und SCHREIBER. Für die Benennung des Attributs wird deshalb das Kopulativkompositum VERFASSER-SCHREIBER gewählt. Das Siegeln kann in zwei Belegen als Bestandteil der Handlung sicher ausgeschlossen werden. Das Lexem bréf als Thema ist somit ein Wert für das Attribut TEXT, impliziert aber immer noch ein SKRIPT und einen SCHRIFTTRÄGER. Das Dativobjekt steht für den Auftraggeber mit dem Wert prestr. Die BOTSCHAFT mit dem Wert áminning im Präpositionalobjekt með e-m und der EMPFÄNGER im Präpositionalobjekt til e-s kommen nur in einem Beleg als Füllung vor. In einem weiteren ist zusätzlich die QUALITÄT mit dem Wert bezt erwähnt.
Der Kernframe von gera bréf besteht also aus dem VERFASSER-SCHREIBER und dem TEXT. Daneben gibt es noch die Attribute AUFTRAGGEBER, BOTSCHAFT, EMPFÄNGER und QUALITÄT als Ergänzungen. Im Kontext lassen sich weitere für die Korrespondenz charakteristische Attribute wie ABSENDER, ANGELEGENHEIT, AUFTRAG, BOTE, SIEGEL, SPRACHE und STOFF finden, die aber nicht zum Frame von gera bréf gehören.
9.4. Der Frame von gera
Die Kollokationen gera bók und gera bréf sind zu trennen, weil sie sich in diversen Punkten unterscheiden, die hauptsächlich vom Konzept des Themas abhängig sind. Erstere ist dreimal in der Jóns saga helga und einmal in der Sturlunga saga belegt. Zwischen den beiden Sagas gibt es deutliche Unterschiede. In der Jóns saga helga verbindet gera bók e-m die Attribute SCHREIBER (ritari) mit dem Wert prestr, SCHRIFTTRÄGER mit dem Wert bók und AUFTRAGGEBER mit dem Wert prestr. Im Gegensatz zu rita bók e-m umfasst gera bók mehr als nur die Erstellung des Skripts, sondern die Produktion des ganzen Kodex. Die Situation in der Sturlunga saga ist anders. Die Werte klerkr und vitr sind jenen für das Attribut VERFASSER in der Laurentius saga biskups und Jóns saga helga ähnlich. Im Gegensatz zur Jóns saga helga sind auch STOFF und TITEL des Buches im Kontext erwähnt, so dass der inhaltliche Aspekt stärker gewichtet wird. Deshalb verbindet gera bók in der Sturlunga saga die Attribute VERFASSER und TEXT. Da es sich um Einzelbelege handelt, bleibt offen, ob diese Konzepte konventionell sind. Gera bók ist auf jeden Fall in seiner Bedeutung breiter als rita bók, bei welchem es nur um die Erstellung des Skripts geht. Bei dieser Kollokation wäre es nötig, weitere Belege aus anderen Texten einzubeziehen und den Frame von bók genauer zu analysieren. Da im ONP (gera) die Kollokation nicht gesondert aufgeführt wird, sind zusätzliche Belege ausserhalb des untersuchten Korpus schwierig zu finden. Die Alexanders saga liefert folgenden Beleg für gera bók zusammen mit setja saman:
Nv bar sva til at Aristotiles meistare hans oc fostr faðer hafði gengit vt af herbergi síno. þar er hann hafði gort eina boc af iðrott þeire er dialectica heitir alatino. en þręto boc er kolloð anorøno. Þatt matti oc sia ahonom hverso mikla stvnd hann hafði lagt aboc þa er hann hafði þa saman sett. oc hverso litt hann hafði meðan annars gætt (Jónsson 1925: 3).
Nun trug es sich so zu, dass Aristoteles, sein Meister und Ziehvater, aus seinem Zimmer gegangen war, wo er ein Buch von der Kunst gemacht hatte, die auf Latein dialectica heisst, aber ‚Streitbuch‘ auf Nordisch genannt wird. Man konnte ihm auch ansehen, wieviel Zeit er für dieses Buch eingesetzt hatte, als er es verfasst hatte, und wie wenig er sich um anderes gekümmert hatte (Übers. KM).
Subjekt von gera bók ist Aristoteles. Neben ihm und bók im Akkusativobjekt gibt es noch eine dritte Ergänzung af íþrótt ‚von der Kunst‘, die wieder auf das Attribut STOFF verweist. Somit ist die Valenz identisch mit dem Beleg in der Sturlunga saga. Gera wird im Folgenden durch setja saman substitutiert, was auf eine zumindest partielle Synonymie hinweist. Somit ist Aristoteles als Verfasser aufzufassen und bók als Text. Es kann bei diesem Beleg nicht nachgewiesen werden, ob gera bók auch Schreiben beinhaltet.
Dieser Fall trifft sehr wahrscheinlich im Prolog der Íslendingabók zu, der u.a. auch in Glauser (2010: 313f.) und Tómasson (2012: 243f.) diskutiert wird. Gera wird dort durch skrifa substituiert. Beide Verben haben das gleiche Subjekt, den Verfasser Ari Þorgilsson (1068–1148), und das gleiche Akkusativobjekt bók, einmal die Vorlage und einmal das vorliegende, d.h. Ari schrieb sein eigenes Werk ab und liess dabei einige Teile weg. Dies impliziert, dass er auch die Vorlage schrieb, die er ‚machte‘. Gera bók umfasst in der Íslendingabók also sowohl Schreiben als auch Verfassen. Bei diesem Text muss allerdings bedacht werden, dass er nur in zwei Handschriften aus dem 17. Jh. erhalten ist (AM 113a und b fol.). Wie genau diese die verlorene aus der Zeit um 1200 stammende Vorlage wiedergeben, kann nicht überprüft werden (vgl. Benediktsson 1993: 332). Andere Belege sind aus diesem Grunde vorzuziehen.
Obwohl die Beleglage dünn ist, spricht vieles dafür, dass gera bók die Konzepte SCHREIBEN und VERFASSEN beinhaltet und als Hyperonym zu den verschiedenen verba scribendi betrachtet werden kann. Bei der Jóns saga helga kann dies nicht überprüft werden, weil nicht bekannt ist, was für ein Buch der Schreiber machte bzw. schrieb. Das Agens ist somit VERFASSER und SCHREIBER und das Thema der TEXT. Das Dativobjekt verweist auf den AUFTRAGGEBER und das Präpositionalobjekt af e-u auf den STOFF. Die Ergänzungen und Attribute unterscheiden sich somit nicht von den übrigen verba scribendi.
Das Konzept von gera bréf ist ebenfalls breiter als jenes von rita/ríta/skrifa bréf, weil es sowohl das Verfassen des Brieftextes (dikta) – insbesondere die elocutio – als auch das Schreiben des Briefskriptes umfasst (skrifa). Das Agens vereint also zwei Aufgaben, jene des Schreibers und des Verfassers, und wird deshalb VERFASSER-SCHREIBER genannt. Diese Aufgaben können von einer oder mehreren Personen ausgeführt werden. Die Werte für dieses Attribut sind ábóti, juristi, klerkr, kórsbróðir, meistari, prestr, allesamt Lexeme, welche für den geistlichen oder akademischen Rang der Person stehen. Es handelt sich aber hauptsächlich nicht um hohe Geistliche wie Bischöfe oder Erzbischöfe, welche in der Regel als Absender und Auftraggeber agieren. Das Thema enthält das Lexem bréf als Wert für den TEXT, welches teilweise durch die Genitivattribute latínu als Wert für die SPRACHE und einmal biskupa als Wert für den ABSENDER determiniert ist. Neben dem Kernframe mit den Attributen VERFASSER-SCHREIBER als Agens und TEXT als Thema gibt es noch weitere Attribute als Ergänzungen: Ein Wert für die QUALITÄT ist einmal mit dem Adverb bezt belegt, das wahrscheinlich in Beziehung zum Modifikator latínu von bréf steht, so dass sich die Qualität auf die elocutio und Graphie in der lateinischen Sprache bezieht. Nur in je einem Beleg der Laurentius saga biskups kommen typische Attribute des Korrespondenzframes wie der EMPFÄNGER mit der Präposition til und die BOTSCHAFT mit der Präposition með + Dat. als Ergänzung vor. Im Kontext sind zudem diverse weitere Attribute aus dem Korrespondenzframe belegt: ABSENDER, BOTE, ANGELEGENHEIT, STOFF, AUFTRAG und SIEGEL. Der Absender kann in einer Kausativkonstruktion als Causer eingebunden werden, wie der in Spurkland (2000: 55) zitierte Beleg aus der Óláfs saga helga der Heimskringla demonstriert: „Hafði hon látit gera bréf þessi ok látit innsigla“ (Jónsson 1911: 342). ‚Sie [= Königin Emma] hatte diese Briefe machen und siegeln lassen‘ (Übers. KM). Obwohl das Siegel ein Bestandteil des Briefes ist, kann sowohl in den eingangs erwähnten Belegen als auch in der Laurentius saga biskups ausgeschlossen werden, dass der Verfasser-Schreiber siegelt. Dies dürfte wohl auch für den Beleg bei Fritzner gelten. Die Nähe zum Korrespondenzframe erklärt sich durch den Attributframe des Lexems bréf, zu dem diese Attribute gehören. Wie gera bók fungiert gera bréf als Hyperonym von rita/ríta, skrifa oder dikta bréf. Die Unterschiede in den Frames von gera bók und gera bréf beruhen auf den unterschiedlichen Werten im Attributframe TEXT. Der Brief gehört in die Korrespondenz, so dass gera bréf diverse Attribute mit den Korrespondenzframes von rita und skrifa teilt. Um eine klarere Antwort auf das Konzept zu erhalten, müssten neben weiteren Belegen der Kollokation gera bók auch der Frame des Lexems bók näher analysiert werden.
10. Der Wortschatz des Schreibens und seine Frames
In der Einleitung dieses Teils (Kap. II.1.) wurde eine Vielzahl möglicher Frameattribute der verba scribendi zusammengestellt, welche an dieser Stelle noch einmal aufgenommen werden sollen: Beim Schreiben sind diverse Personen bzw. Rollen involviert, denen die Attribute SCHREIBER, KOMPILATOR, KOMMENTATOR, AUTOR und AUFTRAGGEBER zugeordnet werden können. Zudem kommen körperliche Aspekte der Personen ins Spiel: HAND, AUGE, OHR, ZUNGE und GEDÄCHTNIS. Neben den Personen sind diverse Materialien involviert: SCHREIBWERKZEUG, SCHREIBMATERIAL und SCHRIFTTRÄGER. Das Resultat der Schreibarbeit äussert sich im SKRIPT. Dieses visualisiert einen TEXT, der aus einem INHALT und einer TEXTSORTE in einer SPRACHE und SCHRIFT besteht, und sich aus einem in einer QUELLE überlieferten STOFF zusammensetzt.
Im Laufe der Analyse liessen sich von diesen zahlreichen möglichen Attributen nicht alle im vorliegenden Korpus nachweisen, oder mussten zum Teil revidiert werden. Im Gegenzug sind einige neue hinzugekommen.
Bei den personenbezogenen Attributen fehlte durchweg die Rolle des KOMMENTATORS, was sich durch den Inhalt des Korpus erklärt, das zwar Kommentare enthält, aber keine Belege für kommentierendes Schreiben aufweist. Zwischen den Rollen AUTOR und KOMPILATOR kann keine klare Grenze gezogen werden. Es gibt zwar Indizien, dass Texte aus Quellen übernommen werden, es bleibt aber offen, wie stark der Autor oder Kompilator den Text bearbeitete. Im Mittelalter, d.h. im Entstehungszeitraum der untersuchten Texte, war der Umgang mit Texten beim Abschreiben relativ frei. Umgekehrt wurde von einem Autor keine Originalität erwartet. Der heutige Terminus Autor ist diesbezüglich zu sehr von modernen Vorstellungen beeinflusst, so dass sich an dieser Stelle der neutralere Begriff Verfasser empfiehlt. Der Verfasser kann jedoch klar vom Schreiber unterschieden werden. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass beide Rollen von derselben Person wahrgenommen wurden. Das Schreiben und Verfassen im untersuchten Korpus geschieht meistens im Auftrag einer weiteren Person, so dass ein AUFTRAGGEBER hinzukommt. Bei dieser Rolle bleibt offen, wie stark sie in die Entstehung des Textes involviert war. Es lassen sich anhand dieser Rollen drei Attribute festhalten: SCHREIBER, VERFASSER und AUFTRAGGEBER.
Eng verbunden mit der Person des Schreibers ist der Körper, der sich im vorliegenden Korpus nicht nachweisen liess. Es konnten aber ausserhalb des Korpus Belege mit den Körperteilen Hand (hǫnd) und Finger (fingr) gefunden werden. Es mag zunächst überraschen, dass gerade die so selbstverständlichen potentiellen Attribute wie die am Prozess des Schreibens beteiligten Körperteile keine Erwähnung finden. Dies ist aber gerade durch ihre Selbstverständlichkeit zu erklären, wodurch sich für diese Attribute entsprechende Defaultwerte inferieren lassen: Es ist anzunehmen, dass in der Regel mit der Hand geschrieben wurde, was Belege tatsächlich nachweisen. Eine mögliche Abweichung vom Default ist das Schreiben mit dem Finger, das in diesem Fall explizit Erwähnung finden kann. Zum Schreiben gehören aber noch weitere Körperteile, denn das Geschriebene wurde mit dem Auge gesehen, das Diktat mit der Zunge gesprochen, mit dem Ohr gehört und im Gedächtnis gespeichert. Beim Abschreiben sah das Auge zudem die Vorlage, und ihr Text wurde ebenfalls ins Gedächtnis aufgenommen. Ohne diese Körperteile wäre der Schreibprozess nicht denkbar, so dass sie als impliziter Teil eines stereotypen Konzepts aufgefasst werden können. Die einzigen nachweisbaren Werte für ein Attribut KÖRPERTEIL bleiben, wie schon erwähnt, hǫnd und fingr. Das Gedächtnis wird weiter unten noch behandelt.
Die materielle Situation des Schreibens zeigt ein ähnliches Bild. Im vorliegenden Korpus konnten lediglich Werte und Ergänzungen für den SCHRIFTTRÄGER belegt werden. Ausserhalb des Korpus waren vereinzelte Werte für die Attribute SCHREIBWERKZEUG und SCHREIBMATERIAL vorhanden. Dieses häufige Fehlen erklärt sich ebenfalls durch ein stereotypes Konzept: Dazu gehören zum SCHREIBMATERIAL die Werte bókfell ‚Pergament‘ und blek ‚Tinte‘. Anhaltspunkte dafür geben die häufig belegten Werte des Attributs SCHRIFTTRÄGER wie bók ‚Buch‘, bréf ‚Brief‘, kvaterni ‚Heft‘, und rolla ‚Rolle‘, die aus Pergament bestehen und mit Tinte beschrieben sind. Die Werte kefli ‚Holzstäbchen‘ und vaxspjald ‚Wachstafel‘ implizieren hinegen andere Werte wie Holz und Wachs (vax). Zwischen SCHRIFTTRÄGER und SCHREIBMATERIAL besteht folglich ein Werteconstraint. Constraints legen auch die entsprechenden Werte Feder (penni), Griffel oder Messer für das Attribut SCHREIBWERKZEUG fest.
Ein beim Schreiben so zentrales Attribut wie die SCHRIFT liess sich im Korpus ebenfalls nicht nachweisen. Gerade der Erste grammatische Traktat, welcher die Verschriftung der Sprache reflektiert, füllt diese Lücke. Darin werden diverse Werte für die Attribute SCHRIFTSYSTEM und GRAPHIE genannt. Diese sind als Attributbezeichnungen vorzuziehen, weil das Substantiv Schrift semantisch zu breit ist. Das Attribut SPRACHE mit den Bezeichnungen mál und tunga lässt sich nicht nur im Ersten grammatischen Traktat, sondern auch im vorliegenden Korpus mit den beiden Werten norrœnn ‚nordisch‘ und latína ‚Latein‘ nachweisen. Der Wert konnte sonst in den meisten Fällen über den Constraint mit dem TEXT inferiert werden, weil bestimmte Texte in bestimmten Sprachen geschrieben sind.
Neben diesen beiden Sprachen gab es im mittelalterlichen Skandinavien zwei parallele Schriftsysteme: das lateinische Alphabet und die Runen. Diese wurden laut Spurkland (1994, 2004, 2005) zumindest im Norwegischen lexikalisch getrennt. Demzufolge haben Verben wie rita, ríta oder skrifa einen Defaultwert latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘, rísta und rista hingegen rúnar ‚Runen, Schriftzeichen‘, wobei dieses Schriftsystem im vorliegenden Korpus und auch in anderen altisländischen Texten im Frame von rísta nicht sicher nachgewiesen konnte. Die beiden Schriftsysteme waren zudem an zwei Formen der Schriftlichkeit, runacy und literacy, gekoppelt, die laut Spurkland auch entsprechene Schreibmaterialien und Schriftträger implizierten. Dies liess sich besonders bei rísta mit dem häufig erwähnten Wert kefli für den SCHRIFTTRÄGER nachweisen. Das Verb fokussiert dabei viel eher auf einen technischen Aspekt des Schreibens (schnitzend schreiben). Darauf deutet auch das Verb grafa ‚gravieren‘ mit der Metallschale (bolli) als Schriftträger hin. Dies gilt auch für skrifa, das neben ‚schreiben‘ auch ‚malen‘ bedeuten kann. Beides wird mit ähnlichen Werkzeugen und Materialien ausgeübt. Rísta und rita sind primär in ihrer Technik zu unterscheiden, die aber mit einer stereotypen Vorstellung der Schriftlichkeit verbunden war.
Das Auftreten solcher Stereotypen und Constraints bei den verba scribendi erklären die häufigen Leerstellen der Attribute KÖRPERTEIL, SCHREIBMATERIAL, SCHREIBWERKZEUG und SCHRIFTSYSTEM. Im stereotypen Konzept richtet der Einsatz des Körpers sich, wie oben beschrieben, nach den strukturellen Invarianten: Die Hand führt das Schreibwerkzeug, das Auge sieht das Skript etc. Die Werte der Attribute SCHREIBMATERIAL und SCHREIBWERKZEUG können über die Constraints mit dem Attribut SCHRIFTTRÄGER inferiert werden, für das meistens Werte vorhanden sind. Für das SCHRIFTSYSTEM ist bei den verba scribendi dieses Korpus ausser rísta der Defaultwert latínu stafróf anzunehmen. Dies bestätigen auch die meisten erhaltenen Handschriften aus dieser Zeit.
Eng verbunden mit dem Schriftsystem ist die GRAPHIE, für die im untersuchten Korpus ebenfalls nur wenige Werte zu belegen sind. Im Ersten grammatischen Traktat sind sie im Attributframe einem Attribut RICHTIGKEIT oder GESTALT (líkneski) einzuordnen. Der Wert gullstafr ‚Goldbuchstabe‘ passt hingegen zu einem Attribut FARBE, fagr ‚schön‘ wiederum zu einem Attribut ÄSTHETIK. Es ist auch bei der Graphie anzunehmen, dass es eine stereotype Vorstellung eines schönen, mit schwarzer Tinte korrekt geschriebenen Skripts gab. Entscheidend sind aber auch hier wieder Werteconstraints mit den Attributen SCHRIFTTRÄGER, TEXTSORTE, SCHREIBER oder AUFTRAGGEBER. Eine Wachstafel unterscheidet sich graphisch vom Kodex, der Brief vom Psalter. Die Begabung des Schreibers und das Vermögen des Auftraggebers sind in der Graphie ebenfalls sichtbar.
Während die bisher diskutierten Attribute der verba scribendi recht stark Stereotypien, strukturellen Invarianten und Constraints unterworfen sind, weisen die folgenden eine grössere Variabilität auf, was auch erklärt, dass sie häufiger als Füllung vorkommen. Das Produkt des Schreibens ist der Text, der sich visuell im Skript äussert. Für diese beiden abstrakten modernen Konzepte gibt es im vorliegenden Korpus keine Bezeichnungen. Am nächsten an das Skript kommt noch letr, welches aber auch andere Bedeutungen wie ‚Brief‘ oder ‚Buchstabe‘ hat und auch auf die Graphie zutrifft. Für Texte gibt es lediglich individuelle Bezeichnungen wie psaltari ‚Psalter‘ oder heilagar ritningar ‚Heilige Schrift‘. Weil das Verfassen und Schreiben in diversen mittelalterlichen Sprachen sowohl konzeptuell als auch lexikalisch getrennt werden, sind auch die Resultate dieser Handlungen zu unterscheiden. Entsprechend muss es die Attribute TEXT und SKRIPT geben. Die Werte die an der zu erwartenden Stelle vorkommen, lassen sich aber leichter anderen Attributen wie SCHRIFTTRÄGER, TEXTSORTE oder INHALT zuweisen, die ebenfalls zum Frame des Schreibens gehören und metonymisch verschoben werden. So wird der Schriftträger zum Skript oder die Textsorte zum Text. Sie fungieren zudem als Attribute in den jeweiligen Attributframes, entsprechend haben Text und Skript einen Inhalt, gehören zu einer Textsorte und befinden sich auf einem Schriftträger.
In den Texten sind ausserdem Stoffe (efni) verarbeitet, welche in Quellen überliefert sind. Entsprechend gibt es auch die Attribute STOFF und QUELLE, für die mehrfach Werte belegt sind. Die Werte des STOFFS lassen sich semantisch nicht eindeutig vom INHALT abtrennen, weil der Inhalt des Textes auf einen umfangreicheren Stoff zurückgeht. Für das Attribut QUELLE lässt sich keine spezifische Bezeichnung nachweisen. Der Attributframe besteht hier aus verschiedenen Elementen wie Autor, Autorität, Textsorte, Vorlage, Zeuge oder auch dem Gedächtnis (minni) des Verfassers selbst. In diesem Zusammenhang kommt ein neues Attribut TEIL (hlutr) hinzu: Der Stoff aus den Quellen wird in Teile zerlegt und diese dann im Text neu zusammengefügt. Sie sind inhaltlicher oder schriftlicher Natur, je nach dem, ob der Text verfasst oder abgeschrieben wird.