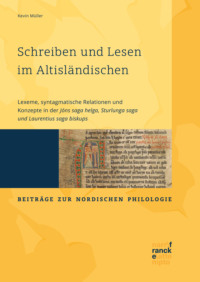Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 17
8.4. Der Frame von setja saman
Die Zusammensetzung der Attribute im Frame von setja saman ist in den drei Sagas unterschiedlich. Gemein haben aber alle den Kernframe, der aus dem postulierten Attribut AUTOR als Agens und dem TEXT als Thema besteht. Da gerade in der Zusammensetzung der Attribute und in den Bezeichnungen gewisse Unsicherheiten bestehen, lohnt es sich in dieser Schlussbetrachtung des Frames weitere Belege einzubeziehen. Es handelt sich um eine Auswahl von Belegen aus dem ONP (setja) und aus der Sekundärliteratur. Das Attribut AUTOR als Agens hat die Werte biskup ‚Bischof‘, bróðir ‚Bruder‘, klerkr ‚Kleriker‘, mælskumaðr ‚Redner‘, munkr ‚Mönch‘, prestr ‚Priester‘, skáld ‚Skalde‘ und sturlungr ‚Sturlunge‘. Im ONP (setja) sind fünf Autoren Subjekt von setja saman: Alexanders Lehrmeister (meistari) Aristoteles in der Alexanders saga (vgl. Jónsson 1925: 3), König (konungr) Salomon in Stjórn (vgl. Unger 1862: 577), Snorri Sturluson in der Uppsala-Edda (vgl. Grape et al. 1977: 1), sowie die Mönche (munkr) Oddr, der Verfasser der Ólafs saga Tryggvasonar (vgl. Jónsson 1932: 261), und Gunnlaugr, der Verfasser der Jóns saga helga (vgl. Halldórsson 1958–2000: III, 57). Glauser (2010: 322) nennt mit „meistari Humerus“ aus der Vilhjálms saga sjóðs (vgl. Loth 1964: 3) und „Meistare Uirgilius“ aus der Jarlmanns saga ok Hermanns (Loth 1963b: 3) noch zwei weitere bekannte Autoren. Die Werte munkr und sturlungr kommen also auch an anderer Stelle vor, hinzukommen noch die Werte meistari und konungr, welche die Reihe von Bezeichnungen ranghoher und gebildeter Personen erweitern. Die Bildung wird beispielsweise bei Gunnlaugr mit sœmiligr kennimaðr ‚ehrenvoller Lehrer‘ und góðrar minningar ‚guten Gedächtnisses‘ besonders hervorgehoben.
Dabei spielen nicht nur der geistliche oder soziale Rang und die Bildung der Person eine Rolle, sondern auch die rhetorische und dichterische Begabung. Diese äussert sich im Attribut GEWANDTHEIT, welches in der Laurentius saga biskups als Präpositionalobjekt með mikilli snild ergänzt wird, in dem das Lexem snild als Bezeichnung für das Attribut und der Wert mikill ‚gross, viel‘ enthalten sind. Dieses Attribut lässt sich in ähnlicher Form auch in anderen Texten nachweisen: In der Ólafs saga Tryggvasonar kommt das Präpositionalobjekt með mikilli málsnild (vgl. Jónsson 1932: 261) ‚mit grosser sprachlicher Gewandtheit‘ oder með rǫksamligum latínudikti (vgl. Halldórsson 1958–2000: III, 57) ‚mit erfahrenem lateinischen Stil‘ vor. In der Sigurðar saga þǫgla (vgl. Loth 1963a: 95) sind die Präpositionalobjekte með skjótu máli ‚mit schneller Sprache‘ und með hagligum orðum ‚mit kunstvollen Worten‘ bezeugt. Die Werte deuten alle auf die sprachlichen und ästhetischen Aspekte der elocutio hin, so dass ELOCUTIO als Bezeichnung des Attributs besser zutrifft.
Das Attribut TEXT als Thema hat die Werte bók ‚Buch‘, bréf ‚Brief‘, saga ‚Geschichte‘, sǫgubók ‚Geschichtenbuch‘. Im Kontext sind jeweils weitere Attribute des TEXT-Frames enthalten wie INHALT, SCHRIFTTRÄGER, SPRACHE oder TEXTSORTE. Das Thema verweist auch auf das Attribut TEIL, welches durch das Lexem hlutr bezeichnet wird. Dieses fehlt in der Sturlunga saga, es lässt sich aber auch in anderen Texten nachweisen wie etwa in der Ólafs saga Tryggvasonar (vgl. ONP setja, Halldórsson 1958–2000: III, 57). Um die Attribute TEIL und TEXT auseinanderhalten zu können, kann das Präpositionalobjekt í e-t zusätzlich auf den TEXT verweisen, wie ein Beleg der Laurentius saga biskups demonstriert hat.
Die Teile, welche im Text zusammengefügt werden stammen aus Quellen, auf die das Präpositionalobjekt eptir e-u verweist. Das Attribut QUELLE hat die Werte annálar ‚Annalen‘, bréf ‚Brief‘, forsǫgn ‚Aussage‘, frásǫgn ‚Erzählung‘ und ráð ‚Bestimmung‘. Wie das Attribut TEXT hat auch die QUELLE einen Attributframe mit verschiedenen weiteren Attributen wie AUTOR, AUTORITÄT, SCHRIFTTRÄGER, TEXTSORTE und ZEUGE, von denen eines im Präpositionalobjekt erscheinen kann. Ein ganz ähnliches Bild gibt ein Beleg im ONP (setja) aus der Sigurðar saga þǫgla mit den beiden Präpositionalobjekten eptir fornkvæðum eðr frœðimǫnnum ‚gemäss alten Gedichten und Gelehrten‘ und eptir fornum bókum ‚gemäss alten Büchern‘ (vgl. Loth 1963a, 95). Die Werte fornkvæði ‚alte Gedichte‘, frœðimenn ‚Gelehrte‘, und fornar bœkr ‚alte Bücher‘ lassen sich wieder den Attributen des Attributframes zuordnen wie TEXTSORTE, AUTOR oder SCHRIFTTRÄGER. Im ONP (setja) gibt es jedoch einen Beleg aus der Uppsala-Edda, bei dem „eptir þeim hætti sem her er skipat“ (Grape et al. 1977: 1) „in der Weise, wie es hier angeordnet ist“ (Häny 2011: 5) nicht auf die Quelle verweist, sondern darauf, auf welche Weise (háttr) der Text angeordnet (skipat) ist. Diese Anordnung wird anschliessend in der Uppsala-Edda beschrieben. Das Präpositionalobjekt steht also für ein Attribut DISPOSITIO, wenn man den entsprechenden Terminus aus der Rhetorik für die Anordnung des Textes verwendet. Bei der Konstituente eptir þeim hætti sem muss beachtet werden, dass es sich um eine Konstruktion zur Einleitung eines Komparativsatzes handelt. Aus diesem Grund ist sie syntaktisch einer Modaladverbiale oder einem Modaladverb bzw. einer thematischen Rolle Modus gleichzustellen, wie sie auch in der Jóns saga helga in ähnlicher Weise (meðr þessum hætti) bei rita/ríta vorkommt (vgl. Kap. II.3.1.2.d.) und auf das Attribut QUALITÄT bzw. GRAPHIE referiert, welches sonst als Modaladverb ergänzt wird. Bei setja saman kann man am Attribut DISPOSITIO festhalten, weil sich die Art und Weise in der Anordnung des Textes äussert.
Der Beleg in Mundals (2012: 223) Analyse aus der Grettis saga enthält genau ein Adverb, welches diese Funktion erfüllt: „[…] þó at sagan sé ófróðliga saman sett, en þeir þættir eigi ritaðir, sem merkiligir þykkja“ (Jónsson 1936: 290). ‚[…] obwohl die Geschichte auf inkompetente Weise zusammengesetzt ist, denn die Erzählungen sind darin nicht aufgeschrieben, die für bedeutend gehalten werden‘ (Übers. KM). Das Adverb ófróðliga ‚inkompetent‘ steht in Zusammenhang mit den fehlenden Erzählungen als Resultat einer inkompetenten dispositio und inventio, da das Fehlen auch daher rühren kann. In diesen modalen Bereich kann zusätzlich das Attribut ELOCUTIO eingeordnet werden, dessen Werte Adjektive sind, die in der Konstruktion með dikt/mál/snild vorkommen, deren Substantive wiederum die Bezeichnung des Attributs darstellen. Diese Ergänzungen lassen sich somit unter einem Attribut RHETORIK zusammenfassen.
Während die Konstruktion eptir þeim hætti sem nicht auf das Attribut QUELLE verweist, ist dies bei eptir e-u wie zuvor dargelegt der Regelfall. In den Quellen ist der Stoff überliefert, wodurch ein weiteres Attribut, der STOFF, ins Spiel kommt. Der Autor wählt aus dem in Quellen überlieferten Stoff Teile aus, welche er dann als Text zusammenfügt. Das Konzept von setja saman beinhaltet also nicht nur die dispositio, sondern auch die inventio. Auf den STOFF referiert das nur in der Laurentius saga biskups belegte Präpositionalobjekt af e-u mit den Werten framferð ‚Vorgehen‘, lǫg ‚Gesetz‘ und vanrœkt ‚Nachlässigkeit‘. Das ONP nennt zu diesem Präpositionalobjekt ebenfalls einen Beleg aus den Landslǫg: „af ollum bokum landsens“ (Keyser/Munch 1848: 7) ‚aus allen Büchern des Landes‘. Auf den ersten Blick sieht dies nach der Angabe einer Quelle aus. Die Bücher dienten zwar sicher als Quelle oder Vorlage, jedoch handelt es sich nicht um eine Kompilation aller Gesetzbücher des Landes, vielmehr enthalten sie einen Stoff, welcher in den Landslǫg verarbeitet worden ist. Der Schriftträger bók steht an dieser Stelle metonymisch für den darin enthaltenen Stoff.
Der TEXT hat auch einen INHALT, auf den in der Laurentius saga biskups nur einmal das Präpositionalobjekt um e-t mit den Werten háttr ‚Lebensweise‘ und siðferði ‚Lebensführung‘ verweist. Auch dieser ist im Kontext der anderen Sagas erwähnt, so dass er lediglich eine Leerstelle bildet. Das Kompositum latínusaga demonstriert, dass das Attribut SPRACHE einerseits zum TEXT-Frame gehört, es kommt aber anderereits auch als Ergänzung von setja saman im Präpositionalobjekt í norrœnu máli mit dem Lexem mál als Bezeichnung für das Attribut selbst und dem Wert norrœnn ‚nordisch‘ vor. Zwischen den Attributen TEXT und SPRACHE besteht demnach ein Werteconstraint. Im Falle der Heiligenlegenden (heilagra manna sǫgur) kommen allerdings zwei Sprachen in Frage, so dass Wert zum Attribut SPRACHE explizit erwähnt werden muss, so dass dieses auch zum TEXT-Frame gehört.
Einzig in der Sturlunga saga ist das Attribut AUFTRAGGEBER eine Füllung als Subjekt der Kausativkonstruktion láta setja saman mit dem Wert konungr ‚König‘. In den anderen beiden Sagas kommt der AUTRAGGEBER teilweise im Kontext vor, so dass dieses Attribut dort lediglich eine Leerstelle bildet. Belege der Laurentius saga biskups machen allerdings deutlich, dass die Autoren auch aus eigenem Antrieb schreiben, so dass dieses Attribut von der Situation abhängt.
Das Attribut ZWECK lässt sich nur einmal in der Jóns saga helga im Kontext mit den Werten lof ‚Lob‘ und dýrð ‚Ehre‘ nachweisen. Das ONP (setja) nennt einen Beleg aus der Sigurðar saga þǫgla, in dem die Ergänzung „til scemtanar monnum“ (Loth 1963a: 95) ‚den Leuten zur Unterhaltung‘ auf dieses Attribut verweist. Auch andere verba scribendi verweisen mit dem Präpositionalobjekt til e-s auf dieses Attribut und haben ähnliche Werte. Die Attribute STOFF, QUELLE und TEIL sprechen für die compilatio, bei der Teile aus Vorlagen abgeschrieben werden, der Kompilator aber u.U. Eigenes hinzufügt. Die Belege erlauben allerdings keine scharfe Trennung zwischen Kompilator und Autor, denn die Grenzen zwischen diesen beiden Rollen sind fliessend. Zu diesem Schluss kam Würth (2007). Das ‚Zusammensetzen‘ betrifft Handlungen, die von beiden Rollen ausgeführt werden. Das Verb setja saman entzieht sich also Bonaventuras strikter Aufteilung. Aus rhetorischer Perspektive kommen alle drei Schritte zum Zug. Die Attribute QUELLE und STOFF setzen die inventio voraus, das Attribut TEIL die dispositio. Das Attribut RHETORIK beinhaltet alle drei Schritte. Das Konzept von setja saman beschränkt sich nicht nur auf das Zusammenfügen schon bestehender Textteile, d.h. die Kompilation, sondern beinhaltet auch eine sprachliche Bearbeitung. Der Umgang mit Vorlagen war im Mittelalter relativ frei, so dass sowohl Autor als auch Kompilator Einfluss auf die elocutio ausübten. Von einem Kompilator wurde keine wortgetreue Wiedergabe des Quellentextes erwartet, genauso wenig vo einem Autor ein originelles Werk. Deshalb kann beim Agens von setja saman nicht auf einen Kompilator oder Autor zurückgeschlossen werden. Glauser (2010: 319) bezeichnet das Subjekt von setja saman als „composer“, was semantisch und morphologisch gut passt, weil setja saman wahrscheinlich eine Lehnübersetzung von lat. componere ist, auf das das nengl. compose ebenfalls zurückgeht, von dem wiederum das Nomen agentis composer abgeleitet ist. Leider gibt es keine geeignete deutsche Entsprechung. Eine Möglichkeit, der Autor-Kompilator-Dichotomie auszuweichen, wäre die Bezeichnung VERFASSER für das Attribut, auf welches das Agens referiert.
9. gera
Das Verb gera ‚machen, tun‘ (vgl. Baetke 2002: 190) hat keinen eigentlichen Bezug zur Schriftlichkeit, denn dieser wird nur deutlich, wenn das Akkusativobjekt durch einen Schriftträger oder Text besetzt wird, wie das in Baetke (2002: 190) erwähnte Beispiel gera bók ‚ein Buch verfassen‘ demonstriert. Fritzner (1886–96: I, 577) nennt unter dem Lemma gera die Objekte „bréf“ und „lögbók“ unter der Lesart 4 „gjøre noget, ved sin Gjerning eller Virksomhed frembringe eller istandbringe noget, saa at det derved bliver til“ ‚etwas tun, durch seine Tat oder Tätigkeit etw. hervorbringen, zustandebringen, so dass es dadurch entsteht‘, ohne eine Bedeutung ‚schreiben‘ oder ‚verfassen‘ zu nennen, welche die Objekte lediglich implizieren. Vorbild ist wahrscheinlich das Lateinische mit den Kollokationen litteram facere ‚schreiben‘ oder litteras ad aliquem facere ‚an jdn. schreiben‘ (vgl. Georges 1998: I, 2661–2668). Wahrscheinlich ist gera ein Hyperonym, welches die Konzepte SCHREIBEN und VERFASSEN umfasst. Dies zeigt nicht nur Tómassons (2012) Analyse des Prologs der Íslendingabók, sondern auch ein Beleg von gera bréf ‚einen Brief machen‘ aus dem Eschatokoll einer norwegischen Urkunde von 1292, welche Fritzner (1886–96: III, 118f.) unter dem Lemma rita nennt: „Uar þetta bref gort i Stafangre. […] ok jnsiglagt sialfum oss hiauerandom. en Gabriel klærckr var ritaðe“ (Dipl. norv. I, Nr. 80, S. 72) ‚Dieser Brief wurde in Stavanger gemacht […] und in Unserer Anwesenheit gesiegelt, und Unser Kleriker Gabriel schrieb [ihn]‘ (Übers. KM). Das ‚Machen‘ umfasst die Erstellung der gesamten Urkunde, während Siegeln und Schreiben nur Teile dieses ‚Machens‘ darstellen. Im ONP (gera) ist nur die Kollokation gera bréf eigens aufgelistet, mit Belegen seit der Zeit um 1300. In einem dieser Belege aus der Sverris saga wird zwischen gera und setja innsigli ‚siegeln‘ unterschieden (vgl. Indrebø 1920: 150). Diese Unterscheidung bestätigt ein weiterer Beleg bei Spurkland (2000: 55) aus der Ólafs saga helga. Das deutet daraufhin, dass gera bréf nur Verfassen und Schreiben des Briefes beinhaltet.
Die Kollokation gera bréf ist in der Sturlunga saga und der Laurentius saga biskups belegt, während gera bók in der S-Redaktion der Jóns saga helga und der Sturlunga saga vorkommt.
9.1. Die S-Redaktion der Jóns saga helga
In der Jóns saga helga ist die Kollokation gera bók dreimal im Kapitel XIX der S-Redaktion belegt, in welchem ein Schreiber (ritari) zu Bischof Jón kommt und ihn bittet, ein Buch zu bewerten, das er für einen Priester geschrieben hat (s. a. Kap. II.3.1.1.a. und b.): a) „hann hafði með ser bok er hann hafði ritað. ok giorfva presti einvm þeim er þaðan var langtt ibrvt. ok hafði sa beðit hann miok til at giora bokina“ (JSH 27). ‚Er [= der Schreiber] hatte ein Buch bei sich, das er geschrieben und für einen Priester gemacht hatte, der weit weg von dort lebte, und dieser hatte ihn sehr darum gebeten, das Buch zu machen‘ (Übers. KM). Subjekt des ersten Belegs im Aktivum ist hann ‚er‘, welches für den Schreiber steht. Im Akkusativobjekt ist die Relativpartikel er, welche auf bók ‚Buch‘ im Hauptsatz verweist. Dritte Ergänzung ist das Dativobjekt presti einum ‚einem Priester‘, gemäss dem Kontext der Auftraggeber und Käufer des Buches (vgl. JSH 27f.). Der zweite Beleg ist in einem Infinitivsatz mit dem Schreiber als Agens, das sich aus dem Hauptsatz ergibt. Akkusativobjekt ist bókina ‚das Buch‘. Der Priester aus dem Dativobjekt des ersten Belegs ist Subjekt des Verbs biðja ‚bitten‘ im Hauptsatz, woraus deutlich wird, dass er der Auftraggeber des Buches ist. Der dritte Beleg der Kollokation folgt später, nachdem Bischof Jón das Buch angesehen sowie gelobt hat und dann prophezeit, dass der Auftraggeber das Buch nicht erhalten werde. Der Schreiber erwidert, dass Jón das Buch bewerten solle und sagt: b) „þvi at hann bað mik miok at ek skyllda honvm slika bok giora“ (JSH 28). ‚Denn er bat mich sehr, dass ich ihm ein solches Buch machen solle‘ (Übers. KM). Subjekt ist ek ‚ich‘, das für den Schreiber steht, honum ‚ihm‘ im Dativobjekt für den Priester und slíka bók ‚ein solches Buch‘ im Akkusativobjekt für das Buch, das in diesem Kapitel der Saga an keiner Stelle inhaltlich näher beschrieben wird.
Der Frame von gera bók besteht bei diesen drei Belegen aus den Attributen SCHREIBER als Agens, welches das Lexem ritari bezeichnet, SCHRIFTTRÄGER als Thema mit dem Wert bók und AUFTRAGGEBER als Dativobjekt mit dem Wert prestr. Das bei rita bók ergänzte Attribut QUALITÄT fehlt (vgl. Kap. II.3.1.1.a. und b.). Beim Lexem bók lässt sich nicht sicher entscheiden, ob es wie bei rita metonymisch zum SKRIPT verschoben ist. Mehr Aufschluss könnte Bischof Jóns Beurteilung liefern. Er sagt über die Arbeit des Schreibers: „Goð er þessi bok ok vel ritvð“ (JSH 28) ‚Gut ist dieses Buch und gut geschrieben‘ (Übers. KM). Die Konstituente vel rituð ‚gut geschrieben‘ bezieht sich auf das Buch als Skript, während der Satz góð er þessi bók ‚gut ist dieses Buch‘ die Qualität des Schriftträgers beschreibt. Da gera bók und rita bók in der Erzählung getrennt werden, könnte das Thema von gera sich auf das Buch als Ganzes beziehen und nicht nur auf das Skript. Was dieses Ganze beinhaltet bleibt aber offen. Neben dem Skript umfasst dieses Buch den Schriftträger bestehend aus Pergamentblättern, Deckeln, möglicherweise Buchschmuck, sowie einen Inhalt, welcher aber in der Saga nicht thematisiert wird. Weil es sich um eine Auftragsarbeit eines Priesters handelt, enthält das Buch wahrscheinlich liturgische Texte, welche nicht vom Schreiber eigenständig verfasst wurden, so dass bók abhängig von gera nur auf die materiellen und visuellen Aspekte des Schriftträgers referieren kann. Das Thema von gera steht folglich für das Attribut SCHRIFTTRÄGER mit all diesen Aspekten. Das Attribut QUALITÄT gilt dann auch für gera bók und bildet bei diesem Beleg eine Leerstelle, welche mithilfe des Kontexts geschlossen werden kann.
9.2. Sturlunga saga
Der einzige Beleg der Kollokation gera bók in der Sturlunga saga ist im Haukdælaþáttr enthalten, der in der Króksfjarðarbók überliefert ist: a) „Honum vard vida kvnnigt of Svðr-londinn, oc þar af gerdi hann boc þa, er heitir Flos peregrinacionis“ (StS1 247). ‚Er kannte sich in den südlichen Ländern weitherum aus und davon „machte“ er das Buch, welches flos peregrinationis „Blüte des Pilgerns“ heisst‘ (Übers. KM). Das Pronomen hann ‚er‘ im Subjekt steht für den weitgereisten Hallr Teitsson, der in der Sturlunga saga als sehr guter Kleriker (inn bezti klerkr), sowie als weise (vitr) und redegewandt (málsnjallr) beschrieben wird (vgl. StS1: 247). Sowohl seine geistliche Bildung als auch sein rhetorisches Talent befähigen ihn als Verfasser, was mit den Verfasserprofilen der Laurentius saga biskups übereinstimmt (vgl. Kap. II.6.2. und 9.3.). Vom Akkusativobjekt bók ‚Buch‘ hängt ein Relativsatz ab, welcher den Wert flos peregrinationis für ein Attribut TITEL im TEXT-Frame enthält. Es ist allerdings kein Buch mit diesem Titel erhalten (vgl. Jóhannesson et al. 1946: I, 540). Die dritte Ergänzung ist das Proadverb þar af, welches sich auf die Kenntnisse Hallr Teitssons über die südlichen Länder bezieht. Die Präposition af steht bei rita und setja saman für das Attribut STOFF, was auch hier zuträfe, da Hallr sein Wissen über den Süden in einen Text umarbeitet. Dies weist auf die Tätigkeit eines Verfassers oder Kompilators hin. Im Gegensatz zur Jóns saga helga steht bók hier als Wert für das Attribut TEXT und gera bók verbindet hier die Attribute VERFASSER, TEXT und STOFF.
Daneben gibt es in der Sturlunga saga zwei Belege für die Kollokation gera bréf. Der erste stammt aus der Þorgils saga skarða und ist nur in frühneuzeitlichen Abschriften enthalten: b) „Ábóti gerði þó bréf með Halldóri ok sendi orð Katli presti, at hann færi með honum út til Staðar“ (StS2 177). ‚Der Abt [Brandr] machte aber mit Halldórr einen Brief und schickte eine Nachricht an den Priester Ketill, dass er mit ihm nach Staðr gehe‘ (Übers. KM). Gera ist aktiv mit dem Abt im Subjekt und mit bréf im Akkusativobjekt. Das Präpositionalobjekt með Halldóri ‚mit Halldórr‘ ist bezüglich Attribut nicht eindeutig. Im Korrespondenzframe von rita und skrifa steht með e-m für den BOTEN. Die Laurentius saga biskups enthält jedoch einen Beleg, in dem die Konstituente með bóndum ‚mit den Bauern‘ eindeutig eine Ergänzung des Subjekts ist (vgl. Kap. II.5.2.8.1.b.). Letzteres könnte ebenfalls in der Sturlunga saga zutreffen. Dazu muss der Kontext einbezogen werden. Der Diakon Halldórr ist in einen Konflikt mit Þorgils skarði verwickelt, in dem Þorgils Halldórr das Vieh wegnimmt. Er ersucht darauf den Priester Ketill um Rat und der verweist ihn weiter an den Abt Brandr, der ihn wiederum mit dem Priester Ketill zu Þorgils nach Staðr schickt (vgl. StS2 176f.). Somit ist Þorgils skarði der EMPFÄNGER, der Konflikt mit ihm die ANGELEGENHEIT und Halldórr BOTE. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass er an der inventio des Briefes beteiligt war, weil der Abt auf Informationen zum Konflikt angewiesen war. Ausserdem konnte Halldórr als Diakon den Brief auch schreiben. Abt Brandr verfasste wahrscheinlich die BOTSCHAFT, was die dispositio und elocutio beinhaltete, und Halldórr schrieb darauf den Brief, so dass beide verschiedene Aufgaben übernahmen. Der Inhalt der BOTSCHAFT wird später genannt, nämlich dass Abt Brandr Þorgils auffordert, Halldórr das gestohlene Gut zurückzugeben (vgl. StS2 177).
Der zweite Beleg der Kollokation von gera bréf stammt aus der Íslendinga saga und ist ebenfalls nur in frühneuzeitlichen Abschriften überliefert:
c) Eptir þetta var skipuð lǫgrétta, ok sóru þessir bændr […] Hákoni konungi land ok þegna ok æfinligan skatt með slíkum skildaga sem bréf þat váttar, er þar var eptir gert. (StS2 319).
Danach wurde die Gesetzeskammer einberufen und diese Bauern schworen […] dem König Land und Gefolgschaft und für immer Steuern zu zahlen mit der Abmachung, wie der Brief bezeugt, der danach gemacht wurde (Übers. KM).
Das Verb steht im Passiv und die Relativpartikel er im Subjekt verweist auf bréf im Hauptsatz, wo auch die BOTSCHAFT des Briefes, das Bezeugen (vátta) dieser Abmachung (skildagi), erwähnt wird. Das Proadverb þar … eptir ist bezüglich Attribut nicht eindeutig, weil es temporal im Sinne von ‚danach‘ oder modal im Sinne von ‚demgemäss‘ verstanden werden kann, was beides in diesem Kontext zutreffen kann, weil die mündliche Abmachung nachträglich in der Form einer Urkunde schriftlich festgehalten wurde und diese Urkunde entsprechend dieser Abmachung geschrieben wurde. Gera deckt hier im Gegensatz zu rita wahrscheinlich alle Handlungen ab, welche zur Ausstellung dieser Urkunde nötig waren, das Verfassen des Textes und das Aufschreiben.
Beide Belege zu gera bréf aus der Sturlunga saga deuten darauf hin, dass gera breiter als rita zu verstehen ist, d.h. die Konzepte VERFASSEN und SCHREIBEN beinhaltet. Das Agens ist nicht eindeutig fassbar, denn bei ersterem Beleg kann es den Abt und den Diakon umfassen, bei letzterem ist das Agens nicht bekannt, es könnte sich um Personen aus der Gesetzeskammer (lǫgrétta) und einen Geistlichen handeln, welcher den Brief schrieb. Wie bók oben (Beleg a.) ist auch bréf primär als Wert für das Attribut TEXT aufzufassen. Die übrigen Attribute des Korrespondenzframes sind zum Teil im Kontext zu finden (ABSENDER, BOTE, EMPFÄNGER, BOTSCHAFT, ANGELEGENHEIT), bilden aber keine Ergänzungen, so dass sich der Frame von gera bréf enger als jener von rita bréf til e-s gestaltet, bestehend aus dem VERFASSER bzw. SCHREIBER und dem TEXT.