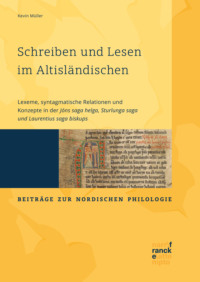Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 22
2.2.2. lesa bók ‚ein Buch lesen‘
Die L-Redaktion enthält ebenfalls die Stelle mit der gefährlichen Ovid-Lektüre aus der S-Redaktion (vgl. Kap. III.2.1.b.), mit einigen lexikalischen Unterschieden:
a) þat er sagt at hinn h(eilagi) Ion byskup kom at einn tima er einn klerkr er Klængr het […] las verssa bock þa er heitir Ouiðius ðe arte. […] Sem hinn sæli Iohannes sá ok undirstóð huat hann las fyrirbauð hann honum at heyra þessháttar bóck (JSH 84).
Es wird erzählt, dass der heilige Bischof Jón zu einer Zeit kam, als ein Kleriker, der Klœngr hiess […], ein Versbuch las, welches Ovidius de arte heisst. […] Als der selige Johannes sah und verstand, was er las, verbot er ihm ein derartiges Buch zu hören (Übers. KM).
Subjekt ist auch in der L-Redaktion Klœngr Þorsteinsson, der als klerkr ‚Kleriker‘ bezeichnet wird. Im Akkusativobjekt steht das Kompositum versabók ‚Versbuch‘, bestehend aus dem Kopf bók einem Wert für den SCHRIFTTRÄGER und dem Modifikator vers ‚Vers‘, einem Wert für die TEXTSORTE, so dass zwei Attribute des Attributframes TEXT gegeben sind. Im Kontext gibt es weitere Elemente dieses Attributframes: In einem Relativsatz werden noch der AUTOR Ovidius und der TITEL de arte genannt, welcher auf Ovids Werk Ars amatoria verweist (vgl. Steingrímsson 2003: II, 212, Anm. 1). Der INHALT wird nach dieser Stelle in der Erzählung paraphrasiert, dass Ovid über Liebe erzählt und wie Männer Frauen verführen können (vgl. JSH 84). Ausser Klœngr und Jón werden keine Anwesende erwähnt, so dass man annehmen kann, dass Klœngr still las. Im Folgenden verbietet Jón ihm aber ein derartiges Buch zu hören (heyra). Das deutet also daraufhin, dass er wohl alleine und laut las. Wenn noch andere Schüler anwesend gewesen wären, hätte er ihm sicher verboten, das Buch vorzulesen (lesa). Auch das Personalpronomen honum (3. Sg. Dat.) deutet auf eine einzelne Person, nämlich Klœngr. Das Verb heyra fokussiert auf die auditive Wahrnehmung, die hier im Vordergrund steht. Das Verbot richtet sich nicht auf das laute Aussprechen durch die Lesung oder auf die visuelle Wahrnehmung der Schrift, entscheidend beim Lesen ist die auditive Wahrnehmung des Textes. Dieser Beleg demonstriert, wie lesa immer heyra impliziert, nicht nur auf den ZUHÖRER, sondern auch auf den LESER bezogen. Für die GEFAHR des Lesens nennt die L-Redaktion ähnliche Werte wie munúðlífi ‚Leben in Sinnesgenuss‘ und holdlig ást ‚fleischliche Liebe‘ (vgl. JSH 84f., Baetke 2002: 26, 267, 431).
Ein weiteres Kompositum mit dem Kopf bók als Akkusativobjekt von lesa ist latínubœkr ‚Lateinbücher‘ mit dem Modifikator latína ‚die lateinische Sprache‘. Dieses Kompositum verbindet die Attribute SCHRIFTTRÄGER und SPRACHE verbunden werden und kommt mit lesa an einer Stelle vor, welche in der S-Redaktion fehlt: b) „hon retti miok látinu bækr sua at hon lét lesa fyrir ser enn hon siaalf saumaðe Tefldi. eða <vann> adrar hannyrðir meðr heilagra manna sogum“ (JSH 88). ‚Sie [= Jungfrau Ingunn] berichtigte viele lateinische Bücher, indem sie sich vorlesen liess, während sie selbst nähte, brettspielte oder andere Handarbeiten zu den Heiligenlegenden verrichtete‘ (Übers. KM). Subjekt ist Jungfrau Ingunn, eine gelehrte Frau, welche in Jóns Kathedralschule Grammatik (grammatica) unterrichtete. Das Verb lesa ist Teil einer Kausativkonstruktion mit dem Verb láta, so dass das Subjekt für die thematische Rolle Causer steht. Solche Kausativkonstruktionen erwähnt auch Green (2007: 18f.) als Indiz für lautes Lesen, er geht aber nicht näher auf die Rolle des Subjekts ein. Da die Lesung in Auftrag des Subjekts geschieht, wird dieses wie beim Schreiben einem Attribut AUFTRAGGEBER zugeordnet. Das Agens bildet zwar eine Leerstelle, es muss sich aber um die Schüler (lærisveinar) handeln. Das Akkusativobjekt ist ebenfalls eine Leerstelle, welche aber auf die eingangs erwähnten latínubœkr ‚Lateinbücher‘ verweist. Die im Kontext erwähnten heilagra manna sǫgur ‚Heiligenlegenden‘ geben Werte für die Attribute INHALT (helgir menn ‚Heilige‘) und TEXTSORTE (saga ‚Geschichte, Saga‘), die zum TEXT-Frame gehören. Das Verb lesa hat ausserdem das Präpositionalobjekt fyrir sér ‚vor sich‘, welches, wie ebenfalls Beispiele bei Green (2007: 16–18) im Mittelhochdeutschen und Altfranzösischen demonstrieren, für den ZUHÖRER steht. Das Reflexivpronomen sér verweist auf das Subjekt, Jungfrau Ingunn, zurück, so dass die Werte der Attribute AUFTRAGGEBER und ZUHÖRER identisch sind. Die Rolle des Zuhörers bestätigt auch der Kontext, da Jungfrau Ingunn sich die Bücher vorlesen lässt, um sie zu korrigieren. Die Konstruktion láta e-n lesa e-t fyrir e-m umfasst also neben den beiden Attributen LESER und TEXT des Kernframes zwei neue Attribute AUFTRAGGEBER und ZUHÖRER.
2.2.3. lesa messu ‚die Messe lesen‘
Auch die Stelle mit dem kranken Bischof Brandr unterscheidet sich geringfügig von der S-Redaktion (vgl. Kap. III.2.1.d.):
A þessum tima var Brandr byskup aa Hólum sua miok krankr. at æigi mátti hann læida til kirkiu. ok þij liet hann lesa sier Messu inni i herbergium mid uiku dag ok fimta dag (JSH 106).
Zu dieser Zeit war Bischof Brandr von Hólar so sehr krank, dass man ihn nicht in die Kirche bringen konnte, und deshalb liess er sich die Messe am Mittwoch und Donnerstag drinnen in seinen Räumen lesen (Übers. KM).
Lesa ist Teil der Kausativkonstruktion mit láta ‚lassen‘ + Inf. Subjekt bzw. Causer ist Bischof Brandr als AUFTRAGGEBER. Das Agens bildet eine Leerstelle. Neben dem Akkusativobjekt messu ‚Messe‘ hat lesa hier noch ein Dativobjekt sér ‚sich‘, welches sich auf das Subjekt bezieht. Der Dativ kann für den EMPFÄNGER der Handlung stehen, so dass Bischof Brandr mehr als nur die Rolle eines ZUHÖRERS hat, weil er Teilnehmer der Messe ist. Das Adverb inni ‚drinnen‘ und das Präpositionalobjekt í herbergjum ‚in den Räumen‘ sind Werte für das Attribut ORT, welche wieder vom angenommenen Defaultwert kirkja ‚Kirche‘ abweichen, weil Bischof Brandr krank ist. Diese Abweichung wird zusätzlich durch die Zeitangaben miðvikudag ‚am Mittwoch‘ und fimmta dag ‚am Donnerstag‘ eingeschränkt, die Werte des Attributs ZEIT darstellen und im Gegensatz zur S-Redaktion Ergänzungen von lesa sind. Der RAHMEN messa ist bei diesem Beleg ebenfalls erstens metonymisch zum Text verschoben, die Kollokation lesa messu ist zweitens eine Synekdoche und steht für das Abhalten der Messe.
2.2.4. lesa bœn ‚ein Gebet lesen‘
Die Attribute SCHRIFTTRÄGER und INHALT können metonymisch zum TEXT verschoben werden. Dies gilt auch für die TEXTSORTE. In den folgenden Belegen kommen Textsorten in den Akkusativobjekten vor. Beim ersten gelobt der Vater einer schwer kranken jungen Frau, um ihr zu helfen: a) „at lesa fimtigvm sinna gud liga bæn pater noster. ok sua morg Mariu vers“ (JSH 100) ‚fünfzigmal das göttliche Gebet Paternoster zu lesen und ebensoviele Ave-Maria‘ (Übers. KM). Agens in diesem Infinitivsatz der Vater, wahrscheinlich ein Laie, weil sonst wohl ein geistlicher Rang erwähnt worden wäre. Akkusativobjekte sind bœn ‚Gebet‘ ein Wert für die TEXTSORTE und Maríu-vers ‚Ave-Maria‘. Letzteres ist ein Kompositum, bestehend aus dem Kopf vers, also wieder einem Wert für die TEXTSORTE, und dem Modifikator María, einem Wert für den INHALT. Das erste Gebet hat noch den TITEL pater noster als Apposition. Das Numerale fimmtigum sinna ‚fünfzigmal‘ stellt einen Wert für ein Attribut FREQUENZ dar. Vergleichbare Belege gibt es in isländischen Urkunden. Eine ist auf das Jahr 1365 datiert und enthält die Werte fimmtántigum sinna ‚150 Mal‘ für die FREQUENZ und Maríu vers für den TEXT: „en þeir sem minna fe eighu lese fimmtáantighum sinna mariu wers“ (Karlsson 1963: 42). ‚Aber jene, die weniger besitzen, lesen 150 Mal das Ave-Maria‘ (Übers. KM). Die andere ist auf das Jahr 1505 datiert und enthält die Werte pater noster und ave maria für den TEXT und im Präpositionalobjekt fyrir e-m noch kristnar sálir ‚christliche Seelen‘ für den ZUHÖRER: „suo og þeim sem ganga vm kirkiugardin og lesa pater noster eda ave maria fyrir kristnum saalum“ (Dipl. Isl. VII, 788). ‚So auch jenen, die über den Friedhof gehen und Paternoster und Ave-Maria den christlichen Seelen vorlesen‘ (Übers. KM). Bei diesen Belegen bleibt unklar, was die schriftliche Grundlage dieser Gebete bildete. Bisher sind immer Werte für das Attribut SCHRIFTTRÄGER vorgekommen, entweder als Ergänzung oder im Kontext. In der Sturlunga saga gibt es einen in der Króksfjarðarbók erhaltenen Beleg, wo das Gebet auf einer Schriftrolle festgehalten ist. Anstelle von lesa steht jedoch das Verb syngja ‚singen, psalmodieren, feierlich sprechen‘ (Baetke 2002: 631), welches im Folgenden zum Kontext passend als ‚rezitieren‘ übersetzt wird: „Sturla geck þa til kirkiu ok tók rollu or punngi sinum ok saung af bænir sínar ok sǫng Augustinus bæn, meðan liðit bioz“ (StS1 523). ‚Sturla ging dann in die Kirche und nahm eine Rolle aus seinem Beutel und rezitierte von ihr seine Gebete und rezitierte das Augustinus-Gebet, während sich die Mannschaft bereit machte‘ (Übers. KM).1 Trotz des anderen Verbs tritt wieder die gleiche Konstellation auf, bestehend aus dem TEXT als Akkusativobjekt, dem SCHRIFTTRÄGER im Präpositionalobjekt af rollu ‚von der Rolle‘ und nicht zu vergessen dem LESER bzw. REZITATOR als Subjekt.
Die Synonymie dieser beiden Verben verdeutlicht auch folgender Beleg, bei dem Bischof Jón im Sterben liegt und das letzte Abendmahl erhält:
b) les hann þessa Comunionnem er sua byriar. Refecti domine pane celesti að uitam quesumus nutriamur eternam. þat er sua at skilia. Heyrdu drottinn. ver saddir himnesku braude bidium at su næring snuiz oss til eylifs lifs ok fagnadar (JSH 96).
Er liest diese Communio, die so beginnt: Refecti domine pane coelesti ad vitam quaesumus nutriamur aeternam. Das ist so zu verstehen: Höre Herr! Wir, satt vom himmlischen Brot, bitten dich, dass diese Nahrung zu ewigem Leben und Freude führt (Übers. KM).
Das Subjekt hann ‚er‘ verweist auf Bischof Jón. Das Akkusativobjekt enthält lat. communio ‚Kommunion‘, das sich auf einen Gesang während der Messe bezieht, welcher bei der Kommunion gesungen wird. Somit ist communio sowohl Wert für das Attribut TEXT und als auch für den RAHMEN. Der Text Refecti Domine ist allerdings Teil der postcommunio (vgl. Helander 1957: 583, Steingrímsson 2003: 238f.). Diese Szene ist auch in der S-Redaktion enthalten, wo syngja anstelle von lesa steht: „þaa savng hann fyrst communio þessa“ (JSH 28). ‚Dann sang er zuerst diese communio‘ (Übers. KM).
Syngja und lesa sind also gerade in einem liturgischen Kontext partiell synonym, weil die Texte einerseits schriftlich festgehalten sind und daher gelesen werden. Andererseits fordert die Liturgie eine besondere Art der Rezitation, welche dann als syngja bezeichnet werden kann, so dass beide Verben extensional zutreffen, sich aber intensional unterscheiden. In der Sturlunga saga wird die Art der Rezititation also hervorgehoben.
In der Jóns saga helga gibt es einen weiteren vergleichbaren Beleg, bei dem eine Frau (kona) in der Nacht wach liegt und erst einschläft, nachdem sie ihre Gebete gelesen hat: c) „ok sem hon hafdi lesit bønir sinar […]“ (JSH 105). ‚und als sie ihre Gebete gelesen hatte […]‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen hon ‚sie (f. Sg.)‘ im Subjekt verweist auf diese Frau. Im Akkusativobjekt ist bœnir ‚Gebete‘ enthalten. Im Kontext fehlt ein Wert für den SCHRIFTTRÄGER. Es ist wahrscheinlich, dass der LESER bzw. REZITATOR diese Gebete auswendig konnte. Dies trifft gerade auf kürzere Gebete wie Paternoster und Ave-Maria zu. Dieses auswendige Rezitieren entspricht auch weitgehend der seit der Antike tradierten Praxis des Memorierens, bei welcher der primäre Zweck des Lesens das Memorieren und mündliche Wiedergeben des Gebets war. Dies gilt insbesondere für den Psalter, das Lesebuch par excellence im Mittelalter, weshalb die Leser viele Psalme auswendig konnten, was dazu führte, dass im 13. Jahrhundert psalmos ruminare ‚Psalme auswendig rezitieren (wörtl. wiederkäuen)‘ und legere psalmum ‚einen Psalm lesen‘ gleichbedeutend wurden (vgl. Green 2007: 62f.). Die Präsenz des Geschriebenen war in der Liturgie aber unablässig, d.h. der Schriftträger musste als sakrales Objekt anwesend sein (vgl. Rohrbach 2008: 200f.). Lesa und syngja sind also in einem liturgischen Kontext nicht nur partiell, sondern völlig synonym, da die liturgischen Texte schriftlich festgehalten waren und auf eine bestimmte Weise rezitiert werden mussten. Lesa impliziert im liturgischen Kontext eine bestimmte Art und Weise der Rezitation, welche auch im oben genannten Beleg aus der Jóns saga helga, wo der Priester die passio eben schlecht und falsch liest, eine Rolle spielt und deshalb explizit wird. Es impliziert auch die Sprache, da die liturgischen Texte lateinisch waren. Es bestehen folglich auch Constraints zwischen den Werten der Attribute TEXT, SPRACHE, RAHMEN und STIMME.
Neben dem individuellen Rezitieren bestimmter Gebete gibt es auch Belege, in denen ein Geistlicher ein Gebet für jemanden liest, so dass es neben dem Vorleser auch einen Zuhörer gibt, der auf der Ausdrucksseite als Präpositionalobjekt yfir e-m wiedergegeben wird. Die Konstruktion lesa yfir e-m erwähnt Fritzner/Hødnebø (1972: 222) mit den Übersetzungen „lese en formel til hjelp mot vonde makter“ ‚eine Formel zur Hilfe gegen böse Mächte lesen‘ und „lese (av breviariet) over en døende“ ‚(aus dem Brevier) über einem/einer Sterbenden lesen‘, welche auf zwei Belegen beruhen. Keine der beiden Bedeutungen kann auf die Jóns saga helga übertragen werden, so dass fraglich ist, wie konventionell sie überhaupt sind. Die Konstruktion lesa e-t yfir e-m kommt zweimal im Gísls þáttr Illugasonar vor, in dem die schwerkranken Kameraden Sigurðr ullstrengr und Auðunn bei Jón beichten möchten. Dadurch ist im Kontext bereits ein RAHMEN játning ‚Beichte‘ gegeben. Sigurðr sagt: d) „vil ek nu giora mina Iatning fyrir þer. biðianði at þu lesir nu betra ok miukara yfir okkr kumpanvm enn I sinn aa þinginu.“ (JSH 70). ‚Ich will jetzt vor dir meine Beichte ablegen und bitte dich, dass du nun etwas Besseres und Milderes über mir und meinem Kameraden liest, als damals beim Thing‘ (Übers. KM). Das Subjekt þú von lesa bezieht sich auf den Priester Jón. Im Akkusativobjekt befinden sich zwei Adjektive im Komparativ, betra ‚besseren/-es (m/n. Akk. Sg.)‘ und mjúkara ‚milderen/-es (m/n. Akk. Sg.)‘. Formal kommen die beiden Genera Maskulin oder Neutrum in Frage, es handelt sich aber eher um ein Neutrum, da es kein passendes maskulines Substantiv im Kontext gibt. Eine weitere Ergänzung ist das Präpositionalobjekt yfir okkr kumpánum ‚über mir und meinem Kameraden‘, welches die beiden Beichtenden und Zuhörer des Gebets enthält. Die darauf folgende Anspielung auf die Thingversammlung ist interessant, weil Jón an derselben nicht las, sondern redete. Er setzte sich für Gísl Illugason ein, indem er den König vor einer Fehlverurteilung mit Höllen- und Fegefeuerstrafen warnte. Dieses Plädoyer kam beim König schlecht an, denn er erwidert darauf: „stortt talar þv nu prestr“ (JSH 66) ‚Grossartig redest du jetzt, Priester‘ (Übers. KM). Gísls Gegner Sigurðr und Auðunn erwarten nach der Beichte nun etwas Besseres und Milderes (betra ok mjúkara) als bei der Thingversammlung. Die beiden Adjektive sind also Werte für das Attribut INHALT. Jón formuliert tatsächlich eine Busse, dass Sigurðr mit seinem Vermögen ein Benediktiner- oder Dominikanerkloster (svartmunkaklaustr) stiften solle. Erst darauf wird das Lesen von Gebeten (bœnir) erwähnt, worauf Sigurðs Bitte wohl hinweisen soll:
e) Ok er Sigurðr hafði beðit ser licknar fyrir sin meinlæte las hinn h(eilagi) Iohannes yfir þeim kumpanum helgar bænir. ok gaf þeim sina bleðzan. þa mællti Sigurðr. mykit megv orð þin. horð ok goð prest<r> (JSH 70).
Und als Sigurðr um Vergebung für seine Peinigung gebeten hatte, las der heilige Johannes über den Kameraden heilige Gebete und gab ihnen seinen Segen. Da sprach Sigurðr: „Viel vermögen deine harten und guten Worte, Priester“ (Übers. KM).
Subjekt ist wieder der Priester Jón (Johannes), die ZUHÖRER im Präpositionalobjekt mit yfir þeim kumpánum ‚über den Kameraden‘ sind wieder Sigurðr und Auðunn. Das Akkusativobjekt enthält den Wert bœnir ‚Gebete‘ für das Attribut TEXT. Sigurðs Aussage am Schluss nimmt nochmals die harten Worte der Thingrede und die guten Worte des Gebets auf. Reden und Lesen sind im Gísls þáttr Illugasonar aus der Perspektive des Zuhörers identisch, das von ihm wahrgenommene gesprochene Wort steht im Vordergrund, die schriftliche Grundlage bleibt sekundär. Die Adverbien beziehen sich auf die Wirkung der gesprochenen und gelesenen Worte auf den Zuhörer. Die Rede auf dem Thing wird als hart (harðr) empfunden, im Gegensatz dazu sollten die Worte des Gebets gut (góð) sein und im Verhältnis zur Thingrede weicher (mjúkara) und besser (betra) gelesen werden. Diese Lexeme gehören jedoch nicht zum Attribut STIMME, sondern zum INHALT, weil dieser hart bzw. gut aufgenommen wurde und nicht die Stimme. Eine schriftliche Grundlage für die Gebete wird auch bei diesem Beleg nicht erwähnt. Bei einem Priester kann man annehmen, dass er ein Buch besass und vielleicht auch bei sich hatte, aber auch, dass er diese Gebete auswendig konnte. Wie in der privaten Andacht ist es möglich, dass lesa in diesem Kontext ‚einen schriftlich existierenden, aber nicht präsenten Text rezitieren‘ bedeutet. Die Präsenz des Schriftträgers bleibt fraglich. Einerseits kann sie als Wissen vorausgesetzt werden, andererseits kann man dagegenhalten, dass die Präsenz erwähnt werden müsste, wenn sie so entscheidend wäre.
Das Konzept lesa unterscheidet sich bei den Belegen dieses Kapitels grundlegend, weil der Leser nicht einen schriftlichen Text abliest, sondern ihn aus dem Gedächtnis rezitiert, was die Präsenz des Schriftträgers aber nicht ausschliesst, obwohl die Grundlage des rezitierten Textes das Gedächtnis bildet. Der Frame bleibt aber gleich strukturiert mit dem LESER als Agens und dem TEXT als Thema. Die Werte der Attribute TEXT und LESER schränken die Art des Lesens ein, dahingehend, dass gewisse Personen gewisse Texte im Gedächtnis abgespeichert haben. Der TEXT hat einen eigenen Attributframe mit den Attributen INHALT mjúkari, betri, María, TITEL pater noster, TEXTSORTE vers und SPRACHE orð. Die Adjektive betri und mjúkari implizieren eine Wirkung der Sprache des Textes auf den ZUHÖRER, auf den das Präpositionalobjekt yfir e-m verweist. Um auf die Übersetzungen in Fritzner/Hødnebø (1972: 222) zurückzukommen erfüllt das Gebet die Eigenschaften einer Formel und kann auch in einem Buch, wie einem Brevier, enthalten sein. Die Krankheit kann man als böse Macht betrachten. Jedoch hilft nicht nur das Gebet gegen diese böse Macht, sondern auch Busse und Segen. Weil der Inhalt der Gebete nicht bekannt ist, ist es schwierig zu beurteilen, welche Wirkung mit ihnen beabsichtigt ist. Das Konzept der Konstruktion lesa e-t yfir e-m lässt sich nichtsdestotrotz allgemeiner formulieren, insofern als es sich um einen performativen Sprechakt mit einer schriftlichen Grundlage handelt, von dem der ZUHÖRER betroffen ist. Die Belege a. und b. dieses Kapitels demonstrieren aber, dass nicht das Präpositionalobjekt yfir e-m darüber entscheidet, ob es sich um einen Sprechakt handelt, sondern vielmehr die Werte für den LESER, TEXT und wohl auch den RAHMEN, der teilweise im Kontext erwähnt ist, aber keine Ergänzung des Verbs lesa bildet.
2.2.5. lesa heilagar ritningar ‚die Heilige Schrift lesen‘
In einem religiösen Rahmen spielt neben Gebeten und Psalmen auch die Heilige Schrift (heilagar ritningar)1 eine zentrale Rolle, die in der L-Redaktion der Jóns saga helga einmal als Akkusativobjekt von lesa belegt ist: a) „sumir laasv heil<a>gar Ritningar. sumir Rituðu. sumir sungv Sumir naamu. sumir kenðu“ (JSH 87). ‚Einige lasen die Heilige Schrift, einige schrieben, einige sangen, einige lernten und einige lehrten‘ (Übers. KM). Der Beleg gehört in den Kontext des geschäftigen Alltags am Bischofssitz in Hólar. Was unter Lesen genau zu verstehen ist, bleibt zunächst unklar: Das Adjektiv sumir ‚einige (m. Pl.)‘ im Subjekt bezieht sich wahrscheinlich auf das vorher genannte menn til kenslu ‚Leute zur Unterweisung‘ (s.a. Kap. III.2.2.1.g. und 2.1.2.a.). Die Konstituente heilagar ritningar, bestehend aus dem Substantiv ritningar ‚Schriften‘ und dem Adjektiv heilagar ‚heilig‘, kann als Wert für das Attribut TITEL genommen werden, welcher wieder metonymisch zum TEXT verschoben ist. Der Text heilagar ritningar rekurriert in folgenden Abschnitt, der weitere Aufschlüsse über die Art des Lesens gibt, auch wenn lesa selbst dort nicht belegt ist:
b) ok þegar signum var til tiða gortt. skundudu allir þegar or sinum smáá kofum til kirkiunnar. sætligan seim sem þrifit byflygi til bystoks heilagrar kirkiu meðr ser berandi. huert þeir hofðu samann borið or lystuligum vinkiallara heilagra Ritninga (JSH 87).
Und als das Zeichen zum Stundengebet gegeben wurde, brachten alle sofort aus ihren kleinen Klausen zur Kirche einen süsslichen Honig wie eine fleissige Biene zum Bienenstock der heiligen Kirche und trugen bei sich, was sie aus dem köstlichen Weinkeller der Heiligen Schrift gesammelt hatten (Übers. KM).
In diesem Abschnitt sind zwei Werte für das Attribut ORT gegeben, nämlich kofi ‚Klause‘ und kirkja ‚Kirche‘. Das Lesen findet also alleine in der Klause, ausserhalb der Kirche statt. Auch der Zeitpunkt ist ausserhalb des Gottesdienstes gelegt, so dass das Lesen in der Kirche im Rahmen des Gottesdienstes ausser Frage kommt. Es handelt sich bei diesem Beleg also um das individuelle Lesen der Heiligen Schrift als Teil der Meditation und des Studiums, wofür der Wert des Attributs ORT entscheidend ist.