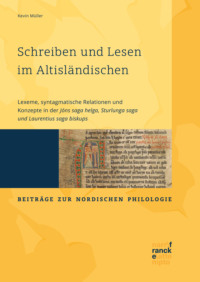Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 23
2.2.6. lesa e-t ‚etw. lesen/sammeln‘
Bis jetzt hatte lesa immer ein bestimmtes Akkusativobjekt oder eine Leerstelle, welche auf einen möglichen Text verwies. Beim folgenden Beleg ist dies allerdings nicht der Fall:
sua mikit hofzst fræði fysi ok naams meðr kostgæfui þessa bleðzada byskups at oðru megum stỏðu at klerkar. oðrum megum leick menn. huer at lesa meðr heilagri græðgi i sinn minnis sioð. þat er fá mætti af nægð guðligra auðæfa (JSH 88).
Es entstand eine so grosses Verlangen nach Wissen und Lernen mit dem Streben dieses gesegneten Bischofs, dass auf der einen Seite die Kleriker standen und auf der anderen die Laien, damit jeder mit heiliger Gier in ihren Gedächtnisbeutel das lesen konnten, was sie von der Fülle göttlicher Reichtümer bekommen könnten (Übers. KM).
Das Subjekt umfasst die Kleriker (klerkar) und Laien (leikmenn), welche auf zwei Seiten stehen. Die Kleriker können sicher lesen, bei den Laien handelt es sich wahrscheinlich um aural readers, weil die beiden Stände auf verschiedenen Seiten stehen, wahrscheinlich in der Kirche, die Laien im Schiff und die Kleriker im Chor. Das eine von lesa abhängige Präpositionalobjekt með heilagri græðgi ‚mit heiliger Gier‘ steht für eine Intention, so dass das Lexem græðgi ‚Gier‘ als Wert für ein Attribut INTENTION steht. Diese erinnert an die von Schnyder (2006: 435–437) thematisierte Nahrungsmetaphorik beim inkarnierenden Lesen. Das andere Präpositionalobjekt í sinn minnissjóð ‚in seinen Gedächtnisbeutel‘ verweist einerseits auf ein Attribut ZIEL, andererseits auch auf ein Attribut GEDÄCHTNIS. Das Kompositum minnissjóðr ist ein Hapaxlegomenon (vgl. ONP minnissjóðr) und besteht aus dem Kopf sjóðr ‚Beutel‘ und dem Modifikator minni ‚Gedächtnis, Erinnerung‘. Der Beutel ist eine Metapher für das Gedächtnis als Gefäss, in das Wissen gefüllt wird. Dies erinnert wiederum an die Bedeutung ‚sammeln‘. Das Akkusativobjekt þat ‚das‘ kommt zuletzt und ist durch einen Relativsatz ergänzt, welcher die Fülle ([g]nœgð) der göttlichen Reichtümer (auð[h]œfi) als QUELLE des zu Lesenden bzw. Sammelnden nennt. Diese Quelle ist wahrscheinlich ein sakraler Text. Lesa ist bei diesem Beleg bewusst zweideutig, so dass zwei Frames evoziert werden: 1. der Leseframe mit den Lexemen klerkr, heilagr und minni und 2. der Sammelframe mit den Lexem sjóðr, gnœgð und auð[h]œfi. Diese neuen Attribute gehören grösstenteils in die Attributframes des Leseframes. Das GEDÄCHTNIS (minni) bzw. das ZIEL gehört sicher zum Attributframe LESER, da der Leser den Text ja in sein Gedächtnis aufnimmt. Die im Relativsatz erwähnte göttliche Quelle ist in den Attributframe TEXT einzuordnen, trifft aber nur auf sakrale Texte zu. Die Handlung des Lesens ist einer Intention unterworfen, so dass diese als Attribut nicht überrascht. Die metaphorische Sprache dieser Textstelle gibt neue Einblicke in die Lesepraktiken. Die sakralen Texte sind Quellen göttlicher Reichtümer, nach denen jeder strebt und die jeder in sein Gedächtnis aufnimmt. Diese Aufnahme ins Gedächtnis ist auch Grundlage für das auswendige Rezitieren sakraler Texte.
2.2.7. Der Frame von lesa in der L-Redaktion der Jóns saga helga
Die L-Redaktion der Jóns saga helga gibt wegen der grösseren Belegzahl ein vielfältigeres Bild des Verbs lesa. Der Kernframe besteht wie in der S-Redaktion aus den Attributen LESER und TEXT. Die Werte von Ersterem sind vielfältig, von Laien (faðir ‚Vater‘, kona ‚Frau‘, leikmenn ‚Laien‘) bis zu verschiedenen geistlichen Rängen (klerkr ‚Kleriker‘, djákni ‚Diakon‘ und prestr ‚Priester‘). Letzteres ist immer metonymisch aus den Attributen des Attributframes verschoben: bók ‚Buch‘ ist ein Wert für den SCHRIFTTRÄGER, betra ‚Besseres‘, mjúkara ‚Milderes‘ und passio für den INHALT, heilagar ritningar ‚Heilige Schrift‘ und pater noster für den TITEL, bœn ‚Gebet‘ und vers ‚Vers‘ für die TEXTSORTE. Neben dem einen Wert im Akkusativobjekt sind weitere Werte des Attributframes im Kontext vorhanden. In der Kausativkonstruktion láta lesa kommt zusätzlich der AUFTRAGGEBER als Ergänzung hinzu mit dem Wert jungfrú ‚Jungfrau‘, welcher auch für das Attribut ZUHÖRER im Präpositionalobjekt fyrir e-m einmal belegt ist. Die STIMME wird wie in der S-Redaktion durch Adverbien ausgedrückt mit den Werten greiniliga, rétt, skjallt und snjallt.
Die TEXTSORTE bœn beinhaltet einen performativen Sprechakt, der auf eine bestimmte Person gerichtet ist, welche gleichzeitig ZUHÖRER ist und im Präpositionalobjekt yfir e-m enthalten ist. Beim Gebet wird auch deutlich, dass das Konzept von Lesen weiter gefasst wurde als heute, wo es aus Entziffern und visuellem Aufnehmen des Inhaltes besteht. Im Mittelalter gehört auch das Rezitieren dazu. Die Grundlage dafür bildet nicht nur ein tatsächlich vorliegender schriftlicher Text, sondern auch das Gedächtnis. Im Falle gängiger liturgischer Texte wie Gebete und Psalmen muss man annehmen, dass die ‚Leser‘ sie auswendig rezitieren konnten. Voraussetzung ist die Aufnahme ins Gedächtnis, das beim letzten Beleg eine zentrale Rolle spielt und ebenfalls einen Aspekt des Lesens bildet. Das Gedächtnis ist der Wert des Attributs ZIEL im Präpositionalobjekt í minnissjóð ‚in den Gedächtnisbeutel‘ und gehört wiederum in den Attributframe des Lesers. Die ‚Gier‘ nach diesen ‚göttlichen Reichtümern‘ bildet einen Wert für das Attribut INTENTION im Präpositionalobjekt með e-u. Lesen ist also sowohl das Studieren eines schriftlichen Textes als auch das Rezitieren dieses Textes aus dem Gedächtnis, der beim Lesen zwar präsent sein konnte, aber nicht unbedingt abgelesen wurde. Beim Lesen von Gebeten als Busse spielt zudem das Attribut FREQUENZ eine Rolle, welche einmal den Wert fimmtigum sinna ‚fünfzigmal‘ bekommt. Im Kontext sind noch weitere Attribute wie GEFAHR, ORT, QUELLE, RAHMEN, und SPRACHE, vorhanden, welche zwar nicht als Ergänzung von lesa belegt sind, für das Verstehen aber entscheidend sind.
Die Kollokation lesa messu stellt auch in der L-Redaktion einen Sonderfall dar, weil sie nicht für das Lesen eines bestimmten Textes, sondern für das Abhalten der Messe steht und ist folglich eine Synekdoche, weil das Lesen nur einen Teil der Messe ausmacht. Dies verdeutlicht die Verschiebung des Attributs RAHMEN mit dem Wert messa in das Akkusativobjekt, welches in der Regel für den TEXT steht. Bei den übrigen Belegen wird nur ein Wert des Attributframes verschoben. Die Funktion des Dativobjektes ist angesichts der verschiedenen Formen und Bestandteile der Messe schwer zu beurteilen. Es kann sich um einen ZUHÖRER, TEILNEHMER, EMPFÄNGER o.ä. handeln. Klarer ist die Rolle des Causers, welcher für den AUFTRAGGEBER der Messe steht mit dem Wert biskup. Der Wert herbergi ‚Raum, Zimmer‘ für das Attribut ORT verdeutlicht beim Messeframe den Defaultwert kirkja ‚Kirche‘. Bei der Messe spielt auch das Attribut ZEIT mit Wochentagen als Werten eine Rolle, das in enger Beziehung zum Attribut FREQUENZ steht.
2.3. Sturlunga saga
Das Belegmaterial der Sturlunga saga ist mit 14 Belegen umfangreicher als jenes der Jóns saga helga und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht. Es soll, um vergleichen zu können, zuerst auf die Gemeinsamkeiten eingegangen werden. Die Kollokation lesa bók fehlt zwar in der Sturlunga saga, aber es gibt eine vergleichbare Kollokation lesa psaltara ‚den Psalter lesen‘, da psaltari ein Hyponym zu bók ist. Eng verbunden mit dem Psalter ist das Lesen der Psalmen (lesa psalma), das im selben Kapitel behandelt wird. Die Konstruktion lesa e-t yfir e-m ist ebenfalls einmal belegt, die als nächstes analysiert wird. Damit vergleichbar ist lesa bannsetning ‚den Kirchenbann verlesen‘, weil es sich ebenfalls um einen performativen Sprechakt handelt. Unterschiedlich gestalten sich die folgenden Kollokationen: lesa stafkarlaletr ‚die Bettlerschrift lesen‘, lesa bréf ‚den Brief lesen‘ und lesa sǫgu ‚die Geschichte lesen‘, auf welche abschliessend eingegangen wird.
2.3.1. lesa psaltara/psalma ‚Psalter/Psalmen lesen‘
Der Psalter war das Gebetsbuch der Christen im Mittelalter (vgl. Peppermüller 1997: 296) und eines der wichtigsten liturgischen Bücher, das neben den biblischen Psalmen auch andere liturgische Texte enthalten konnte. In der Frühzeit war er „das Christusgebetbuch schlechthin“ in der Kirche und in Mönchsgemeinschaften und im Spätmittelalter war er „das Bildungsbuch in der Hand des Laien“ (vgl. Stork 1992: 52). Psalmenlesung geschah immer auswendig (ex corde), die diversen heute noch erhaltenen Prachtpsalterien dienten lediglich der Repräsentation (vgl. Häussling 1997: 260–265; Green 2007: 62f.).
Die Kollokation lesa psaltara ist einmal in der Króksfjarðarbók überliefert: „Oddr svaf litit vm nottina ok savng lenge ok las psaltara sinn“ (StS2 234). ‚Oddr schlief wenig in der Nacht und sang lange und las seinen Psalter‘ (Übers. KM). Subjekt in diesem Satz ist Oddr Þórarinsson, ein Laie aus dem Geschlecht der Svínfellingar. Das Akkusativobjekt ist psaltara sinn, dessen reflexives Possessivpronomen das Subjekt als Besitzer identifiziert. Der Psalter impliziert einen Kodex als Schriftträger. Höchstwahrscheinlich handelt es sich trotz Fehlens anderer Personen um lautes Lesen, weil das Aussprechen des Wortes Gottes zentral für den Glauben ist (Angenendt 2009: 477). Es handelt sich also sicher um Rezitieren, aber die Präsenz des Schriftträgers bedeutet nicht unbedingt, dass daraus gelesen wurde. Im Kontext werden abhängig vom Verb syngja ‚singen, rezitieren‘, noch die Zeitangaben lengi ‚lange‘ und um nóttina ‚in der Nacht‘ genannt. Die Lexeme lengi und nótt können als Werte einem Attribut ZEIT zugeordnet werden, innerhalb des Attributframes genauer der DAUER und dem ZEITPUNKT.
Neben dem Lesen des Psalters gibt es ebenfalls in der Svínfellinga saga, die in der Króksfjarðarbók überliefert ist, zwei Belege für das Lesen von Psalmen. Die beiden Belege gehören in dieselbe Szene, in der Sæmundr Ormsson bei einem Streit mit Ǫgmundr Helgason niedergeschlagen wird. Die Leute wundern sich, dass seine Leiche nicht blutet. Dann geschieht Folgendes: „Guðmundr Orms son ok prestarnir lasu þa vii psalma“ (StS2 127). ‚Guðmundr Ormsson und die Priester lasen dann sieben Psalmen‘ (Übers. KM). Die Kollokation lesa psalma rekurriert danach in einem Nebensatz: „Guðmundr mælti til Augmundar, þa er þeir havfðo lesit psalmana: […]“ (StS 127). ‚Guðmundr sprach zu Ǫgmundr, nachdem sie die Psalmen gelesen hatten: […]‘ (Übers. KM). Beide Belege verweisen auf dieselbe Handlung. Subjekt sind Guðmundr Ormsson, ein Laie, und die drei Priester Þormóðr, Hjalti und Sæmundr aus Kirkjubœr. Das Akkusativobjekt in beiden Belegen ist [sjau] psalma ‚sieben Psalmen‘, mit denen die sieben Busspsalmen der katholischen Kirche (Psalm 6, 23, 38, 51, 102, 130 und 143) gemeint sind (vgl. Jóhannesson 1946: II, 301). Das Lesen findet unter freiem Himmel statt und es wird nicht erwähnt, ob die Priester einen Psalter dabei hatten. Mit oder ohne Schriftträger wurden die Psalmen wahrscheinlich auswendig rezitiert. Dabei sind noch weitere Personen als Zuhörer erwähnt, so dass sicher hörbar gelesen wurde.
In diesem Zusammenhang ist noch ein dritter Beleg zu beachten. Vor Sæmunds Tötung beichten die beiden Brüder Sæmundr und Guðmundr bei den Priestern Þórmóðr und Hjalti. Darauf heisst es: „eptir þat lasu þeir letaniam“. (StS2 127). ‚Danach lasen sie die letaniam‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen þeir ‚sie (m. Pl.)‘ im Subjekt steht für die beiden Priester, welche die Beichte abgenommen haben. Der Wert für den LESER ist folglich prestr. Das Akkusativobjekt lat. letaniam (Akk. Sg.) ist eine mittellateinische Variante zu lat. litania ‚öffentliches Beten zu Gott, Litanei‘ (vgl. Georges 1998: II, 675, Küppers 1991). Jóhannesson (1946: II, 301) deutet es als andlátsbæn ‚Sterbegebet‘. Lat. litania ist somit ein Wert für die TEXTSORTE, der metonymisch zum TEXT verschoben ist. Die Litanei erfüllt als Gebet im Mittelalter aber diverse Funktionen, von denen das Sterbegebet nur eine ist (vgl. Gjerløw 1965, Küppers 1991). In diesem Kontext trifft sie nur beschränkt zu, weil Sæmundr erst danach stirbt. Die Situation erinnert an die Jóns saga helga (vgl. Kap. III.2.2.4.d. und e.), wo Jón ebenfalls ein Gebet nach der Beichte zweier Kameraden spricht. Wie dieses und die Psalmen wurde die Litanei wohl aus dem Gedächtnis rezitiert. Die Präsenz eines Schriftträgers lässt sich dabei nicht ausschliessen. ZUHÖRER sind die beiden Brüder und die übrigen anwesenden Personen.
2.3.2. lesa e-t yfir e-m ‚etw. über jdm. lesen‘
Die Kollokation lesa e-t yfir e-m ist ebenfalls in der Króksfjarðarbók belegt, wo der Bischof Guðmundr Arason gezwungen wird, den Kirchenbann aufzuheben. Stattdessen liest er lediglich einen Psalm mit dem Anfang miserere (vgl. Jóhannesson 1946: 1, 558): „Þat varð við bæn þeira, er davða-menn voro, at biskup vann þat til lifs þeim, at hann las yfir þeim miserere, oc segir þeim at þa voro þeir eigi lavsari enn aðr“ (StS1 287). ‚Es geschah beim Gebet derer, welche dem Tod geweiht waren, dass Bischof [Guðmundr] das für ihr Leben einsetzte, dass er über ihnen das miserere las, und sagt ihnen, dass sie dann nicht freier als vorher seien‘ (Übers. KM). Das Subjekt hann verweist auf biskup ‚Bischof‘, einen Wert für das Attribut LESER. Lat. miserere im Akkusativobjekt kann als Wert dem Attribut TITEL zugeordnet werden und ist metonymisch zum TEXT verschoben. Das Präpositionalobjekt yfir þeim enthält die Todgeweihten (dauðamenn). Der Modifikator dauði ‚Tod‘ des Kompositums dauðamenn verweist zwar auf die in Fritzner/Hødnebø (1972: 222) postulierte böse Macht (vgl. Kap. III.2.2.4.), diese kann aber durch den performativen Sprechakt des Bischofs nicht gebannt werden, wie er danach selbst sagt. Dies bestätigt jedoch, dass eben dies von den Todgeweihten erwartet wurde. Ein Schriftträger fehlt bei diesem Beleg, es ist aber gut möglich, dass der Bischof einen Psalter bei sich hatte, aus dem er vorlesen konnte. Wie bei den Belegen in der Jóns saga helga steht aber auch hier das Rezitieren und der performative Sprechakt im Vordergrund. Der Sprechakt hat aber auf jeden Fall eine schriftliche Grundlage, ob sie präsent ist oder nicht.
2.3.3. lesa bannsetning ‚den Kirchenbann verlesen‘
Das Verlesen des Kirchenbannes (bannsetning) ist ebenfalls ein performativer Sprechakt, wofür es in der Króksfjarðarbók einen Beleg gibt, in dem Bischof Guðmundr Arason seinen Gegner Kolbeinn Tumason exkommuniziert: a) „Biskup oc hans menn voro a husvm vppi, oc var hann skryddr oc las hann bannsetning a norena tvngo, sva at þeir skyllðv scilia“ (StS1 278). ‚Der Bischof und seine Leute waren oben bei den Häusern und er war im Ornat und las den Kirchenbann in der nordischen Sprache, damit sie ihn verstehen würden‘ (Übers. KM). Subjekt von lesa ist der Bischof als LESER und das Akkusativobjekt bannsetning ist ein Wert für den INHALT. Dem folgt das Präpositionalobjekt á norrœna tungu, welches eine Bezeichnung tunga ‚Zunge, Sprache‘ für das Attribut SPRACHE, sowie den Wert norrœnn ‚nordisch‘ enthält. Neben dem Bischof und Kolbeinn Tumason müssen noch weitere Zuhörer anwesend sein, worauf das Personalpronomen þeir (Nom. Pl. m.) hinweist, das im Finalsatz enthalten ist, welcher die Erwähnung der Sprache erklärt. Ein Schriftträger wird nicht erwähnt. Möglicherweise handelt es sich um einen Brief wie in der Laurentius saga biskups (vgl. Kap. III.2.4.1.4.d–e.). Es fragt sich hier besonders, in welcher Sprache der Kirchenbann geschrieben war. Im Falle der Laurentius saga biskups bedeutet Latein kein Verständnisproblem, da sowohl der Leser Laurentius als auch die exkommunizierten Chorherren diese Sprache verstanden. Die erwartete Sprache scheint auch in der Sturlunga saga Latein zu sein, sonst wäre die explizite Hervorhebung der Sprache nicht nötig gewesen. Dies wird auch in der Anmerkung der Edition von Jóhannesson (1946: 1, 557) vermutet. Der Beleg demonstriert, dass Constraints zwischen den Werten der Attribute SPRACHE, TEXT und ZUHÖRER bestehen.
Eine andere Stelle in der Króksfjarðarbók, wo Bischof Sigvarðr den Kirchenbann verliest, gibt mehr Aufschluss über den Schriftträger (bók), erwähnt aber die Sprache nicht: b) „Hann var skrydðr ok hafði mitr aa haufði, enn bagal i henndi, bók ok kerti i annarri; hefr hann nu upp bann-setning við Vrækiu ok hans menn alla“ (StS1 565). ‚Er war im Ornat und hatte eine Mitra auf dem Kopf, den Bischofsstab in der Hand, ein Buch und eine Kerze in der anderen. Er beginnt/verkündet nun den Kirchenbann gegen Órœkja und alle seine Männer‘ (Übers. KM). Es heisst hier auch nicht explizit, dass der Bann verlesen wird, da anstelle von lesa die Partikelverben hafa upp ‚verkünden‘ oder hefja upp ‚beginnen‘ verwendet werden, die in der 3. Sg. Ind. Präs. homonym sind. Es fragt sich ausserdem, wie der Bischof sowohl Buch als auch Kerze in einer Hand hielt. Exkommunizierte im Präpositionalobjekt við e-n sind Órœkja Snorrason und seine Leute, so dass es mindestens einen Laien gab, der wohl ebenfalls kein Latein verstanden hätte.
2.3.4. lesa stafkarlaletr ‚Bettlerschrift lesen‘
Lesen, wenn es nicht Sammeln ist, setzt eine Schrift voraus. Eine Schrift wird aber nur in einem Fall in der Króksfjarðarbók explizit erwähnt, wo das Hapaxlegomenon stafkarlaletr ‚Bettlerschrift‘ das Akkusativobjekt von lesa ist. Die Schrift, welche sonst überall implizit bleibt, wird in diesem Beleg explizit genannt, da sie ein Hindernis beim Lesen darstellt:
Snorri sagdi fra skiptum þeira sona Hallueigar; hann hafði þar ok bref, er Oddr Sueinbiarnar son hafði sennt honum af Alfta-nesi; var þar aa stafkarla-letr, ok fengu þeir eigi lesit, enn sva þotti þeim, sem uaurun naukur mundi aá vera (StS1 551).
Snorri [Sturluson] erzählte von den Auseinandersetzungen der Hallveigssöhne. Er hatte da auch einen Brief, den Oddr Sveinbjarnarson ihm aus Alptanes geschickt hatte. Darauf war eine Bettlerschrift und sie schafften es nicht, sie zu lesen, aber dann fanden sie, dass darauf irgendeine Warnung sein müsste (Übers. KM).
Subjekt von lesa ist das Personalpronomen þeir, welches sich auf Snorri Sturluson und seine Verwandten bezieht. Das Akkusativobjekt ist eine Leerstelle, welche auf das zuvor genannte Kompositum stafkarlaletr verweist, dessen Bedeutung nicht sicher geklärt ist. Wahrscheinlich handelt es sich um eine armselig aussehende Schrift, welche deshalb nicht lesbar ist (vgl. Müller 2017). Eine andere Möglichkeit ist eine Geheimschrift (vgl. Pakis 2008, Baetke 2002: 595) oder Runen (vgl. Fritzner 1886–96: III, 513).
Der SCHRIFTTRÄGER, der sonst häufig das Akkusativobjekt besetzt, wird in diesem Beleg im Kontext erwähnt, als Ort der Schrift (þar á ‚darauf‘ als Proadverb für á bréfi ‚auf dem Brief‘). Auf dem Brief befindet sich neben der Schrift die BOTSCHAFT, welche aber durch die unlesbare Schrift unzugänglich ist und nur als Warnung (vǫrun) vermutet werden kann. Wie es zu dieser Vermutung kam, wird in der Erzählung nicht näher geschildert. Bei einer schlecht lesbaren Schrift wären einzelne Wörter vielleicht lesbar, welche eine Interpretation zuliessen, dasselbe könnte auch auf einen verschlüsselten Text gelten. Vielleicht war den Lesern das Verschlüsselungsprinzip bekannt, sie schafften es aber nicht, alle Wörter des Briefes richtig zu dekodieren.
Der Beleg demonstriert einerseits, dass ein Attribut SCHRIFT im Frame vorhanden ist und in den übrigen Belegen wohl einen Defaultwert latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘ hat. Andererseits zeigt er, dass im Konzept von lesa nicht nur das Rezitieren, sondern auch das Entziffern enthalten ist.
2.3.5. lesa bréf ‚einen Brief verlesen‘
Die Kollokation lesa bréf tritt in der Sturlunga saga ausschliesslich in zwei Kapiteln1 der Þorgils saga skarða. Die beiden Kapitel sind in der Reykjarfjarðarbók überliefert, die sich an der Stelle jedoch in einem schlechten Zustand befindet, was die vielen Ergänzungen des Editors in eckigen Klammern erklärt. Ein Teil ist auch im Fragment NRA 56 erhalten (vgl. StS2 329–331), worauf weiter unten eingegangen wird.
Im ersten der beiden Kapitel wird an einem Fest ein Brief gelesen: a) „Þorleifr [í Gǫrðum hafði sent Eyjólfi bréf]; var þat lesit [at veizlunni“ (StS2 150). ‚Þorleifr von Garðar hatte Eyjólfr einen Brief gesandt. Dieser wurde am Fest verlesen‘ (Übers. KM). Das Verb ist im Passiv mit dem Subjekt þat, welches sich auf bréf bezieht. Das Verb hat als zweite Ergänzung das Präpositionalobjekt at veizlunni ‚am Fest‘, welches ein Wert für den RAHMEN darstellt, in dem gelesen wird und auch ZUHÖRER impliziert, so dass es sich um Lesen mit Stimme handeln muss.
Die Umstände im zweiten der beiden Kapitel sind dank der sieben Belege wesentlich klarer. Þorgils Bǫðvarsson skarði versucht dort mit Briefen des norwegischen Königs seinen Anspruch auf den Eyjafjǫrðr durchzusetzen. Er versammelt (stefndi) bei seiner Ankunft seine Freunde und Verwandten, so dass der RAHMEN einer Versammlung gegeben ist, und lässt seine Bestallungsurkunde vorlesen: b) „Birti Þorgils þá ráðagerðir sínar ok lét lesa] skipanar-[bréf sitt ok kvaddi menn til ferðar með sér]“ (StS2 150). ‚Þorgils machte dann seine Pläne bekannt und liess seine Bestallungsurkunde und forderte die Leute auf, mit ihm mitzukommen‘ (Übers. KM). Das Verb lesa ist in der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. enthalten mit Þorgils als Subjekt und AUFTRAGGEBER. Das Agens ist eine Leerstelle und das Thema skipanarbréf, ein Kompositum aus dem Kopf bréf und dem Modifikator skipan ‚Bestimmung‘. Letzterer ist ein Wert für das Attribut BOTSCHAFT. Einerseits deutet der Kausativ auf eine Zuhörerschaft hin (vgl. Green 2007: 18f.), andererseits auch die anschliessend genannten menn ‚Leute‘. Es kann anhand dieses Beleges jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass jeder dieser Leute den Brief für sich las. Der nächste Beleg ist diesbezüglich deutlicher. Þorgils beruft eine Versammlung mit den Bauern aus dem Gebiet ein und sagt: c) „Man hér lesit vera konungsbréf. Bið ek, at] [me]nn gefi her til [gott hljóð ok hyggi síðan at svǫrum]“ (StS2 151). ‚Hier werden Königsbriefe verlesen werden. Ich bitte, dass die Leute dem gut Gehör schenken und sich dann Antworten überlegen‘ (Übers. KM). Das Verb lesa ist passiv und hat das Kompositum konungsbréf als Subjekt, mit dem Modifikator konungr ‚König‘ als Wert für den ABSENDER. Das Lokaladverb hér ‚hier‘ verweist auf den RAHMEN, für welchen der Wert fundr ‚Versammlung‘ aus dem Kontext inferiert werden kann. Die im nachfolgenden Satz genannten Substantive hljóð ‚Gehör‘ und menn ‚Leute‘ weisen einerseits auf eine auditive Wahrnehmung und andererseits auf ZUHÖRER hin, so dass lesa hier eindeutig ‚laut lesen‘ bedeutet.
Die nächsten Belege sind sowohl in der Reykjarfjarðarbók als auch im Fragment NRA 56 erhalten und nach ersterer Handschrift zitiert: d) „[H]ellt þa Þordr [á brefinu ok sýndi innsiglit, bað Þorleif at] fa mann til [at lesa, ef hann vildi“ (StS2 151). ‚Þórðr [Hítnesingr] hielt den Brief in den Händen und zeigte das Siegel. Þorleifr [Þórðarson von Garðar] bat darum, einen Mann zu holen, um [ihn] zu verlesen, wenn er möchte‘ (Übers. KM). NRA 56 unterscheidet sich abgesehen von der Graphie darin, dass Þorgils statt Þórðr den Brief hält (vgl. StS2 329). Lesa ist hier Teil eines Infinitivsatzes, dessen Agens maðr ‚Mann‘ sich aus dem Hauptsatz ergibt. Das Thema ist eine Leerstelle, welche auf bréf verweist. An dieser Stelle sind die unterschiedlichen Handlungen halda á bréfi ‚den Brief halten‘, sýna innsigli ‚das Siegel zeigen‘ und lesa bréf ‚den Brief lesen‘ zu beachten. Die Materialität und Visualität des Dokuments sowie das mündliche Verlesen des Inhaltes gehören alle zur Präsentation des Briefes (vgl. Teuscher 2007: 261–263, 271f.). Þorleifr verweigert die Bitte aber und nach einigen Diskussionen wiederholt Þorgils sein Begehren: e) „vita skulot þer þat Þorleifr, at ek ętla at lata lesa her i dag konungs bref ii eda iii opinberliga, sva at þer heyrit“ (StS2 151). ‚Ihr sollt wissen Þorleifr, dass ich heute hier zwei oder drei Königsbriefe verlesen lassen werde, so dass ihr [sie] hört‘ (Übers. KM). Bei diesem Beleg unterscheidet sich NRA 56 abgesehen von der Graphie darin, dass die Zahlen „ii eda iii“ ‚zwei oder drei‘ fehlen (vgl. StS2 329). Das Personalpronomen ek ‚ich‘ im Subjekt von lesa in der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. steht für Þorgils als AUFTRAGGEBER. Das Agens bildet eine Leerstelle und das Thema ist wiederum konungsbréf. Die Deiktika hér ‚hier‘ und í dag ‚heute‘ verweisen auf die bisherige Situation. Das Adverb opinberliga ‚öffentlich, offenkundig‘ (vgl. Baetke 2002: 468) stellt hier einen Wert für das Attribut STIMME dar und entspricht dem bei Green (2007: 18f.) erwähnten mhd. offenlîche. Dass laut gelesen wird, verdeutlicht auch der nachfolgende Konsekutivsatz, in dem mit dem Personalpronomen þér ‚ihr‘ die Teilnehmer der Versammlung angesprochen werden und das Verb heyra ‚hören‘ auf die auditive Wahrnehmung verweist. Der Konsekutivsatz enthält zudem einen Wert zum Attribut INTENTION, der sich aber nicht als Lexem identifizieren lässt. Þorgils will, dass die Briefe bekannt und hörbar gemacht werden, wozu Verben wie verlautbaren oder veröffentlichen passen. Semantisch nahe ist das Adverb opinberliga.
Þorgils kann später doch durchsetzen, dass die mitgebrachten Briefe verlesen werden: f) „Let Þorgils þa lesa bref konungs, ok gerdi Þordr Hitnesingr. En er bref var lesid, þa toko menn eigi skiott til svara“ (StS2 152). ‚Þorgils liess dann die Briefe des Königs verlesen, und [das] tat Þórðr Hítnesingr. Aber als der Brief verlesen worden war, begannen die Leute nicht sofort zu antworten‘ (Übers. KM). Lesa hat hier zwei Belege, einmal in der Kausativkonstruktion mit láta + Inf. mit Þorgils als Subjekt und bréf als Akkusativobjekt. Das Agens ist zwar wieder eine Leerstelle, die aber mithilfe des nachfolgenden Satzes (ok gerði Þórðr Hítnesingr) gefüllt werden kann. Der LESER ist folglich Þórðr Hítnesingr. Weil das Agens nun eine einzelne Person ist, handelt es sich sicher um lautes Lesen. Der zweite Beleg ist im Passiv und hat wieder bréf als Subjekt. AUFTRAGGEBER und LESER sind hier wahrscheinlich dieselben wie beim ersten Beleg. Das Attribut ZUHÖRER bekommt aus dem Hauptsatz wieder den Wert menn ‚Leute‘. NRA 56 unterscheidet sich beim zweiten Beleg lediglich formal, weil lesa im Mediopassiv steht: g) „En er brefit hafdi lesizt“ (StS2 329). ‚Aber als der Brief gelesen worden war‘ (Übers. KM). Da das Subjekt bréf im Singular ist und unbelebt ist, kann eine reflexive oder reziproke Lesart ausgeschlossen werden, so dass es sich funktional ebenfalls um ein Passiv handelt, das sich rein formal unterscheidet.
Obwohl zwei oder drei Briefe verlesen werden sollen, wird nur noch ein zweiter erwähnt: h) „Þa let Þorgils lesa konungs bref þat, er Þorleifi var sent“ (StS2 152) ‚Dann liess Þorgils jenen Brief des Königs vorlesen, welcher Þorleifr gesandt wurde‘ (Übers. KM). NRA 56 unterscheidet sich hier lediglich in der Graphie (vgl. StS2 330). Lesa ist wieder kausativ mit dem AUFTTRAGEBER Þorgils im Subjekt, einem leeren Agens und konungsbréf im Akkusativobjekt. Der angedeutete dritte Brief wird im Kapitel nicht mehr erwähnt.
Die acht Belege von lesa bréf ergeben folgendes Bild: Wegen des Passivs, Kausativs und Infinitivsatzes ist das Agens fast immer eine Leerstelle und kann nur in zwei Fällen anhand des Kontextes gefüllt werden. Für das Attribut LESER ergeben sich die Werte maðr, und Þórðr Hítnesingr, ein Schwiegersohn des Sturlungen Bǫðvarr Þórðarson (vgl. StS2 136), über dessen Bildung in der Sturlunga saga nichts erwähnt wird. AUFTRAGGEBER ist als Subjekt der Kausativkonstruktion láta lesa immer Þorgils skarði, ein Sturlunge und Hauptperson der Saga. Das Thema ist immer bréf, ein Wert für das Attribut TEXT. Die Modifikatoren konungr und skipan sind Werte für die Attribute ABSENDER bzw. BOTSCHAFT. Der RAHMEN ist nur einmal explizit als Präpositionalobjekt at veizlu erwähnt. Auf den RAHMEN verweist aber wahrscheinlich auch das Lokaladverb hér. Die STIMME hat nur einmal den Wert opinberliga als Adverb. Die im Kontext erwähnten Lexeme hljóð und heyra deuten daraufhin, dass es sich um lautes Lesen handelt und es ZUHÖRER gibt. Die Kollokationen halda á bréfi und sýna innsigli deuten darauf hin, dass lesa bréf Teil einer Präsentation des Briefes darstellt.