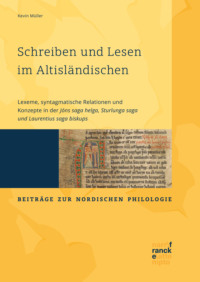Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 31
Der zweite Beleg ist sehr ähnlich, aber weniger eindeutig: „þá gengu þeir fyrir konung ok báru fram bréf Knúts konungs ok segja ørendi þau, sem fylgðu, at […]“ (Jónsson 1911: 308). ‚Dann gingen sie vor den König und trugen/wiesen die Briefe des Königs Knútr vor und sagten die Anliegen, die folgten, dass […]‘ (Übers. KM). Auf den mündlichen Vortrag wird bei diesem Beleg mit segja ‚sagen‘ verwiesen. Es handelt sich aber nicht um einen Relativsatz, sondern um einen mit der Konjuktion ok ‚und‘ verbundenen Hauptsatz, so dass das Erzählen des Anliegens zusätzlich zur Präsentation des Briefes geschehen kann, die auch Verlesen beinhalten kann.
Semantisch sehr unterschiedlich zu Spurklands (2000) Belegen und zum vorliegenden Korpus ist im ONP (bera) unter Punkt 9 noch ein letzter Beleg aus der Barlaams saga ok Jósafats: „En þa bok gerðu þeir oc fram baro. er með sialfum kristi varo“ (Rindal 1981: 22). ‚Aber dieses Buch machten und überlieferten jene, die bei Christus selbst waren‘ (Übers. KM). Bei diesem Beleg ist „fram baro“ eine Übersetzung von lat. tradiderunt ‚übergaben/-lieferten‘. Eine Bedeutung ‚verkündeten‘ wie unter Punkt 8 lässt sich an dieser Stelle nicht ausschliessen. Um eine konventionelle Bedeutung ‚überliefern‘ zu bestätigen, bräuchte es mehr Belege.
Diese erweiterte Belegreihe widerspricht den obigen Annahmen nicht, kann sie aber auch nicht bestätigen. Eine besondere Schwierigkeit stellt das Lexem bréf dar, weil es verschiedene Konzepte umfasst, so dass bezüglich bera fram nicht entschieden werden kann, ob der Schriftträger, das Skript, der Text, die Botschaft oder alle im Vordergrund stehen. Eindeutiger sind Lexeme wie ørendi oder passio.
8. Der Wortschatz des Lesens und seine Frames
In der Einleitung (s. Kap. III.1.) wurden anhand der bisherigen Forschung folgende Attribute für das Lesen postuliert: LESER, SCHRIFT, TEXT, ZUHÖRER, STIMME, SCHRIFTTRÄGER, SPRACHE, KÖRPER, GEFAHR, GEDÄCHTNIS und RAHMEN. Im Laufe der Analyse sind noch weitere hinzugekommen: AUFTRAGGEBER, GENAUIGKEIT, INTENTION, ORT, TEIL, ZEIT, ZIEL und ZWECK. Bis auf die drei Attribute GEFAHR, GEDÄCHTNIS und KÖRPER konnten im Rahmen der Analyse alle Attribute als Ergänzung eines Frames festgestellt werden. Die GEFAHR war in beiden Redaktionen der Jóns saga helga nur im Kontext nachzuweisen, wobei es fraglich bleibt, ob sich diese Gefahr tatsächlich aus dem eigentlichen Lesen ergibt, oder nicht generell eine Folge des Aussprechens und Wahrnehmens im Zuge des Lesens darstellt. Der KÖRPER und das GEDÄCHTNIS gehören in den Attributframe des LESERS, der in einem weiteren Schritt noch genauer analysiert werden sollte, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist. Das GEDÄCHTNIS ist nicht nur Grundlage beim auswendigen Rezitieren, sondern vor allem Ziel des Lesens, weil das Gelesene darin aufgenommen wird. Es lässt sich lediglich als Wert minnissjóðr ‚Gedächtnisbeutel‘ des Attributs ZIEL nachweisen. Der KÖRPER ist unweigerlich Teil des Lesers und entscheidend für die STIMME, wird aber weder im Kontext des hier analysierten Korpus noch ausserhalb explizit erwähnt.
Die Frames der in dieser Arbeit untersuchten verba legendi überschneiden sich an verschiedenen Stellen. Die meisten der oben erwähnten Attribute weist der Frame des Verbs lesa auf. Es fehlen lediglich die Attribute GENAUIGKEIT, und ZWECK sowie die bereits ausgeschlossenen Attribute GEFAHR, GEDÄCHTNIS und KÖRPER. Lesa wird deshalb als erstes in diese abschliessende Betrachtung genommen. Sein Kernframe besteht aus dem LESER als Agens und dem TEXT als Thema. Der TEXT stellt den Ausgangspunkt des Lesens dar. Die Werte gehören wie beim Schreiben zu verschiedenen Attributen des Attributframes wie TEXTSORTE, INHALT oder SCHRIFTTRÄGER. Der SCHRIFTTRÄGER bildet zudem ein eigenständiges Attribut im Frame von lesa, auf welches das Präpostitionalobjekt af e-u verweist. Sowohl in den Text- als auch in den Leseframe gehört das Attribut SPRACHE, auf welches das Präpositionalobjekt á e-t/-u verweist. Zentral für den Text ist wegen seiner Schriftlichkeit jedoch das Attribut SCHRIFT, auf welches wiederum das Thema verweist. Diese Attributbezeichnung hat sich im Schreibframe allerdings als unpräzise erwiesen (vgl. Kap. II.10). Es empfiehlt sich deshalb, die Unterscheidung in SCHRIFTSYSTEM und GRAPHIE in den Leseframe zu übernehmen. Für das SCHRIFTSYSTEM kann wie bei rita, ríta und skrifa ein Defaultwert latínu stafróf ‚lateinisches Alphabet‘ erwartet werden. Dies steht wohl im Kontrast zum Verb ráða ‚Runen lesen‘, das sich aber im behandelten Korpus nicht in einem schriftlichen Kontext belegen liess. Bezüglich Schrift gibt es beim Lesen Hindernisse, wenn der Leser das Schriftsystem nicht kennt oder die schlechte Qualität der Graphie das Lesen verunmöglicht. Ein solcher Fall ist im Beleg mit stafkarlaletr ‚Bettlerschrift‘ in der Sturlunga saga gegeben. Dieser Beleg hebt zudem eine zentrale strukturelle Invariante im Frame hervor, das Entziffern. Diesbezüglich liessen sich die beiden Attribute wieder zur Schrift vereinen, jedoch spielt die Graphie auch an anderer Stelle noch eine eigenständige Rolle, was weiter unten behandelt wird.
Eine zweite strukturelle Invariante, welche zwischen den Attributen LESER und TEXT besteht, stellt das Sammeln von Wissen dar. Aisl. lesa ist wie lat. legere eine Metapher. Das Sammeln von Früchten wurde auf das Sammeln von Wissen aus Texten übertragen. Diese Metaphorik wird besonders in einem Beleg aus der Jóns saga helga deutlich, wo mit heiliger Gier aus dem Überfluss göttlicher Reichtümer in den Gedächtnisbeutel gesammelt wird. Der Text stellt die Quelle des Wissens dar und das Gedächtnis des Lesers das Ziel.
Die dritte strukturelle Invariante im Kernframe ist das Rezitieren. Diese muss aber nicht direkt aus dem Entziffern erfolgen. Der Leser kann den Text auswendig lernen und ihn unabhängig vom Schriftträger rezitieren. Dies ist einerseits vom Gedächtnis des Lesers, andererseits vom Gebrauch des Textes abhängig. Entscheidend für die Art des Lesens ist also der Wert des Attributs TEXT. Bei bestimmten liturgischen Texten muss davon ausgegangen werden, dass der Leser sie, ohne abzulesen, rezitieren konnte, was Green (2007) figurative reading nennt. Dies setzt aber voraus, dass der Text in schriftlicher Form existierte und einmal gelesen wurde. Folglich existierte der gelesene Text aber nicht nur in einer schriftlichen, sondern auch in einer mündlichen Form. Letztere ergibt sich aus der Wiedergabe des Lesers, wodurch das Attribut LESER ins Spiel kommt. Green (2007) hat zum Leser eine Typologie erstellt, die in ocular, oral und aural reader unterscheidet. Erstere beide lassen sich im Frame von lesa nachweisen und treffen beide auf das Attribut LESER zu, letzterer allerdings nicht, weil er sich im Attribut ZUHÖRER manifestiert. Die strukturelle Invariante zwischen ZUHÖRER und TEXT wird in diversen Belegen durch das Verb heyra ‚hören‘ ausgedrückt, das die Konversion von lesa darstellt. Das heisst ein Konzept wie Hugo von St. Viktors lego librum ab illo lässt sich für aisl. lesa in den drei hier untersuchten Sagas nicht nachweisen. Bezüglich aural reader stellt ein Beleg eine Ausnahme dar, in welchem sich die beiden Verben das Subjekt teilen. Der oral reader hört durchaus seine eigene Stimme, so dass er eigentlich immer ein aural reader ist. Ob die Wahrnehmung primär über Auge oder Ohr ging, liess sich im vorliegenden Korpus nicht überprüfen.
Greens (2007) Typologie steht im Zusammenhang mit der Erforschung des Medienwandels von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. Die Frage, ob laut oder still bzw. öffentlich oder individuell gelesen wurde, lassen verba legendi verschiedener Sprachen wie lat. legere, mhd. lësen wie auch aisl. lesa aber offen. Um diese Frage zu beantworten, sind vier weitere Attribute ausserhalb des Kernframes entscheidend: Erstens die STIMME, die bei lesa keinen Defaultwert laut oder still hat. Der Wert kann als Adverb ergänzt werden. Hier besteht eine Parallele zwischen den synonymen Adverbien aisl. opinberliga und mhd. offenlîche ‚öffentlich‘, die lautes Lesen implizieren. Die Werte zu diesem Attribut enthalten aber weit mehr Informationen als laut oder still und lassen sich im Attributframe verschiedenen Attributen wie HÖRBARKEIT, RICHTIGKEIT, ÄSTHETIK oder RHETORIK zuordnen. So sollte ein Text in einem öffentlichen Rahmen nicht nur hörbar, sondern auch korrekt, mit schöner Stimme und mit rhetorischem Geschick vorgelesen werden. Diese Adverbien als Werte für das Attribut STIMME lassen sich aber im hier untersuchten Korpus nur in einzelnen Belegen nachweisen. In den anderen Belegen muss der Wert zur STIMME hingegen aus dem Kontext oder über Constraints inferiert werden. Das öffentliche und individuelle Lesen, die beide eng mit der STIMME zusammenhängen, werden von den Werten des Attributs RAHMEN bestimmt, das sich als thematische Rolle ORT manifestiert. Dieses zweite Attribut wurde in der bisherigen Forschung zum Wortschatz des Lesens nicht einbezogen. Seine Werte sind im vorliegenden Korpus ebenfalls nur sporadisch belegt, weil der Rahmen meistens im Kontext thematisiert wird. Deshalb wäre es auch hier im Anschluss nötig, den Attributframe näher zu analysieren, um insbesondere die Lesevorgänge in den jeweiligen Rahmen besser einordnen zu können. Drittens deutet die Anwesenheit von Zuhörern darauf hin, ob laut oder still gelesen wurde. Die Zuhörer sind einerseits Teil des Rahmens – d.h. zwischen den Attributen RAHMEN und ZUHÖRER besteht ein Werteconstraint, andererseits bilden sie eine Ergänzung des Verbs lesa im Dativobjekt wie bei lat. legere oder in den Präpositionalobjekten fyrir oder yfir e-m, ähnlich wie mhd. vor oder das Präfix in lat. prælegere. Bei diesen Ergänzungen im Altisländischen ist zu beachten, dass sie nur auf den INTENDIERTEN ZUHÖRER referieren. In diesem Zusammenhang stehen auch die Attribute INTENTION als Präpositionalobjekt með e-u und ZWECK Präpositionalobjekt til e-s. Die Intention des Lesers bzw. der Zweck des Lesens ist ein Sprechakt, der vom intendierten Zuhörer gehört wird. Zu den Zuhörern gehört auch der AUFTRAGGEBER als Subjekt der Kausativkonstruktion láta lesa. Der AUFTRAGGEBER ist zwar als Causer gleichzeitig ein ZUHÖRER, als Genitivattribut der Konstruktion eptir boði e-s ‚nach jds. Befehl‘ aber nicht als anwesend belegt.
Die Konzepte LAUT/STILL oder ÖFFENTLICH/INDIVIDUELL LESEN werden somit meistens von den Werten dieser vier Attribute bestimmt. Entscheidend für das jeweilige Konzept sind ausserdem die Werte und die Frames der Attribute LESER und TEXT. Die Werte des Attributs RAHMEN sind aber nicht nur für jene der STIMME relevant, sondern auch für die Lesevorgänge, welche in bestimmten Rahmen vorkommen, so beispielsweise das Verlesen einer Urkunde an einer Versammlung. Die Werte des Attributs RAHMEN hängen mit jenen zweier weiterer Attribute zusammen: ORT und ZEIT. Dies gilt besonders für das religiöse Lesen. Der ORT entscheidet darüber, ob es sich beispielsweise um meditierendes Lesen in der Zelle, um das Lesen in der Messe oder das Lesen beim Stundengebet in der Kirche handelt. Das Attribut ZEIT ist charakteristisch für das Lesen in einem religiösen Rahmen, weil in diesem Texte wiederholt, für eine bestimmte Dauer, zu bestimmen Zeitpunkten, während oder ausserhalb bestimmter Rituale gelesen werden. In den Attributframe gehören daher Attribute wie ZEITPUNKT, DAUER und FREQUENZ. Die Constraints inferieren folglich Werte für den RAHMEN und auch den TEXT.
Das Attribut RAHMEN ist also bei den Lesevorgängen von zentraler Bedeutung, weil seine Werte darüber entscheiden, wie gelesen wird. Um bestimmte Lesevorgänge herausarbeiten zu können, ist auch hier noch eine nähere Analyse des Attributframes erforderlich, der ein grosses Potential birgt, die Perspektive auf die Lesevorgänge zu erweitern, die über Dichotomien von laut und still oder individuell oder öffentlich hinausgehen.
Einen Sonderfall stellen die Kollokationen lesa messu und lesa tíðir dar, in denen die Werte messa ‚Messe‘ und tíðir ‚Stundengebet‘ des RAHMENS metonymisch zum TEXT verschoben werden. Das Rezitieren der jeweiligen Texte in diesen beiden Rahmen ist aber nur Teil des Rituals, so dass es sich in beiden Fällen um eine Synekdoche handelt. Deshalb sind die beiden Kollokationen breiter als das Abhalten des Rituals zu verstehen.
Die zahlreichen besprochenen Attribute ergeben einen umfangreichen Frame für das Verb lesa. Im Zentrum stehen, wie schon erwähnt, der LESER, welcher den TEXT entziffert, rezitiert und ihm das Wissen entnimmt. Der TEXT weist einen INHALT und eine GRAPHIE auf, und ist in einem SCHRIFTSYSTEM und einer SPRACHE geschrieben. Er lässt sich einer TEXTSORTE zuordnen und befindet sich auf einem SCHRIFTTRÄGER. Der LESER wiedergibt den TEXT mit seiner STIMME, über die der ZUHÖRER ihn wahrnimmt. Dies geschieht in einem RAHMEN, zu einer ZEIT und an einem ORT für einen AUFTRAGGEBER. Dies gibt in etwa die strukturellen Invarianten des Frames wieder. Oben wurden zudem stellenweise diverse Constraints angesprochen, welche aber im Rahmen des vorliegenden Korpus nicht systematisch analysiert werden konnten. Eine eingehende Analyse dieser Strukturen und Relationen ist nötig, um das Verb lesa vollumfänglich verstehen zu können.
Im Vergleich dazu ist der Frame der anderen hier untersuchten verba legendi enger und unterscheidet sich in gewissen Attributen und Werten. Jener des Partikelverbs lesa upp besteht aus dem gleichen Kernframe. Dazu liessen sich in den Belegen folgende Attribute mit den gleichen Ergänzungen nachweisen: AUFTRAGGEBER, ORT, RAHMEN, SPRACHE, STIMME, ZEIT, ZUHÖRER und ZWECK. Der SCHRIFTTRÄGER kommt zwar metonymisch verschoben als Thema vor, hat aber keine selbständige Ergänzung. Dies gilt auch die Attribute SCHRIFTSYSTEM und GRAPHIE. Da alle drei Attribute in den Textframe gehören, müssen sie auch Teil des Frames von lesa upp sein.
In der Zusammensetzung der Attribute lassen sich zwischen den beiden Verben keine Unterschiede feststellen, jedoch in den Werten, die bei lesa upp deutlich eingeschränkt sind. Für die STIMME ist von einem Defaultwert opinberliga ‚öffentlich‘ auszugehen und der RAHMEN ist ebenfalls öffentlich und juristisch. Der LESER von lesa upp wäre demzufolge einzig ein oral reader. Figurative reading kann ausgeschlossen werden, weil es sich bei lesa upp nicht um liturgische Texte handelt, die wiederholt gelesen wurden. Die Reduktion auf mündliches Lesen und auswendiges Rezitieren ignoriert auch bei diesem Verb wieder andere Aspekte. Zum Verlesen von Urkunden gehört auch die optische Präsentation des Dokuments, welche möglicherweise im Konzept von lesa upp enthalten ist. Dafür spricht einerseits das Fehlen des Verbs sýna ‚zeigen‘ im Kontext der Belege von lesa upp, andererseits der Beleg einer Substitution durch das Verb bera fram, welches das Vortragen des Inhalts wie auch das Präsentieren des Dokuments umfasst.
Das polyseme Partikelverb bera fram ist als verbum legendi jedoch schwierig einzuordnen, weil es für drei Arten der Präsentation steht: 1. das Erzählen einer Botschaft (bera fram oder segja ørendi), 2. das Zeigen eines Dokuments (bera fram oder sýna bréf) und 3. das Vorlesen eines Textes (bera fram oder lesa bréf). In der Kollokation bera fram bréf kommen alle Bedeutungen zum Zuge, so dass es sich um eine Synekdoche handelt, während sýna bréf ‚den Brief zeigen‘ und lesa bréf ‚den Brief verlesen‘ getrennte Prozesse sind. Dies gilt auch für die übrigen Kollokationen wie bera fram ørendi ‚die Botschaft vortragen‘ oder bera fram passionem ‚die passio vorlesen‘, die sich auf ein Konzept beschränken. Das jeweilige Konzept hängt also stark vom Frame des Themas ab. Folglich kann das Agens REDNER oder LESER sein, das Thema TEXT, oder SCHRIFTTRÄGER oder auch ÄUSSERUNG. Zu diesem Kernframe kommen noch die Attribute STIMME als Adverb und ZUHÖRER als Präpositionalobjekt fyrir e-n hinzu. Der RAHMEN ist in allen Belegen eine Leerstelle, aber dem Kontext zufolge immer öffentlich. Wenn es sich um Lesen handelt, ist der Frame ähnlich strukturiert wie jene von lesa und lesa upp, wobei bera fram im Gegensatz zu letzterem keinen Defaultwert für die STIMME und den RAHMEN hat, und der LESER von bera fram im Gegensatz zu ersterem ausschliesslich ein oral reader ist.
Analog zu lesa upp gibt es noch das Partikelverb lesa yfir als verbum legendi bei welchem das Attribut STIMME hingegen den Defaultwert nicht (deutlich) hörbar hat. Das einmal belegte Adverb skyndiliga ‚eilig‘ gehört zum Attribut GENAUIGKEIT. Es deutet auf einen Defaultwert genau oder gründlich hin, von dem es abweicht.
Der RAHMEN bleibt eine Leerstelle, ist aus dem Kontext bekannt und besteht selten aus mehr als zwei Personen. Wie bei lesa upp steht der RAHMEN zudem ausserhalb der religiösen Praxis. Der Text ist dem Leser zuvor auch nicht bekannt, so dass es sich nicht um Rezitieren aus dem Gedächtnis handeln kann. Der LESER von lesa yfir wäre demnach primär ein ocular reader und es handelt sich nicht um figurative reading. Aber auch diese Kategorien engen zu sehr ein, was nicht nur das Attribut RAHMEN demonstriert, sondern auch die GENAUIGKEIT, das für ein Konzept DURCHLESEN spricht und gegen ÜBERLESEN.
Das Attribut GENAUIGKEIT lässt sich auch als Ergänzung des Verbs líta á e-t mit dem Wert innvirðiliga ‚eingehend, genau‘ belegen. Im Gegensatz zu lesa yfir ist hier eher mit einem Defaultwert ungenau zu rechnen. Im Lateinischen wie auch in verschiedenen Volkssprachen werden verba videndi als Lexeme für das stille Lesen verwendet. Die altisländischen verba videndi sind jedoch nicht eindeutig einzuordnen, weil sie im eigentlichen Sinne ‚sehen‘ oder ‚schauen‘ bedeuten, was auch bezogen auf einen schriftlichen Text zutrifft. In diesem Zusammenhang kommt aber auch die Bedeutung ‚lesen‘ in Frage, zumal das Sehen oder Anschauen des Textes das Entziffern der schriftlichen Zeichen nicht ausschliesst. Bezogen auf einen mittelalterlichen Text ist diese Trennung in Betrachten und Lesen aber unnötig, weil die Betrachtung alle visuellen Aspekte des Schriftträgers umfasst. An dieser Stelle kommt das Attribut GRAPHIE zum Zuge, welches sich nicht als Ergänzung nachweisen lässt, aber die äusserlichen Aspekte des Skripts (letr) umfasst, die beispielsweise der Erzbischof in der Laurentius saga biskups lobt. In diesem Zusammenhang gleich von Aura zu sprechen wäre übereilt. Die Graphie ist Bestandteil jedes Skripts, auch wenn es keine Aura ausstrahlt. Das Erfassen der Graphie gehört auch ins Konzept von lesa. Somit erübrigt sich einerseits die Trennung in BETRACHTER und LESER als Agens, weil dazu lediglich die Definition von ocular reader vom sehenden Leser auf den Betrachter und Leser des schriftlichen Dokuments erweitert werden muss. Weniger eindeutig ist das Verb sjá ‚sehen‘, welches für ein nicht intendiertes visuelles Wahrnehmen als líta á e-t steht. Bezogen auf die Schrift bedeutet das, dass die Schrift als solche zwar erkannt, aber nicht unbedingt dekodiert wird. Dafür sprechen auch Belege, wo lesa yfir und sjá einander gegenüberstehen. Ersteres steht für ein genaues Durchlesen, letzteres für ein Betrachten und Verifizieren des Dokuments anhand der Graphie und Siegel. Es unterscheidet sich also auch im Attribut GENAUIGKEIT und ist somit trotzdem weitgehend synonym mit líta á e-t. Somit erübrigt sich auch hier die Dichotomie von BETRACHTER und LESER.
Die Frames der drei Verben lesa yfir, líta á e-t und sjá sind relativ eng und ähnlich. Er besteht aus dem LESER als Agens, dem TEXT als Thema– bei líta als Präpositionalobjekt á e-t – und der GENAUIGKEIT als Adverb, das bei sjá nicht als Ergänzung nachgewiesen werden konnte. Dabei muss noch bedacht werden, worauf sich die Genauigkeit bezieht, bei den beiden verba videndi auf die GRAPHIE und bei lesa yfir auf den INHALT. Die Skala der Genauigkeit erstreckt sich also vom Betrachten des Schriftträgers bis zum Erfassen des Inhalts. Die für lautes Lesen charakteristischen Attribute AUFTRAGGEBER, STIMME und ZUHÖRER fehlen. Das Attribut RAHMEN ergibt sich aus dem Kontext und ist bei allen drei Verben gleich. Es handelt sich dabei um enge Rahmen mit ein bis zwei Personen, oft Bote und Empfänger des Briefes, die lautes Lesen ebenfalls ausschliessen.
Der Vergleich der Frames erlaubt eine relativ klare Taxonomie im Wortschatz des Lesens. Da der Frame von lesa fast alle Attribute der verba legendi im vorliegenden Korpus vereint und auch die grösste Vielfalt an Werten aufweist, nimmt es die Rolle eines Hyperonyms ein. Die Hyponyme repräsentieren lediglich spezifische Konzepte. Dies gilt vor allem für die Attribute RAHMEN, STIMME und GENAUIGKEIT. Lesa upp beschränkt sich auf einen öffentlichen, juristischen Rahmen, mit entsprechender Stimme und Genauigkeit. Lesa yfir gehört im Gegenzug in einen kleinen Rahmen mit nicht deutlich hörbarer Stimme und beinhaltet genaues Lesen. Die verba videndi unterscheiden sich wiederum in der Genauigkeit. Bera fram nimmt wegen seiner Polysemie verschiedene Positionen ein. Aus dem Raster fallen auch die Synekdochen lesa messu oder bera fram bréf.
Die Beleglage der Lexeme ist unterschiedlich. Lesa und sjá sind in allen Sagas und Redaktionen belegt. Die Verben bera fram und líta á e-t fehlen einzig in der S-Redaktion der Jóns saga helga. Die Partikelverben kommen tendenziell in den jüngeren Texten vor: lesa upp ist in den jüngeren Teilen der Sturlunga saga sowie in der Laurentius saga biskups belegt und lesa yfir in der L-Redaktion der Jóns saga helga sowie in der Laurentius saga biskups. Die engeren Konzepte der jüngeren Hyponyme deuten auf eine Spezialisierung des Wortschatzes hin. Es lässt sich zwar ein lexikalischer Wandel feststellen, der bezüglich Konzepten eindeutiger wird, ein Bedeutungswandel der Lexeme aber nur schwer nachweisen, weil die drei hier untersuchten, in der Handlungs-, Entstehungs- und Überlieferungszeit unterschiedlichen Sagas inhaltlich teilweise sehr heterogen sind. Unterschiede in den Attributen und Werten der Frames erklären sich also nicht nur diachron, sondern auch inhaltlich. Die syntagmatischen Relationen scheinen jedoch erstaunlich stabil und einheitlich, weil in der Regel die gleichen Ergänzungen die gleichen Attribute repräsentieren.
Wie beim Wortschatz des Schreibens haben sich auch in dieser Analyse neue Erkenntnisse ergeben, welche die bisherige Forschung ergänzen und zum Teil revidieren. Die bisherige Forschung zum Wortschatz hat sich vor allem auf Aspekte der Schriftlichkeit und Mündlichkeit konzentriert. Spurkland (1994, 2004, 2005) hat in seinen Arbeiten zu den Runeninschriften eine lexikalische Unterscheidung in die Verben ráða und lesa festgestellt, die im Bezug zu den beiden Formen der Schriftlichkeit literacy und runacy steht, die sich in der Schrift, Materialität und Sprache unterscheiden. Im Frame betrifft das die Attribute SPRACHE, SCHRIFTSYSTEM, SCHREIBMATERIAL und -WERKZEUG, die je nach Lexem bestimmte Defaultwerte haben. Damit ist aber nur ein Teil des Frames abgedeckt.
Diese einseitige Betrachtung betrifft auch die Mündlichkeit, auf die diverse Lesepraktiken bezogen sind, die wiederum lexikalisch unterschieden werden, was die Wortpaare wie legere/videre (vgl. Green 2007, Saenger 1999), lesa/bera fram (vgl. Spurkland 2000), lesa/lesa upp (vgl. Müller 2018), lesa/sjá (Müller 2018) oder sjá/heyra (vgl. Glauser 2010) zeigen. Die Analyse beschränkt sich meistens auf solche Wortpaare, ohne ein grösseres Wortfeld und die paradigmatischen Relationen genauer zu analysieren. Die Wortpaare lassen sich in gewissen binären Merkmalen voneinander abgrenzen wie etwa ±LAUT, ±VISUELL oder ±ÖFFENTLICH. Diese Binarität resultiert aus der Komponentialsemantik, Wortfeldtheorie und dem Medienwandel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit. Dass die Binarität bei der Lautstärke nicht zutrifft, stellt schon Green (2007) fest. Wenn man das Attribut STIMME betrachtet, ist die Lautstärke oder Hörbarkeit nur ein Teil des Attributframes. Es kommen beim Lesen auch Attribute wie ÄSTHETIK, RHETORIK und RICHTIGKEIT zum Zuge, welche in dieser Forschung ignoriert wurden. Das Attribut GENAUIGKEIT umfasst wiederum verschiedene Werte für ein stilles, individuelles Lesen, vom Betrachten des Schriftträgers, der Graphie bis zum mehr oder weniger gründlichen Lesen des Textes. Je nach Lexem gibt es auch bei diesen Attributen verschiedene Defaultwerte. Die Wahrnehmung lässt sich zwar in Sehen und Hören unterscheiden, aber es spielen beide Arten beim Lesen eine Rolle. Sowohl Leser als auch Zuhörer sehen den Schriftträger und hören die Stimme. Beides spielt in diversen Rahmen eine zentrale Rolle wie beim Verlesen eines Briefes oder beim Rezitieren von Texten in der Liturgie. Lesen kann aber durchaus auch ohne Stimme auskommen, wenn der Empfänger einen Brief liest oder ein Schüler seiner Lektüre nachgeht. Greens Lesertypologie geht deshalb nicht auf, weil meistens beide Arten der Sinneswahrnehmung beim Lesen zum Zuge kommen. Das Merkmal ±ÖFFENTLICH greift ebenfalls zu kurz. Dies demonstrieren diverse Werte des Attributs RAHMEN wie sótt ‚Krankheit‘, fundr ‚Versammlung‘, messa ‚Messe‘ oder veizla ‚Fest‘, welche sich grundlegend unterscheiden und verschiedene Lesepraktiken implizieren. Die Attribute STIMME und RAHMEN mit ihren Werten zeigen nicht nur, woran man die Lesepraktik erkennen kann, sondern auch, dass die oben genannten Binaritäten diverse Aspekte der Schriftlichkeit übersehen. Die Medialitätsforschung (vgl. z.B. Glauser 2010, Lutz 2010, Schnyder 2006) hat sich zwar grösstenteils von diesen engen Dichotomien gelöst und den Blick auf diverse andere Aspekte wie Materialität, Visualität, Gedächtnis oder Körper sowie auf Lesepraktiken ausserhalb eines scholastischen und monastischen Umfeldes geöffnet, aber bislang vernachlässigt, wie sich diese Aspekte in der Lexik und Semantik manifestieren. Diverse Aspekte lassen sich tatsächlich als Attribute des Frames feststellen. Auf die Materialität und Visualität zielen die Attribute SCHRIFTTRÄGER und GRAPHIE ab. Gedächtnis und Körper liessen sich hingegen im Konzept nur indirekt fassen, nämlich als Teile gewisser Attributframes.
Lutz‘ (2010) Lesevorgänge hängen eng mit dem Attribut RAHMEN zusammen, orientieren sich aber zu sehr am Schriftträger und seinem Gebrauch. Dabei darf dieser Gebrauch nicht mit dem Lesen gleichgesetzt werden. Die Inszenierung des Objekts gehört zum Rahmen, aber nicht zum Lesen an sich. Das zeigt sich am Beispiel der Messe, in der zwar gelesen wird und der Schriftträger im Zentrum steht, aber auch weitere Handlungen vollzogen werden, die nicht zum Lesen gehören. Daraus erklärt sich auch die metonymische Verschiebung in der Kollokation lesa messu. Ähnlich verhält es sich mit dem Verlesen von Briefen in einem öffentlichen Rahmen, wo das Dokument mit seinem Skript und seinen Siegeln als Garanten für seine Authentizität präsentiert und der Text vorgelesen wird. Die Wahrnehmung des Schriftträgers mit Skript (sjá, líta á e-t), das (stille) Lesen des Texts (lesa yfir), das Verlesen vor Zuhörern (lesa, lesa upp) stellen einzelne Handlungen und Konzepte innerhalb dieses ‚Lesevorgangs‘ dar, den die Kollokation bera fram bréf semantisch am ehesten abdeckt.
Dieser Vergleich mit den Ergebnissen der bisherigen Forschung zeigt, dass viele Ergebnisse durchaus richtig sind, aber nur bestimmte Aspekte der verschiedenen Lesekonzepte abdecken. Die Fokussierung auf binäre Merkmale kann sogar weitere Erkenntnisse verhindern. Sie beschränken sich auch meistens nur auf einzelne Wortpaare, ohne dass ein grösseres Wortfeld betrachtet wird. Die Medialitätsforschung hat zwar neue Aspekte einbezogen, diese konnten aber nicht immer als Teil des Konzepts bestätigt werden. Eine gründliche Analyse der Konzepte ermöglicht es hingegen, ein geschlosseneres und differenzierteres Bild der mittelalterlichen Lesepraktiken zu gewinnen.