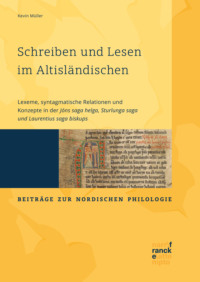Kitabı oku: «Schreiben und Lesen im Altisländischen», sayfa 30
6. sjá
Das Verb sjá ist die altisländische Entsprechung von lat. videre ‚sehen; lesen‘ (vgl. Georges 1998: II, 3478–81) und mhd. sëhen ‚sehen, erblicken, ansehen‘ (Lexer 1972–78: II, 851f.), welche laut Green (2007: 8) und Saenger (1999: 85) für stilles Lesen verwendet wurden. In der Sturlunga saga gibt es die Entsprechung sjá, die ‚sehen‘ und ‚lesen‘ bedeuten kann (vgl. Müller 2018: 158f.). Laut Baetke (2002: 537) bedeutet sjá ‚sehen, besehen‘, eine Bedeutung ‚lesen‘ erwähnt er allerdings nicht. Fritzner (1886–96: III, 255–258) übersetzt es gleich mit „se, bese“ ‚sehen, besehen‘ ohne die Bedeutung ‚lesen‘. Das ONP (sjá) hat zum Lemma sjá 1225 Belege, von denen ein grosser Teil ohne feinere Sortierung zur Konstruktion sjá e-n/e-t gehört. Kollokationen wie sjá bók oder bréf werden nicht gesondert behandelt. Jedoch wird die Paarformel sjá ok/eða heyra ‚sehen und/oder hören‘, welche typisch für mittelalterliche Urkunden ist, eigens ohne Übersetzung aufgeführt. Sjá kann bezogen auf Urkunden einerseits ‚das Dokument ansehen‘ oder ‚den Text lesen‘ bedeuten, während sich heyra auf die Wahrnehmung des Verlesens bezieht.
Die Konjunktionen setzen dabei die verschiedenen Lesevorgänge in Beziehung: Ok ‚und‘ verbindet ocular und aural reading, d.h. die Visualität des Dokuments kommt zum Zug, das Lesen geschieht aber audititv. Eða ‚oder‘ hingegen trennt die Vorgänge, indem es zwischen ocular und aural readers unterscheidet. Die Verwendung dieser Konjunktionen und die Formelhaftigkeit des Sprachgebrauchs müssten eigens untersucht werden. Das folgende Zitat ist typisch für solche Formeln: „Ollvm monnvM þeim sem þetta bref sia eða heyra sendir havkr erlenz son logmaðr i oslo Qveðiv Guðs ok sina“ (IslDipl 1302: 4). ‚Allen den Leuten, die diesen Brief sehen oder hören, sendet der lǫgmaðr in Oslo, Haukr Erlendsson, Gottes Gruss und den seinen‘ (Übers. KM). Anhand dieses Zitates lässt sich auch der Leser in der Korrespondenz einordnen. Die Leute, welche den Brief sehen oder hören, sind der Empfänger.
Das Verb sjá ist im Korpus der vorliegenden Arbeit in allen Texten jedoch nur vereinzelt in einem schriftlichen Kontext belegt; die Jóns saga helga hat einen Beleg in der S- und zwei Belege in der L-Redaktion, die Sturlunga saga zwei und die Laurentius saga biskups in den beiden Redaktionen je einen Beleg.
In der S-Redaktion der Jóns saga helga trägt der Bischofskandidat Jón dem Papst sein Anliegen vor und zeigt ihm die Briefe des Erzbischofs von Lund. Dann steht: a) „En helgi Ion ber vpp fyrir pafvann avll sinn erendi ok þar með synir hann honvm bref erkibyskvps ok innsigli […]. Ok er *pafvi hafði seeð ritið. þaa veitir hann þat þeckiliga […]“ (JSH 15). ‚Der heilige Jón trägt dem Papst alle seine Anliegen vor und dazu zeigt er ihm Brief und Siegel des Erzbischofs […] Und als der Papst das Schreiben gesehen hatte, gewährt er ihm freundlich […]‘ (Übers. KM). Subjekt ist der Papst (páfi) und das Akkusativobjekt rit, das Baetke (2002: 503) als ‚Schreiben, Schriftstück, Brief‘ deutet. Fritzner (1886–96: III, 118f.) übersetzt es hingegen allgemeiner als 1. „Handlingen at skrive“ ‚die Schreibhandlung‘ und 2. „hvad en har skrevet“ ‚was eine(r) geschrieben hat‘, also das Skript. Bei diesem Beleg ist rit die Substitution des Briefes (bréf), den Jón mit dem Siegel (innsigli) als Dokument zeigt, fokussiert aber in diesem Kontext wahrscheinlich auf das Skript. Das Anschauen des Skripts dient der Überprüfung des Dokuments, wozu auch Lesen gehört. Der Papst ist BETRACHTER und LESER, während rit einen Wert für das SKRIPT die Bezeichnung dieses Attributs darstellt.
In der L-Redaktion ist sjá mit einem Bezug zur Schriftlichkeit zweimal belegt. Der erste Beleg befindet sich in der Szene, in der Klœngr Ovid liest (vgl. Kap. III.2.2.2.a.):
b) þat er sagt at hinn h(eilagi) Ion byskup kom at einn tima er einn klerkr er Klængr het […] las verssa bock þa er heitir Ouiðius ðe arte. […] Sem hinn sæli Iohannes sá ok undirstóð huat hann las fyrirbauð hann honum at heyra þessháttar bóck (JSH 84).
Es wird erzählt, dass der heilige Bischof Jón zu einer Zeit kam, als ein Kleriker, der Klœngr hiess, […] ein Versbuch las, welches Ovidius de arte heisst. […] Als der selige Johannes sah und verstand, was er las, verbot er ihm ein derartiges Buch zu hören (Übers. KM).
Subjekt ist Bischof Jón. Das Interrogativpronomen hvat ‚was‘ im Akkusativobjekt verweist auf das Versbuch (versabók), Ovids Ars amatoria, das Klœngr liest. In diesem Kontext kann sjá zwar wie undirstanda ‚verstehen‘ bedeuten, so dass es sich um eine Paarformel handelt, aber eine Bedeutung ‚lesen‘ kann nicht ausgeschlossen werden. Woran Jón genau erkennt, was Klœngr liest, wird nicht erwähnt. Es kann sein, dass er ihn wie in der entsprechenden Stelle in der S-Redaktion (vgl. Kap. III.2.2.2.a.) bereits gehört hat oder anhand des Texts, Skripts oder Schriftträgers erkennt, was er liest. Dies kann nicht entschieden werden, weil das Pronomen hvat auf alle drei verweisen kann. Es bleibt also unklar, ob das Akkusativobjekt für die Attribute TEXT, SKRIPT oder gar SCHRIFTTRÄGER steht.
Beim zweiten Beleg in einem Kommentar des Autors ist die Bedeutung ‚lesen‘ deutlicher: c) „Nv er yfir farit nockut um þỏr Iarteinir er wer hofum heyrt sagðar eða seeð ritaðar af lifui hins h(eilaga) Iohannis“ (JSH 95). ‚Nun ist etwas von den Wundern des heiligen Johannes behandelt worden, welche wir erzählen gehört und geschrieben gesehen haben‘ (Übers. KM). Das Personalpronomen vér ‚wir‘ im Subjekt verweist auf den anonymen Autor der L-Redaktion und eventuell auch auf die Schreiber. Das Akkusativobjekt enthält erstens die Relativpartikel er, welche auf das Substantiv jarteinir f. Pl. ‚Wunder‘ im Hauptsatz verweist und zweitens das attributive Adjektiv ritaðar f. Pl. ‚geschrieben‘, welches die schriftliche Überlieferung der Wunder hervorhebt. Wenn dieses Adjektiv fehlte, wäre das Subjekt Augenzeuge und nicht Leser dieser Wunder. Das Attribut, auf welches das Akkusativobjekt verweist, ist eindeutig der TEXT, denn es geht nicht darum ein Skript anzuschauen, sondern dem Text Informationen zu entnehmen.
Anhand dieser beiden Belege kann nicht sicher beurteilt werden, aus welchen Attributen sich der Frame zusammensetzt. Beim zweiten Beleg handelt es sich sicher um die Attribute LESER (i.S.v. ocular reader) und TEXT, beim ersten wäre wie in der S-Redaktion für das Subjekt auch ein Attribut BETRACHTER denkbar und für das Akkusativobjekt kämen neben TEXT, auch SKRIPT oder SCHRIFTTRÄGER in Frage.
Die Sturlunga saga enthält zwei Belege von sjá in einem schriftlichen Kontext, von denen der erste in der Reykjarfjarðarbók erhalten ist:
d) [Þenna sama] [t]ima komo til Asgrims heimamenn [Órækju] Gvnlavgr Hrollaugs son ok Bvtr Þordar son, ok feck [Ásgrímr] þeim brefit, ok færdv þeir Vrękiu. En er hann sa bref þetta, [virðiz honum] þat bref fiorad vid sik, ok bar þetta firir vini sinna ok [trúnadar-] menn (StS1 452).
Zur selben Zeit kamen zu Ásgrímr Órœkjas Hausleute Gunnlaugr Hrollaugsson und Bútr Þórðarson und Ásgrímr gab ihnen den Brief und sie brachten ihn Órœkja. Aber als er diesen Brief sah, schien ihm, dass dieser Brief ein Mordplan gegen ihn sei, und teilt es seinen Freunden und Vertrauten mit (Übers. KM).
Subjekt ist Órœkja Snorrason, ein Mitglied der Sturlungenfamilie. Das Akkusativobjekt enthält das Lexem bréf. Es wird nicht explizit erzählt, dass die Boten den Inhalt dem Empfänger erzählten. Anhand des Skripts oder des Schriftträgers konnte Órœkja sicher nicht erkennen, dass der Brief ein Mordplan gegen ihn sei. Obwohl Skript und Schriftträger bei der Wahrnehmung eine Rolle spielen, ist es vor allem der Inhalt, der Órœkja zu diesem Schluss führt, so dass bréf bei diesem Beleg sicher als Wert für das Attribut TEXT betrachtet werden darf und Órœkja somit als LESER.
Der zweite Beleg ist mit gewissen Unsicherheiten behaftet und unterschiedlich in den frühneuzeitlichen Abschriften der Reykjarfjarðarbók überliefert:
e) Þá er skip tóku at búaz um várit, lét Þorgils rita á vaxspjǫld ok sendi konungi; var þat þar á, at hann beiddi, at konungr leyfði honum at fara til Íslands eða ella til annarra landa, kvaz eigi lengr vera vilja í ófrelsi. En er konungr sá þetta, virði hann svá, sem Þorgilsi gengi til stærð ok metnaðr, er hann vildi eigi sjálfr flytja við sik sem aðrir menn (StS2 143).
Als die Schiffe im Frühling bereit gemacht wurden, liess Þorgils etwas auf Wachstafeln schreiben und sandte sie dem König. Darauf stand, dass er darum bat, dass der König ihm erlaubte, nach Island oder in andere Länder zu fahren. Er sagte, dass er nicht länger in Unfreiheit sein wolle. Aber als der König dies sah, betrachtete er das so, als ob Þorgils zu Hochmut und Überheblichkeit neige, wenn er es ihm nicht selbst wie andere Leute vorbringen wolle (Übers. KM).
Subjekt ist König Hákon. Der Akkusativ Plural vaxspjǫld ‚Wachstafeln‘ steht so nur in der Handschrift Stockh. pap. 8, 4to, während Brit. mus. Addit. 11,127, fol. und Advoc. Library 21–3–17 an der Stelle den Dativ Singular vaxspjaldi haben. Diese Unterschiede sind beim nachfolgenden Beleg von sjá entscheidend. Das Demonstrativpronomen þetta (n. Sg.) im Akkusativobjekt kongruiert in zwei Handschriften mit vaxspjaldi (n. Sg.), jedoch nicht mit dem Plural vaxspjǫld. In allen drei Handschriften kann das Demonstrativpronomen darauf verweisen, dass Þorgils skarði sein Anliegen auf einer Wachstafel zukommen liess. Wenn þetta auf vaxspjald verwiese, wäre ein Wert für das Attribut SCHRIFTTRÄGER gegeben, welches auch wieder ein SKRIPT und einen TEXT implizierte. Dass der König das Vorgehen als arrogant auffasste, liegt aber daran, dass Þorgils nicht persönlich erschien, und nicht an der Wachstafel als Schriftträger. Dies schliesst aber nicht aus, dass in mindestens zwei Handschriften vaxspjald Akkusativobjekt von sjá ist, denn der König hätte auch beim Lesen der Wachstafel so reagieren können. Wegen der Unklarheiten und der nachmittelalterlichen uneinheitlichen Überlieferung kann dieser Beleg nicht in die Analyse einbezogen werden. Für die Sturlunga saga lässt sich schlussfolgernd ein Frame bestehend aus den Attributen LESER (i.S.v. ocular reader) als Agens mit einem Wert sturlungr und TEXT als Thema mit dem Wert bréf festhalten.
In der Laurentius saga biskups ist das Verb sjá mit dem Objekt bréf in den beiden Redaktionen belegt. Beide Redaktionen beschreiben zwar dieselbe Szene, es gibt aber sprachliche Unterschiede. Diakon Þórðr nagelt den Brief an die Kirchentür, nachdem er ihn ausserhalb der Kirche von Hólar ohne Zuhörer verlesen hat, weil er es in der Kirche nicht tun durfte (s. a. Kap. II.6.2.e–h.). Darauf heisst es in der A-Redaktion: f) „enn prestar og lærder menn sau brefit fest aa kirkiu hurdina a Holum. og lasu“ (LSB 114). ‚Aber die Priester und Gelehrten sahen den Brief an der Kirchentür in Hólar befestigt und lasen ihn‘ (Übers. KM). Subjekt sind bei diesem Beleg die Priester und Gelehrten (prestar ok lærðir menn). Das Akkusativobjekt enthält das Lexem bréf, das aber in diesem Kontext sehr deutlich ein Wert für den Schriftträger ist, weil das Partizip Präteritum fest ‚befestigt‘ seine Materialität hervorhebt. Die Lexeme prestr und lærðr maðr sind also Werte für den BETRACHTER, welche erst als Subjekt des nachher belegten Verbs lesa Werte für das Attribut LESER werden. Das gleiche gilt für bréf, das als Akkusativobjekt von lesa einen Wert des Attributs TEXT bildet (vgl. Kap. III.2.4.1.3.d.). Bei diesem Beleg bedeutet sjá ‚sehen‘ und nicht ‚lesen‘.
In der B-Redaktion steht hingegen: g) „Enn prestar at Holvm sau brefit aa kirkiv hvrdunne“ (LSB 114). ‚Aber die Priester in Hólar sahen den Brief an der Kirchentür‘ (Übers. KM). Das Subjekt enthält nur die Priester (prestar). Das Akkusativobjekt lautet wie in der A-Redaktion bréfit. Das Substantiv ist einerseits als Wert für das Attribut SCHRIFTTRÄGER anzusehen, weil die von bréf abhängige Konstituente á hurðinni ‚an der Tür‘ die Materialität wieder betont. Im Gegensatz zur A-Redaktion fehlt allerdings das Verb lesa. Sjá umfasst also nicht nur das visuelle Wahrnehmen des Schriftträgers an der Tür, sondern auch des darauf befindlichen Texts, was das Verstehen des Inhaltes miteinschliesst. Das Subjekt steht also sowohl für den BETRACHTER als auch den LESER (i.S.v. ocular reader) und das Akkusativobjekt sowohl für den SCHRIFTTRÄGER als auch den TEXT. Das Attribut SKRIPT passt sowohl in den Seh- als auch Leseframe.
Die sieben Belege erlauben keine eindeutige Zuordnung der Ergänzungen zu den Attributen eines Frames. Das Verb sjá hat nur zwei Ergänzungen, Subjekt und Akkusativobjekt. Im Subjekt sind die Lexeme biskup ‚Bischof‘, páfi ‚Papst‘, konungr ‚König‘, lærðr maðr ‚Gelehrter‘, prestr ‚Priester‘ und sturlungr ‚Sturlunge‘ enthalten, alles Personen, die wahrscheinlich lesen konnten. Dies gilt auch für den Autor und die Schreiber der L-Redaktion der Jóns saga helga. Für das Subjekt kommen die Attribute BETRACHTER oder LESER in Frage, abhängig davon, ob sjá ‚sehen‘ oder ‚lesen‘ bedeutet. Das Akkusativobjekt enthält die Lexeme bréf ‚Brief‘, rit ‚Schreiben, Brief‘, ritaðar jarteinir ‚aufgeschriebene Wunder‘ und möglicherweise versabók ‚Gedichtbuch‘. Der Wert vaxspjald ‚Wachstafel‘ ist wegen der Überlieferungssituation der Sturlunga saga nicht sicher. Abhängig vom Konzept kommen für das Akkusativobjekt die Attribute SCHRIFTTRÄGER, SKRIPT oder TEXT in Frage. Ob es sich tatsächlich um Lesen oder Sehen handelt, hängt stark vom Kontext ab. In der A-Redaktion der Laurentius saga biskups (s. Beleg f.) bedeutet sjá mit dem an der Kirchentür befestigten Brief wahrscheinlich nur ‚sehen‘ und in der L-Redaktion der Jóns saga helga (s. Beleg c.) mit den aufgeschriebenen Wundern primär ‚lesen‘. Die beiden Konzepte lassen sich aber nicht klar von einander trennen, denn wer etwas liest, sieht unweigerlich Schriftträger und Skript. Wer hingegen einen Schriftträger mit Skript betrachtet, wird auch Buchstaben lesen, wenn er sie dekodieren kann. Sjá ist diesbezüglich also nicht eindeutig und kann ‚sehen‘ und ‚lesen‘ bedeuten, wobei die Grenzen fliessend sind. Deshalb lässt sich das Subjekt abhängig von der Situation dem BETRACHTER oder LESER zuordnen. Das gleiche gilt für das Akkusativobjekt, das abhängig bei einer Bedeutung ‚lesen‘ auf die Attribute TEXT, SKRIPT und SCHRIFTTRÄGER zutrifft. Da ein Text immer ein Skript und einen Schriftträger impliziert, reicht das Attribut TEXT dafür aus. Bei der Bedeutung ‚sehen‘ steht wiederum der Schriftträger im Fokus, der auch ein SKRIPT und TEXT impliziert, so dass das Attribut SCHRIFTTRÄGER am besten zutrifft. Ob materielle und visuelle oder inhaltliche Aspekte des Textes relevant sind, hängt vom Kontext ab.
Das ONP (sjá) nennt in der Belegreihe zu sjá ok/eða heyra noch einen Beleg, in dem sjá und lesa yfir zusammen vorkommen: „uier hofum sed og yferlesed oped um(m)bodzbref med heilu og oskoddudu innsigle“ (Dipl. Isl.: IX, 71). ‚Wir haben den offenen Vollmachtsbrief mit dem ganzen und unbeschädigten Siegel gesehen und durchgelesen‘ (Übers. KM). Die Paarformel lässt verschiedene Interpretationen zu: Sjá und lesa yfir können synonym sein. Dafür spricht, dass die Präpositionalphrase með heilu ok óskǫðuðu innsigli ‚mit dem ganzen und unbeschädigten Siegel‘ von beiden Verben abhängt. Es ist aber durchaus möglich, dass sjá sich auf das Verifizieren des Dokuments mit dem Siegel beschränkt, während lesa yfir sich auf das Lesen des Textes bezieht. Subjekt beider Verben sind die Priester Finnbogi Einarsson und Pétr Pálsson (vgl. Dipl. Isl.: IX, 71). Problematisch bei dieser Urkunde aus dem Jahre 1522 ist, dass sie nur in einer Abschrift aus der ersten Hälfte des 18. Jh. erhalten ist. Bei lesa yfir ist wie bei den Belegen von Karlsson (1963: 150, 184, s.a. Kap. III.4.) die Wortart von yfir unsicher, so dass es ‚still‘ oder ‚laut lesen‘ bedeuten kann. Ein Beleg aus einer isländischen Urkunde von 1442 aber enthält alle drei Möglichkeiten: „at vær saam ok yfir laasum ok hæyrdum yfir lesit opit bref unndir godra manna Jnnzciglum“ (Karlsson 1963: 358). ‚Wir sahen und lasen und hörten den offenen Brief unter den Siegeln guter Leute verlesen‘ (Übers. KM). Das Sehen (sjá) bezieht sich auf das Betrachten und Verifizieren des Dokuments mit seinen Siegeln, was die Zuhörer miteinschliesst. Auf das hörende Lesen verweist die Konstruktion heyra bréf yfir [sér] lesit und auf das sehende die Konstruktion lesa yfir bréf. Der Beleg demonstriert zudem, dass es zwei Arten des Lesens gibt, einerseits das Betrachten und Verifizieren des Dokuments, was Lesen nicht beinhalten muss, und andererseits das stille Lesen des Textes.
7. bera fram
Das Partikelverb bera fram hat in dem hier untersuchten Korpus nur vier Belege mit Bezug zu etwas Schriftlichem. Laut Baetke (2002: 47) bedeutet bera e-t fram ‚etw. vorweisen, vorbringen, verkünden‘. Ähnlich übersetzt es Fritzner (1886–96: I, 128) mit „fremføre, foredrage, udtale“ ‚vorbringen, vortragen, aussprechen‘ und führt die Kollokation „bera fram sín erendi“ ‚seine Anliegen vortragen‘ an. Im ONP (bera) gibt es vergleichbare Belege unter den Punkten 8 „fremføre, udtale, fremlægge, forkynde // recite, deliver, pronounce, recount, proclaim“ und 9: „fremlægge (dokument/bog) (konkret og/el. ved oplæsning) // present (document/book) (literally and/or by reading aloud)“ mit der Konstruktion bera fram e-t und den Substantiven bók ‚Buch‘, bréf ‚Brief‘ und dómr ‚Urteil‘ als Thema. Der älteste erwähnte Beleg stammt aus der Zeit um 1275. Die in Baetke und ONP dargestellte Polysemie diskutiert Spurkland (2000) nicht, sondern modernisiert das Partikelverb zu nnorw. „bære fram“, das semantisch aber weitgehend dem altnordischen Pendant entspricht. Die jeweilige Bedeutung hängt teilweise vom Thema ab. Die Kollokation bera fram ørendi ‚das Anliegen / die Botschaft vortragen/verkünden‘ ist eindeutig, jedoch nicht bera fram bréf, das sowohl mit ‚den Brief (als Objekt) vorweisen‘ als auch ‚den Brief (inhaltlich) vortragen/verkünden‘ übersetzt werden kann. Gemäss Teuscher (2007: 261f., 270f.) spielen beide Aspekte im Mittelalter eine Rolle, so dass beide Bedeutungen in Frage kommen. Dies wirft bei einem Satz wie þeir báru fram bréf ok segja ørendi (vgl. Spurkland 2000) ‚Sie trugen/wiesen den Brief vor und sagten die Botschaften‘ aber Fragen auf, weil das Präsentieren des Briefes das Vorlesen des Inhaltes nicht ausschliesst und das Erzählen der Botschaften zusätzlich geschehen kann. Deshalb ist es notwendig die syntagmatischen Relationen und die Kontexte dieses Partikelverbs eingehender zu analysieren.
In der L-Redaktion der Jóns saga helga ist bera fram zweimal in unterschiedlichen Situationen belegt. Der erste Beleg ist eine Substitution von lesa in der Szene, in welcher der Priester die passio schlecht (vor-)liest (s.a. Kap. III.2.2.1.):
a) bar sua til at prestr sa er las waars herra passionem. bar seint fram ok stirðliga ok eigi miok rett þessa haaleitu þiǫnastu. styggiandi miǫck eyru viðrstandanda lyðs meðr sinum leiðiligvm lesningi (JSH 61f.).
Es geschah nun, dass der Priester, welcher die passio unseres Herrn las, diesen erhabenen Dienst langsam, steif und nicht sehr richtig vorbrachte, und die Ohren der anwesenden Leute mit seiner hässlichen Lesung sehr störte (Übers. KM).
Die Leerstelle des Subjekts verweist auf den Priester (prestr), welcher die Leidensgeschichte Jesu (passio) in der Messe am Palmsonntag liest. Das Akkusativobjekt þessa háleitu þjónustu ‚diesen erhabenen Dienst‘ ist eine Substitution von „passionem“. Die Verschiebung von Handlung zum Gegenstand ist ein typisches metonymisches Verfahren (vgl. Fritz 2006: 45). Das Akkusativobjekt bezieht sich also wie bei lesa auf das Attribut TEXT und hat den Wert passio. Die Adverbien seint ‚langsam‘, stirðliga ‚steif‘ und rétt ‚richtig‘ sind ebenfalls wie bei lesa Werte für das Attribut STIMME. Der Frame und die Valenz von bera fram und lesa sind bei diesem Beleg also gleich strukturiert, jedoch stellt sich die Frage nach dem Attribut, zu welchem der Wert prestr gehören soll. Trotz der Substitution müssen lesa und bera fram nicht synonym sein. Bera fram wird danach noch durch styggja ‚stören‘ substituiert. Daraus ergibt sich eine Isotopiekette von lesa über bera fram zu styggja, die vom schriftlichen Text über den Vortrag des Priesters bis zu den Ohren der Zuhörer führt, so dass bera fram zwischen dem Lesen und dem Hören anzusiedeln ist und gegenüber lesa enger auf den mündlichen Vortrag fokussiert. Ein passendes Attribut für das Agens wäre somit REDNER. Das Attribut STIMME bleibt unverändert, ebenso der TEXT, wenn man ihn unabhängig vom Medium betrachtet.
Der zweite Beleg, in dem der Bischofskandidat Jón vor den Papst tritt und seine Anliegen vorträgt (s. a. Kap. II.3.1.2.f. und III.4.a.), erinnert sehr stark an jene von Spurkland (2000): b) „bar hann fyrir herra pafan fram skiött ok skauruliga. sin eyrenði. þuiat hann var bæði sniallr ok I nogh hofdingia diarfr. synanðe honum bref ok Insigle. Astueri Lundensis eRkibyskups“ (JSH 80). ‚Er trug dem Papst schnell und freimütig seine Anliegen vor, denn er war gewandt und ausreichend selbstbewusst, und zeigte ihm Brief und Siegel des Erzbischofs Astver von Lund‘ (Übers. KM). Das Pronomen hann ‚er‘ im Subjekt verweist auf Jón. Das Akkusativobjekt enthält das Lexem ørendi ‚Anliegen, Botschaft‘. Der Brief (bréf) mit dem Siegel (innsigli) hingegen ist das Akkusativobjekt von sýna ‚zeigen‘. Das Vortragen der Anliegen (bera fram ørendi) und das Vorweisen des Dokuments (sýna bréf ok innsigli) werden bei diesem Beleg also lexikalisch unterschieden. Die Adverbien skjótt ‚schnell‘ und skǫruliga ‚freimütig‘ gehören wieder als Werte zum Attribut STIMME. Das Präpositionalobjekt fyrir páfann ‚für den Papst‘ schliesst den ZUHÖRER mit ein. Beim Beleg a) werden nur Zuhörer im Kontext erwähnt. Wie da bedeutet bera fram ‚mündlich vortragen‘. Jón ist somit der REDNER. Der TEXT ist an dieser Stelle problematisch. Das Anliegen steht zwar in Beziehung zum Brief, der Brieftext und der mündliche Text des Anliegens müssen aber nicht identisch sein. Schaefer (1992: 43) unterscheidet terminologisch zwischen dem schriftlichen „Text“ und der mündlichen „Äusserung“, so dass hier dem Attribut die Bezeichnung ÄUSSERUNG zugewiesen werden kann. Die Konstruktion bera fram e-t + Adv. verbindet folglich die Attribute REDNER, ÄUSSERUNG und STIMME. Diese Konstellation gilt nicht für den ersten Beleg, weil die passio da in schriftlicher Form vorliegt.
Der einzige Beleg von bera fram in der Sturlunga saga ist diesbezüglich weniger eindeutig als jene der Jóns saga helga. Die Stelle ist nur in frühneuzeitlichen Abschriften erhalten. Þorgils skarði empfängt den Priester Ketill, welcher einen Brief des Abtes Brandr bei sich hat: c) „bar hann fram bréf ábóta, ok var þess beitt, at […]“ (StS2 177). ‚Er trug/wies den Brief des Abtes vor und es wurde gefordert, dass […]‘ (Übers. KM). Das Subjekt hann verweist auf Ketill und das Akkusativobjekt lautet bréf ábóta ‚Brief des Abtes‘. Adverbien als Werte für die STIMME fehlen. Wie oben erwähnt kommen für die Kollokation bera fram bréf drei Möglichkeiten in Frage: den Brief vorweisen, den Brief vortragen oder beides, welche in diesem Kontext alle zutreffen können. Es kann ausserdem nicht ausgeschlossen werden, dass Ketill den Brief las, zumal er als Priester sicher lesen konnte.
In der Laurentius saga biskups ist die Kollokation bera fram bréf in beiden Redaktionen je einmal ohne wesentliche Unterschiede belegt. Das folgende Zitat richtet sich nach der A-Redaktion:
d) <E>jnn dagh let erchibyskupinn kalla Laur(encium) til sin so seigiande, hier er bref er Ion hefer giortt epter voru bode. þetta bref skalltu vpp lesa. yfer kor i kirkiunne. aa morgin. þuiat þáá er mikil hatidis dagur. La(urencius) suar(ar): dyrtt er drottinns ord. skal eg þad giora og fram bera sem þier vilid medan eg er j ydare þionustu. […] geck sira Laur(encius) vpp a kór. epter bode erchibyskups og las bref rumor *pestiferus. […] las Laur(encius) so hatt og sniallt. ad þeir heyrdu giorlla þa suaradi Siguatur enn til. so seigiandi. eigi þarftu Islendingr so hatt ad ępa. þui vier heyrum huad þu seiger (LSB 19f.).
Eines Tages liess der Erzbischof Laurentius zu sich rufen und sagte: „Hier ist der Brief, den Jón in Unserem Auftrag geschrieben hat. Diesen Brief sollst du morgen über dem Chor in der Kirche verlesen, denn dann ist ein grosser Feiertag.“ Laurentius antwortet: „Kostbar ist das Wort des Herrn. Ich werde das tun und [ihn] vortragen/vorweisen, wie Ihr wollt, so lange ich in Euren Diensten stehe.“ […] Laurentius ging gemäss dem Befehl des Erzbischofs in den Chor hinauf und las den Brief rumor pestiferus. […] Laurentius las so laut und gewandt, dass sie es genau hörten. Dann erwiderte Sighvatr und sagte: „Du brauchst nicht so laut zu schreien, Isländer, denn wir hören, was du sagst“‘ (Übers. KM).
Bera fram ist bei diesem Beleg eine Substitution von lesa upp (s.a. Kap. III.3.2.3.c.). Subjekt beider Verben ist der Priester Laurentius. Das Akkusativobjekt ist eine Leerstelle, die auf bréf verweist. Der Kernframe ist also identisch mit jenem von lesa upp und lesa, die nachfolgende Substitution von bera fram. Von lesa sind zudem die beiden Adverbien hátt ‚hoch‘ und snjallt ‚gewandt‘ als Werte für das Attribut STIMME abhängig. Wie beim Beleg a) besteht eine Isotopiekette aus verba legendi und dicendi: lesa upp ‚verlesen‘ – bera fram ‚vortragen/vorweisen‘ – lesa ‚lesen‘ – œpa ‚schreien‘. Dieser Fokus auf dem Vorlesen des Briefes schliesst das Zeigen allerdings nicht aus, obwohl es nicht explizit erwähnt wird. Bera fram könnte wie möglicherweise in der Sturlunga saga auf die gesamte Inszenierung des Briefes mit Zeigen des Dokuments und mündlichem Vortrag der Botschaft referieren. Der Frame wäre dann anders zu strukturieren. Der Wert bréf umfasst verschiedene Konzepte, die bei seiner Präsentation alle zum Zuge kommen: den Schriftträger, das Skript, den Text und die Botschaft. Die Kollokation bera fram bréf ist deshalb eine Synekdoche, bei der das Vorweisen des Dokuments oder das Vortragen der Botschaft nur einen Teil bilden. Auf diese Teile verweisen die zu Beginn des Kapitels aufgeführten Kollokationen sýna bréf und bera fram ørendi. Agens ist in allen dreien der Bote. Das Thema ist der Brief oder, abhängig vom Konzept, die Botschaft. Die Bedeutung von bera fram hängt auch an dieser Stelle vom Thema ab. So bedeutet bera fram bréf ‚den Brief präsentieren‘ mit den Attributen BOTE und BRIEF. Die Kollokationen bera fram ørendi fyrir e-n + Adv. ‚jdm. die Botschaft vortragen‘ und bera fram passionem + Adv. ‚die Leidensgeschichte vortragen‘ sind in der Bedeutung enger und bestehen aus den Attributen REDNER, TEXT bzw. ÄUSSERUNG und STIMME. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob eine Unterscheidung in Text und Äusserung beim Attribut überhaupt sinnvoll ist, weil der Text protoypisch medial und konzeptuell schriftlich, die Äusserung medial und konzeptuell mündlich ist. Dies trift im Falle von bera fram je nach Situation nicht immer zu: Der Priester liest einen schriftlichen lateinischen Text in der Messe. Das ist mediale Mündlichkeit, aber konzeptuelle Schriftlichkeit. Der Bote trägt hingegen sein mündliches Anliegen dem Empfänger vor. Dies geschieht sowohl medial als auch konzeptuell mündlich. Deshalb ist der medial und konzeptuell neutrale TEXT als Bezeichnung für dieses Attribut vorzuziehen. Ob es sich dabei um einen schriftlichen Text oder eine mündliche Äusserung handelt, hängt jeweils von der Semantik des Werts und vom Kontext ab.
Die relativ dünne und heterogene Beleglage verlangt einen Exkurs in andere Texte. Das ONP (bera) behandelt zwar Belege von bera fram mit den Bedeutungen ‚aussprechen, verkünden, vorbringen, vortragen, vorweisen u. ä.‘ gesondert, die meisten unter Punkt 8 aufgeführten Zitate haben aber keinen direkten Bezug zu einen Schriftträger. Das häufigste Akkusativobjekt ist ørendi ‚Anliegen‘. Andere Lexeme sind boðskapr ‚Gebot‘, lygi ‚Lüge‘, orðsending ‚Mitteilung‘ oder tíðindi ‚Nachricht‘. Wenn kein Schriftträger erwähnt ist, muss man davon ausgehen, dass sie alle in den Bereich der Mündlichkeit gehören. Gerade der Beleg a. aus der Jóns saga helga demonstriert aber, dass dieses Aussprechen, Verkünden etc. durchaus in Bezug zu einem Schriftträger stehen kann. Jene Belege unter Punkt 9 sind hingegen schwierig zu deuten oder erbringen keine weiteren Erkenntnisse. Der schwierig auszulegende Beleg c. aus der Sturlunga saga wird darunter ebenfalls zitiert. Ein Beleg aus der Hákonar saga Hákonarsonar ist vergleichbar mit dem Beleg b. aus der Jóns saga helga: „Stefan bar fram brefinn, ok er kongr hafdi yfir lesit brefin, þa tok hann til orda: Aa brefi þessu eru mikil tidende tuenn“ (Kjær/Holm-Olsen 1910–86: 581). ‚Stefán trug/wies den Brief vor, und als der König ihn durchgelesen hatte, ergriff er das Wort: „Auf diesem Brief sind zwei grosse Begebenheiten“‘ (Übers. KM). Der Bote Stefán trug den Brief dem König wahrscheinlich mündlich vor, wie Jón dem Papst. Das Akkusativobjekt ist hier aber bréf und es gibt keine Adverbien, welche sich auf die STIMME beziehen. Die kritische Äusserung des Königs zum Inhalt des Briefes deutet aber darauf hin, dass der König den Brief nachträglich las, um den Inhalt zu kontrollieren. In diesem Beleg lässt sich aber nicht auschliessen, dass bera fram auch das Vorweisen des Dokuments miteinschliesst.
Die Materialität und Visualität des Dokuments steht in Spurklands (2000: 53–55) Belegen aus der Heimskringla jedoch deutlicher im Vordergrund. Der erste lautet: „Síðan bar jarl fram bréf ok innsigli Knúts konungs, þau er sǫnnuðu allt þetta, er jarl bar upp. Þetta ørendi studdu margir aðrir hǫfðingjar“ (Jónsson 1911: S. 341). ‚Dann wies der Jarl die Briefe und Siegel des Königs Knútr vor, die all das bestätigten, was der Jarl mitteilte. Dieses Anliegen unterstützten viele andere Häuptlinge‘ (Übers. KM). Der mündliche Vortrag des Jarls wird bei diesem Beleg durch das Verb bera e-t upp ‚etw. vorbringen, mitteilen, bekanntmachen‘ (vgl. Baetke 2002: 48) ausgedrückt. Bera fram bedeutet in diesem Kontext also nur ‚vorweisen‘. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass nicht nur bréf, sondern auch innsigli zum Akkusativobjekt gehört.