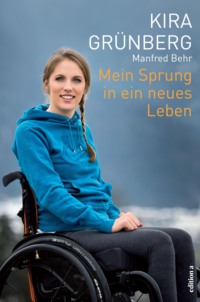Kitabı oku: «Mein Sprung in ein neues Leben», sayfa 3
Die Matura selbst brachte ich dann im Februar 2012 unter Dach und Fach, ein halbes Jahr später als über den normalen Schulbetrieb. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 übrigens. Der war lediglich durch die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik gefährdet. Unser Professor hatte ein unlösbares Beispiel konstruiert, bei dem die Punkte kein Viereck ergaben. Das merkte ich auch an, bekam aber trotzdem massig Punkteabzüge. Mehr als andere, die sich schon vorher verrechnet hatten und deshalb ein Ergebnis zustande brachten. Dieses „Gut“ wollte ich, weil unverschuldet, nicht auf mir sitzen lassen – und bekam Recht. Die schriftliche Prüfung musste wiederholt werden, die bessere Note zählte. Praktisch für all jene, die im ersten Versuch ein „Nicht genügend“ produziert hatten, praktisch für mich, die das „Gut“ in das angestrebte „Sehr gut“ verwandeln konnte. Mein Mathe-Lehrer liebte es, mich als Klassenbeste zu fordern. Während das Gros meiner Kollegen ein bevorzugtes Thema für die mündliche Matura bekannt geben durfte, bekam ich, was übrig blieb, was niemand wollte: Differential- und Integralrechnung. Die Aufgabe hatte es durchaus in sich, aber denken tut ja nicht weh. Obwohl sich die Klassengemeinschaft in einer Abendschule schon aufgrund des wesentlich höheren Altersdurchschnitts und der beschränkten gemeinsamen Unterrichtsphasen anders anfühlt, vergnügten wir uns auf einem Maturaball und begaben sich einige Absolventen nach bestandener Reifeprüfung auf Maturareise. Ich, das Nesthäkchen der Klasse, konnte nicht dabei sein – im Österreichischen Leichtathletik-Verband galt damals das ungeschriebene Gesetz, dass Entsendungen zu internationalen Wettkämpfen und die Teilnahme an einer Maturareise im gleichen Jahr unvereinbar seien.
Viele Stabhochspringer haben ihre Wurzeln im Turnsport, ich aber war ein Kind der Leichtathletik. Was sich in durchaus passablen „Zubringerleistungen“ niederschlug. So etwa habe ich eine 100-Meter-Bestzeit von 12,08 Sekunden stehen, auch die 14,13 über 100 m und 8,56 über 60 m Hürden können sich durchaus sehen lassen. Von meinen 28 Staatsmeistertiteln von der U16 (3) über die U18 (9), U20 (5), U23 (5) bis zur allgemeinen Klasse (6) entfallen sechs Goldmedaillen auf den Sprint mit und ohne Hürden. Besonders einprägsam in dieser Hinsicht war für mich die U18-Hallen-Staatsmeisterschaft 2010, bei der ich den ganzen Tag über von Wettkampf zu Wettkampf wieselte, mitunter nicht mal dazukam, die Stabhoch- mit den Hürdenspikes zu wechseln, schlussendlich drei Goldmedaillen (60 m, 60 m Hürden, Stabhochsprung) umgehängt bekam, zum Drüberstreuen im Kugelstoßen Vierte wurde.
Als weitere Errungenschaft dieses Jahres wird mir mein erster Sprung über vier Meter am 12. Juni 2012 im Rahmen der Tiroler Landesmeisterschaften in Salzburg-Rif in Erinnerung bleiben (4,01 m). Beflügelt könnte mich damals auch die Änderung meines Beziehungsstatus haben – von Single auf „in einer Beziehung“. Ich hatte Christoph im Februar 2010 auf einer privaten Party in Zirl kennengelernt. Von da weg entwickelte sich die Sache – gemächlich, aber doch, bis im Juni die Fronten geklärt waren. Anfangs wusste Christoph mit Stabhochspringen und der Intensität, mit der ich es betrieb, nichts Rechtes anzufangen, er stellte es in etwa gleich mit seinem liebsten Hobby: in der Tiroler Eliteliga für Zirl Eishockey zu spielen. Die „Gunners“ waren damals in der Tat das Maß aller Dinge, aber eben in der dritten Leistungsstufe. Dass ich in einer anderen „Liga“ spielte und zukünftig zu spielen gedachte, wurde ihm vielleicht erst bewusst, als er mich zu den Gugl Games 2012 begleitete und wir dort Seite an Seite mit Athleten dinierten, die auch ein durchschnittlich interessierter Sportkonsument zumindest dem Namen nach kannte: Justin Gatlin etwa oder Kirani James, kurz zuvor in London als Olympiasieger über 400 Meter gefeiert.
Im gleichen Jahr hätte auch Christophs sportliche Karriere eine Wendung nehmen können, er erhielt das Angebot, für die Nachwuchsmannschaft des Eliteklubs Liwest Linz zu spielen. Nach einem Schnupper-Trainingslager in der Slowakei entschied er sich aber für ein Maschinenbaustudium in Graz. Das betreibt er seit 2012 mit bewundernswerter Konsequenz. Während ich gewohnt war, die Bücher vor Prüfungen hervorzukramen, um diese irgendwie zu bestehen, ist Christoph permanent am Lernen, oft in 70-Stunden-Wochen – weil ihn die Materie von Grund auf interessiert. Längst befindet er sich im Masterstudium, will im Sommer 2017 abschließen. Wohin ihn sein beruflicher Weg dann führt, wird sich weisen. Die Möglichkeiten in Tirol sind jedenfalls enden wollend.
Der erfolgreiche Versuch, die Viermeter-Schallmauer zu überwinden, fühlte sich im wahrsten Sinne des Wortes wie der Sprung in eine neue Dimension an. Denn für mich beginnt Stabhochspringen mit dieser Höhe erst so richtig. Wenn der Kopf nach unten zeigt, die Füße nach oben und diese i-Position technisch einwandfrei umgesetzt wird. Alles andere ist ein bisschen wie „Hüpfen über die Schnur“. Hat man dieses Niveau an Perfektion erreicht, was in Österreich bislang acht Athletinnen gelang, entfaltet Stabhochspringen seine ganze Eleganz. In einfachen Worten spielt sich in den sieben, acht Sekunden zwischen dem ersten Schritt des Anlaufes und der Landung in etwa Folgendes ab: Als Rechtshänder hat man in der Startposition den linken Fuß vorne, macht den ersten Schritt (von z.B. 16, wie in meinem Fall) mit rechts und begibt sich in eine Art Steigerungslauf. Den Stab greift man schulterbreit, mit der rechten Hand höher als mit der linken und senkt ihn von ca. 70 Grad am Beginn bis auf etwa minus 20 Prozent kurz vor dem Einstechen in den Kasten kontinuierlich ab. Vier Schritte vor diesem Einstechen befindet sich der Stab in waagrechter Position, man beginnt den Absprung einzuleiten. Dabei nimmt man den Stab, der sich in Hüfthöhe befindet, und führt ihn eng am Körper mit dem gestreckten Arm an der Schläfe vorbei. Der letzte Schritt sollte der schnellste sein, als Rechtshänder springt man mit dem linken Fuß nach oben vorne weg und versucht, sich dabei so groß wie möglich zu machen. Beim Absprung beginnt sich der Stab zu biegen. Mit dem Körper versucht man, die Position des Absprunges beizubehalten, um dem Stab die Energie des Anlaufes zu übertragen. In der Folge bleibt das linke Bein nach hinten gestreckt, das rechte vollführt einen Knieheber, die Zehen im rechten Fuß werden angezogen, das Fußgelenk nach oben gerichtet, man erreicht mit maximal möglicher Körperspannung die C-Position. Dann bringt man die Arme nach vorn, nimmt die Schultern zurück und beginnt mit Armen und Beinen aufzurollen, um mit dem linken Bein Schwung zu holen und die Beine um 180 Grad Richtung Himmel zu strecken. Der Kopf zeigt dabei nach unten (i-Position). Während sich der Bauch in einer halben Drehung der Latte zuwendet, erhält man die gespeicherte Energie vom Stab zurück, danach stoßen sich Top-Springer von diesem ab, überqueren die Latte mit den Beinen zuerst, machen die Rotation mit und fallen rücklings auf die Matte. Die Füße zeigen im Normalfall in Richtung des Einstichkastens.
Eine komplexe Abfolge von Bewegungen, die den Stabhochsprung zur wohl technisch schwierigsten Disziplin der Leichtathletik und besonders anfällig für äußere Einflüsse macht. Bei der U20-WM im kanadischen Moncton, erster Saisonhöhepunkt des Jahres 2010, sorgten diese äußeren Einflüsse sogar für eine Verschiebung der Qualifikation um einen Tag. Zuerst ließ man uns ewig im strömenden Regen einspringen, dann, zehn Minuten vor Wettkampfbeginn, schickte man uns doch in die Kabine. Mit dem Hinweis, man schaffe es nicht, die „Wassermassen“ aus dem Einstichkasten zu schöpfen. Für mich bedeutete das, ein zusätzliches Mal die eineinhalbstündige An- und Abreise anzutreten zu müssen. Andere Nationen wohnten zwei Minuten vom Stadion entfernt, aber vermutlich hatte der Österreichische Leichtathletik-Verband die Chance, zwei, drei Euro zu sparen, beim Schopf gepackt. Als Ausrede für meine Leistung kann diese Pfennigfuchserei natürlich nicht gelten, ich scheiterte als Nummer zwölf der Entry List gegen die um bis zu drei Jahre ältere Konkurrenz denkbar knapp am Einzug ins Finale der besten 13. Die Qualifikationshöhe von 3,85 Metern im ersten statt im zweiten Versuch zu meistern hätte schon gereicht. Daran konnte auch die fürstliche Verpflegung im Hotel nichts ändern. Köstliche Waffeln in der Früh, ein üppiges Salatbuffet und Burger, die wunschgemäß und frisch zubereitet wurden, zum Dinner. Eine wohltuende Abwechslung zu der im Regelfall wenig sportlergerechten Verpflegung, die uns sonst aufgetischt wird.
Auch das ansonsten sehr imposante Athletendorf der 1. Olympischen Jugendspiele in Singapur bildete da keine Ausnahme. Besonders beeindruckte mich die Frühstücksmarmelade, deren Form unverändert blieb, wenn man sie aus der quadratischen Verpackung befreit hatte. Die Speisen am Buffet gammelten in ihren Warmhaltevitrinen so lange vor sich hin, bis auch der letzte Nährstoff entwichen war. Da lockte selbst die Fast-Food-Kette als ungleich schmackhaftere Variante. Mein Vater Frithjof stand erst gar nicht vor dieser buchstäblichen Qual der Wahl, die restriktiven Athleten-Betreuer-Quoten des IOC machten die Einquartierung im Olympischen Dorf unmöglich. Das Österreichische Olympische Comité versuchte sich als Tourismusbüro und wurde gerade noch eines Zimmers habhaft – pikanterweise in einem Stundenhotel. Gut, dass Papa so ein charakterstarker Typ und Mama nicht eifersüchtig ist. Eine Stunde Fahrzeit trennte mich von ihm, entsprechend herausfordernd war es, immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. So auch bei der Qualifikation. Die provokant frühe Startzeit (9.15 Uhr) zwang mich dazu, um 5 Uhr morgens aus den Federn zu kriechen, um 6.30 Uhr den Shuttle zum Stadion zu besteigen. Allein, denn der vom ÖLV entsandte Trainer Wolfgang Adler konnte oder wollte seine Komfortzone nicht so früh verlassen. Schade für mich, ein bisschen Zuspruch in den Stunden vor dem Wettkampf, in denen man kaum etwas Essbares runterbringt, in denen einem die Nervosität ziemlich zusetzt, wäre mir ganz gelegen gekommen. Ich bin aber sicher, dass der Coach meinem Auftritt später wenigstens als interessierter Zuschauer beiwohnte. Denn dieser Auftritt endete immerhin mit der Qualifikation fürs A-Finale der besten Sieben. Als Vorkampf-Sechste mit 3,80 Metern aufgrund der zahlenmäßig geringeren Fehlversuche. Leider konnte ich mich im Kampf um die Medaillen, der satte vier Tage später stattfand, nur mehr um zehn Zentimeter steigern, für Bronze wären allerdings 4,20 Meter nötig gewesen – 19 Zentimeter mehr als meine damalige persönliche Bestleistung.
Trotzdem war meine Enttäuschung riesengroß. Genau wie die meiner Zimmerkollegin Ivona Dadic, die zeitgleich ihr Finale im Weitsprung bestritten hatte und sich 27 Zentimeter hinter Bronze mit Rang 6 begnügen musste. Hinterm Stadion klagten wir uns gegenseitig unser Leid, heulten Rotz und Wasser ob der vertanen Chance, in meinem Fall wegen der mäßigen Leistung. Abgesehen von dem sportlichen Unhappy-End übertrafen die Youth Olympic Games aber meine kühnsten Erwartungen. Schon bei der Eröffnungsfeier blieb einem der Mund offen. Die pompöse Zeremonie samt Überdrüber-Feuerwerk soll mehr Geld verschlungen haben als die gesamten Winter-Jugendspiele 2012 in Innsbruck. Für gute Stimmung sorgten auch die Freiwilligen, die allesamt der Altersgruppe der 15- bis 18-jährigen Athleten zuzuordnen waren. Das Konzept des neuen Eventformats sah vor, dass alle Athleten für die gesamten zwei Wochen der Spiele anwesend sein mussten, um nicht nur von der Medaillenjagd, sondern auch von zahlreichen Workshops und Info-Veranstaltungen profitieren zu können. Das Programm ließ tatsächlich keine Wünsche offen, vor allem der Adventure Day auf einer Insel vor Singapur überzeugte mich restlos: Klettern, gemeinsamer Floßbau, Verkosten von exotischen Früchten – so stelle ich mir das Heranführen junger Athleten an die olympische Idee vor.
Der herausragenden Bedeutung der Youth Olympic Games wurde ich bereits im Vorfeld gewahr. In Moskau hatte man im Mai eigene Europäische Trials angesetzt, eine brutale Auslese, die einer U18-EM gleichkam. Mit übersprungenen 3,90 Metern hatte ich auch dort Platz 5 belegt, insgesamt waren neun der insgesamt 16 Startplätze für Europa reserviert. In Österreich stimmte uns 16 Athleten eine Kick-off-Veranstaltung des ÖOC samt Einkleidung auf das Debüt unter den fünf Ringen ein. Bei diesem „Come together“ in Abtenau lernte ich unter anderem Lara Vadlau kennen, eine der wohl schillerndsten Persönlichkeiten meiner Athletengeneration. Das dort genossene Medientraining interpretierte sie in den Interviewübungen ein bisschen eigenwillig. „Für Silber bleib ich nicht so ewig lang da drüben. Mein Ziel ist Gold.“ Oder: „Segeln ist nichts für alte Leute. Nebenbei einen Fisch zu gril len kannst dir abschminken.“ Ich hielt die junge Dame anfangs für reichlich eingebildet, aber sie ließ den großen Worten schon bald große Taten folgen. Die Ausnahme-Seglerin holte in Singapur Österreichs einzige Einzel-Goldmedaille, legte im Erwachsenenbereich mit mehreren Welt- und Europameistertiteln nach und reiste als Medaillenfavoritin dorthin, wo auch ich so gern gestartet wäre: zu den Sommerspielen 2016 in Rio. Vom Singapur-Kader war das außerdem Ivona Dadic, Jakub Maly (Schwimmen) sowie Paul Sieber (Rudern) gelungen, Luis Knabl (Triathlon), Viktoria Wolffhardt (Kanu) und Martina Kuenz (Ringen) scheiterten knapp.
Obwohl mich mit meiner Zimmerkollegin Ivi, mit der ich auch in Singapur viel gemeinsam unternahm, eine innige Freundschaft verband und noch immer verbindet, genoss ich es doch, einmal, wenn auch knapp, vor ihr platziert zu sein. Denn wir, die kleine Zelle tief im Westen, wurde lange Zeit – eigentlich bis zum Übertritt in die allgemeine Klasse – eher belächelt, nicht für voll genommen, eine ansprechende Leistung wurde gern als Eintagsfliege abgetan. Nach dem Motto: „Lasst die Grünbergs nur machen, da kann ja nichts dabei herauskommen.“ Weil ja keiner der Bundestrainer seine Hände im Spiel hatte, sondern ein No-Name-Coach, ein Autodidakt und Piefke obendrein. Man brauchte nicht übersensibel zu sein, um mitzubekommen, dass die Schützlinge von Nationaltrainern ein ums andere Mal frühzeitig als Stars gehypt wurden, während man als Tiroler, Vorarlberger oder Steirer eine deutlich bessere Leistung benötigte, um überhaupt wahrgenommen zu werden. So wurde mir bei Team-Europameisterschaften stets Daniela Höllwarth vorgezogen. Die rangierte leistungsmäßig zwar hinter mir, war aber Schützling von Sprung-Nationaltrainer Wolfgang Adler. Erst nachdem sie ihre Karriere beendet hatte, kam ich zum Zug. Die Athleten im Osten konnten nichts dafür, aber sie waren bis zu einem gewissen Grad „Protektionskinder“. Auch Ivi. Ohne, dass sie es jemals nötig gehabt hätte.
Honoriert wurde mein fünfter Platz von Singapur aber genauso wenig wie ihr sechster. Bundestrainer Christian Röhrling hatte in seinem Jahresbericht überhaupt auf die Youth Olympic Games vergessen. Möglich, aber nicht allzu wahrscheinlich, dass er in dem Konvolut von Zahlen und Daten den Überblick verloren hatte – Ivi und ich waren die einzigen ÖLV-Sportler, die sich für Singapur qualifiziert hatten. Während sich in Tirol Ehrung an Ehrung reihte, interessierte den Leichtathletikverband Rang 5 beim größten Nachwuchssport-Event der Welt nicht sonderlich.
Notiz von mir nahm man allerdings, wann immer es um die Festsetzung von Limits ging. Reichte dem internationalen Verband eine Saisonbestmarke von 3,80 Metern als Teilnahmeberechtigung für ein Großereignis, verlangte der ÖLV 3,95. Das betraf die anderen Aushängeschilder ebenso, war auch nicht böse gemeint, eher als Ansporn. Trotzdem wirkte es aus der Distanz betrachtet ein wenig bizarr auf mich. Das kleine Österreich, dieses Entwicklungsland in Sachen Leichtathletik, wo ohnehin meist nur eine Handvoll Sportler für eine Entsendung in Betracht kommt, verschärfte einfach mal so die internationalen Standards. Mich störte es im Normalfall nicht sonderlich, aber es konnte unangenehm werden, wenn man dem Limit hinterhersprang, statt sich gezielt auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten zu können.
Ansatzweise ging es mir in den Jahren 2011 und 2012 so. Ich trainierte hart, aber die Fortschritte ließen auf sich warten. Viel zu lange. Auch Papa war irgendwann mit seinem Latein am Ende, tourte einmal mehr durch Deutschland, um seine Informationsquellen anzuzapfen. Bei Herbert Czingon erhielt er die erhofften neuen Einsichten. „Was wollt ihr? Ihr stagniert doch. Seid zufrieden damit, andere machen in dieser Phase dramatische Rückschritte.“ Die „Phase“, von der wir nichts wussten, entpuppte sich als Teil der körperlichen Entwicklung bei Mädchen und geht mit einer vorübergehenden Verminderung der koordinativen Fähigkeiten einher. Ob es mich getröstet hätte, wenn ich es am Beginn dieser Durststrecke erfahren hätte? Schwer zu sagen. Den Saisonhöhepunkt, die U20-Europameisterschaft in Tallinn, mit Rang 18 in den Sand zu setzen wäre vermutlich trotzdem kein Stimmungsaufheller geworden. Erstmals seit Beginn meiner Karriere musste ich ein Jahr ohne persönliche Bestleistung beenden. Zudem reichten die bei der Staatsmeisterschaft erzielten vier Meter nur für Rang 4. Nie davor und nie danach hatten vier Österreicherinnen in einem Wettkampf die magische Grenze überquert.
Gegen Ende der Saison zeigte sich einmal mehr, dass Innsbruck fernab aller Kommunikationsstränge lag. Zumindest jene des Leichtathletikverbandes dürften anderswo verlaufen. Nur per Zufall bekamen wir von einer Deadline Wind, die für Sportler den Unterschied zwischen glorreicher Zukunft und Karriereende ausmachte. Eilig füllten wir die Formulare aus, um meine Chance auf Aufnahme als Sportlerin ins Bundesheer per 1. Oktober 2012 zu wahren. Der ÖLV hatte es nicht für nötig erachtet, uns zu informieren, weil meine seitwärts zeigende Leistungskurve keinerlei Chance auf Aufnahme verhieß. Womit die Funktionäre für den Moment recht hatten, damit aber auch signalisierten, dass sie mir keine Trendwende für 2012 zutrauten. Mein Ansuchen dürfte offenbar rechtzeitig eingelangt sein, kurz darauf hielt ich nämlich die Einladung zur Musterung im Februar in Linz in Händen. Dort schnitt ich zwar nicht ganz so bravourös wie bei der im gleichen Monat abgelegten Matura ab, Tauglichkeitsstufe 8 (von 9) bescheinigte mir aber, den militärischen Anforderungen physisch locker gewachsen zu sein. Was noch lange nicht hieß, dass man mich im Oktober mit offenen Armen und allen militärischen Ehren empfangen würde. Darüber sollte meine sportliche Performance der nächsten sechs Monate entscheiden.
Eines war aber klar: so viel Zeit zu investieren, ohne dass etwas dabei rausschaute – das konnte es auf Dauer nicht sein. Und ohne soziale Absicherung durch das Bundesheer würde meine Karriere allenfalls auf Sparflamme weiterköcheln. Also machte ich mich allmählich daran, einen Plan B auszuhecken. Der sah als Alternative zum Spitzensport ein Medizinstudium an der Universität Heidelberg vor. Klar hätte es da in erreichbarer Nähe ein Trainingszentrum gegeben, aber zwischen Morphologie und Humangenetik wäre wenig Zeit geblieben, Stabhochspringen auch nur annähernd in der bisherigen Intensität weiter zu betreiben. Um dieses Szenario abzuwenden, offenbarte sich mir nur eine Chance: eine Top-Leistung beim Saisonhöhepunkt, der Junioren-Weltmeisterschaft Mitte Juli in Barcelona.
Ich hatte eine mäßige erste Saisonhälfte hingelegt, den ein oder anderen Wettkampf in den Sand gesetzt, war nie über 3,90 Meter hinausgekommen. Aber die Trainings vor Barcelona steigerten meine Zuversicht, ich fühlte mich gut vorbereitet und hielt damit auch nicht hinterm Berg. Zwei, drei Tage vor dem Abflug traf ich mich mit meinem Sportpsychologen Christopher Willis. Diese Zusammenarbeit währte seit Jugendtagen, mit ihm konnte ich mich immer über alles austauschen. Natürlich auch über Themen, die weit über den Sport hinausgingen. Ob es Streit mit Christoph oder der besten Freundin, Stress in der Familie gab – Chris hörte zu, regte zum Nachdenken an, erarbeitete mit mir Strategien. Und genau so sollte es auch sein. Weil Baustellen im sozialen Umfeld viel öfter als Leistungshemmer wirken als sportspezifische Faktoren wie falsche Trainingsschwerpunkte, Blockaden und Ähnliches. Diesmal aber unterhielten wir uns ausschließlich über Sport, über den nächsten, so entscheidenden Wettkampf. Ich eröffnete Chris, in Barcelona 4,10 Meter als Minimalziel anzupeilen, eigentlich 4,20 Meter überwinden zu wollen. Eine neue persönliche Bestleistung also, die sich gewaschen hatte. Er versuchte mich aus der Reserve zu locken, bezeichnete das Gelingen meines Vorhabens als „sehr unwahrscheinlich“, weil Rekorde in der Drucksituation des Saisonhöhepunktes selten gelingen. Ich aber hielt an meiner Argumentation fest, wusste, dass im Training große Fortschritte feststellbar waren, ich das neue, höhere Level nur noch nicht im Wettkampf hatte umsetzen können. Damit gab er sich zufrieden, meinte, er wäre nur beunruhigt gewesen, wenn ich mich hätte verunsichern lassen.
In Barcelona trat endlich einmal ein rot-weiß-rotes Team in halbwegs ansehnlicher Größe an. Unter den elf, zwölf Qualifizierten fand sich sogar eine 400-Meter-Staffel, doch bis deren große Stunde gekommen war, hatten einige der Mitglieder längst w.o. geben müssen. Auch meine Zimmernachbarin konnte ihren Wettkampf nicht beenden. Nach einer im Abschlusstraining erlittenen Verletzung nahmen die Coaches Ivi nach fünf Bewerben des Siebenkampfes an der zehnten Stelle liegend aus der Wertung. Man wollte ihren Start bei den ein Monat später stattfindenden Sommerspielen von London, für die sie sich beim Mösle-Meeting in Götzis überraschend qualifiziert hatte, nicht gefährden. Ivi traf die Entscheidung hart, sie ist keine, die einen Wettkampf leichtfertig aufgibt. Mein Ruhetag zwischen Qualifikation und Finale diente somit unter anderem dazu, sie wieder aufzurichten.
Ich selbst konnte zu diesem Zeitpunkt zufrieden zwischenbilanzieren, hatte mich unter 29 Teilnehmerinnen als Elfte für das Finale qualifiziert, das vorrangige Ziel somit erreicht und dabei meinen persönlichen Rekord um vier Zentimeter auf 4,05 Meter geschraubt. Die ganze Weltmeisterschaft hatte bis dahin nichts zu wünschen übrig gelassen. Statt eines Wald- und Wiesenstadions mit eilig zusammengeschraubter Zusatztribüne, wie wir es sonst so oft im Nachwuchsbereich erlebten, hatte uns das prächtige Olympiastadion auf dem Montjuic empfangen. Dazu das Sommerwetter mit ungetrübtem Sonnenschein, wie ich es bei Wettkämpfen und Trainings immer liebte, ein Athletenhotel in Strandnähe und eine Stadt, die bekanntlich nicht mit Reizen geizt.
Dem großen Anlass entsprechend zelebrierte ich mein Wettkampfritual diesmal besonders ausgiebig. Zu den rosa Glückssocken, von denen mich bis zu sechs Paar begleiteten, über das Schweißband, das je nach Trikotfarbe in Weiß oder Rot gehalten war, bis hin zur pinken Hello-Kitty-Unterhose war alles vertreten, von dem ich überzeugt war, dass es zum Erfolg beitragen konnte. Auch beim Styling überließ ich nichts dem Zufall. Zur üblichen Schminkroutine und Mamas Haarflechtkunst zählten bei internationalen Anlässen rotweiß-rote Fingernägel zum Pflichtprogramm. Diesmal legte sogar meine Teamkollegin Ivi Hand an. Sie verpasste mir für alle Fingernägel ein kleinkariertes Muster in den österreichischen Nationalfarben und garnierte das Kunstwerk mit Strasssteinen. Logisch, dass diese Form der Maniküre ein wenig mehr Zeit in Anspruch nahm. Die Stunde war jedenfalls gut investiert, grenzte schon fast an innere Einkehr.
Trotzdem fand ich im Finale nur mühevoll in den Wettkampf. Irgendwie hatte ich mir im Vorfeld schwergetan, Ziele zu setzen. Laut Entry List war ich der absolute Underdog, niemand sonst hatte 4,05 Meter als Personal Best vermerkt, ein paar wenige 4,10 – die meisten aber wesentlich imposantere Höhen. Prompt schwächelte ich bei 3,80 Metern, hatte schon zwei Versuche verbockt, als ich mir vor Augen hielt, dass ein Finale ohne gültigen Versuch nicht einmal für eine Endplatzierung reichen würde. Also riss ich mich am Riemen, blendete die Nervosität meiner Eltern auf der Tribüne aus, lief an, stoppte, ging zurück, lief wieder an – und schwang mich über die Latte. Zur Hitze hatte sich inzwischen eine ziemlich steife Brise gesellt. In Kombination mit der tief stehenden Sonne eine Herausforderung für die Mehrzahl der Athletinnen. Ich hingegen fühlte mich an das Universitäts-Sportinstitut Innsbruck erinnert. Auch dort läuft man spätnachmittags zunächst in der Sonne an, ehe mir auch die Böen aus wechselnden Richtungen vor, die dankenswerterweise aber immer auf Rückenwind drehten, wenn ich mich Richtung Einstichkasten in Bewegung setzte. Auch damit hatte ich mich in Innsbruck zu arrangieren gelernt. Drei, vier Jahre waren wir ohne Halle gewesen, mussten Wind und Wetter trotzen. Nun begann sich dieses Handicap einer beklagenswerten Infrastruktur für einen Abend ins Positive zu verkehren. Die deutsche Konkurrenz zum Beispiel, die sonst nur in der Halle oder bei Windstille im Freien, also quasi unter Laborbedingungen übte, bekam hingegen Probleme.
Während eine Mitfavoritin nach der anderen die Segel strich, vom Winde verweht, vom Licht-Schatten-Wechsel aus der Konzentration gebracht, nahm ich die nächsten Hürden im ersten Versuch. Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie hoch die Latte da eigentlich lag. 3,95 Meter; 4,05 Meter; 4,15 Meter. Am Ende hatte ich als Einzige im Feld bei herausfordernden Bedingungen eine persönliche Bestleistung aufgestellt – und beinahe eine Medaille geholt. Die Konkurrenz aus Italien und Australien meisterte 4,20 Meter jeweils erst im dritten Versuch, sonst wäre mir Bronze oder sogar Silber sicher gewesen. Für mich hatte der „undankbare“ vierte Platz aber keinerlei schalen Beigeschmack, ganz im Gegenteil – er fühlte sich an wie ein Sieg. Denn einerseits hatte ich mein Ranking in der Meldeliste um neun Positionen getoppt, andererseits die beste ÖLV-Platzierung aller Zeiten bei Junioren-Weltmeisterschaften eingestellt – 1996 war Günther Weidlinger in Sydney über 3000 Meter Hindernis ebenfalls knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Und – auch nicht ganz unwesentlich: Heidelberg würde mich so schnell nicht sehen, Medizinerin so bald auch keine aus mir werden. Flugs kramte ich Plan A aus der imaginären Schublade hervor. Profisport, du hast mich wieder! Oder eigentlich: weiterhin.
Das Beste an meinem Barcelona-Coup aber war: Er hatte am Abend des vorletzten Wettkampftages stattgefunden. Das restliche Team saß, weil nicht mehr ins Wettkampfgeschehen verwickelt, geschlossen auf der Tribüne und feuerte mich an. Und anschließend tauchten wir gemeinsam ins Nachtleben ab. Bis fünf Uhr früh trieben wir uns am Hafen herum, wo die Clubs, wie Perlen an einer Schnur aufgefädelt, um Kundschaft buhlen. Ich für meinen Teil hätte ja schon früher den geordneten Rückzug angetreten, aber als eine der Älteren im Team ließ ich mich erweichen, darüber zu wachen, dass die jüngeren Teamkollegen wohlbehalten ins Hotel zurückkehrten. Es war ein harter Job, aber eine musste ihn ja machen.
Die Performance von Barcelona und der eine Woche später errungene erste Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse trugen mir – neben einer Nachnennung durch den Verband beim Bundesheer – eine Einladung zur Premiere der Gugl Games ein. Das von Manager Robert Wagner wiederbelebte Linzer Leichtathletik-Meeting strahlte im Glanz der Stars der acht Tage davor zu Ende gegangenen Sommerspiele von London. Beim Abendessen im Hotel konnte ich meinen Blick kaum von den Lauf-, Sprung- und Wurfgöttern abwenden. Mit Kirani James (Grenada/400 m) und Felix Sanchez (Dominikanische Republik/400 m Hürden) standen zwei frisch gebackene Olympiasieger am Start (und gewannen), Justin Gatlin (USA/Bronzemedaillengewinner über 100 Meter) war auch eingeflogen, musste sein Rennen aber wegen eines Kreislaufkollaps absagen. Auch kein ganz Unbekannter: Oscar Pistorius, der zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich wegen seiner Auftritte bei Olympischen und Paralympischen Spielen für Aufsehen sorgte. Meine prominenteste Konkurrentin kannte ich ebenso aus Film, Funk und Fernsehen: die regierende Weltmeisterin aus Brasilien, Fabiana Murer. 55 Zentimeter trennten uns am Ende, wobei ich mein damaliges Potenzial mit 4,10 Metern durchaus abzurufen vermochte.
Sechs Wochen später trat ich meinen neuen Job an: als Rekrutin beim Österreichischen Bundesheer. Aller Anfang war gar nicht so schwer, bei der vierwöchigen Grundausbildung im steirischen Gratkorn blieben Schikanen aus. Keine Nachtmärsche mit vollem Gepäck – alles, was uns von den Ausbildnern abverlangt wurde, war das Zurücklegen einer vier oder fünf Kilometer langen Strecke mit Helm und Waffe. Das „Sportlerregiment“, das in Gratkorn strammstand, kannte sich in weiten Teilen von gemeinsam erlebten Großereignissen wie den Youth Olympic Games in Singapur. Ivona Dadic war ebenso einberufen worden wie Vicky Wolffhardt, Jakub Maly – und auch Lara Vadlau. Lara, Gehorsam und Uniformität, das passte, wie erwartet, nicht unbedingt wie die Faust aufs Aug. Als wir uns in einer bestimmten Adjustierung im Kasernenhof aufstellen sollten, trug Lara neben einer riesigen pinken Uhr eine Extrajacke – mit dem Hinweis, sie werde sich hier jetzt sicher nicht verkühlen. Immer und immer wieder ließen uns die Ausbildner antreten, das optische Erscheinungsbild blieb unverändert. Selbst die Mehrheit der Rekruten rollte bereits mit den Augen. Ob Lara das Teil am Ende aus- oder der Rest die Jacke anzog, kann ich nicht mehr sagen. Es sind unter anderem Verhaltensoriginaltäten wie diese, für die ich die Segel-Rebellin so mag.
Nicht alle von uns waren gleichermaßen für das Leben im Feld geeignet. Manche entpuppten sich beim Gefechtsdienst sogar als veritables Sicherheitsrisiko. Ivi durfte man getrost ein solches nennen. Denn jeder Angreifer wäre wohl dankbar, lautstark auf die Position der feindlichen Linien hingewiesen zu werden. Genau das hätte die bekennende Spinnen- und Insektenhasserin getan, indem sie spitze Schreie ausstieß, als sie in dem Busch, in dem sie sich verschanzt hatte, allerlei Kleingetier ausmachte. Ich hingegen fand Gefallen an der Bewegung an der frischen Luft, auch am Robben durch den Matsch, war ja, wie erwähnt, eher wie ein Bub erzogen worden. Am Ende der Grundausbildung stand die Angelobung vor dem Schloss Eggenberg. Man hätte die feierliche Stimmung durchaus genießen können, wenn da nicht das zweistündige Ausharren in der immer gleichen Position gewesen wäre. Nur gut, dass lediglich ein paar Fackeln die Szenerie erhellten. So wurden die kleineren und größeren Unzulänglichkeiten beim Stehen in Reih und Glied weniger offenbar. Lara musste der Angelobung übrigens wegen einer gerade überstandenen Knieoperation fernbleiben. Sie hatte sich unter nie restlos geklärten Umständen einen Kreuzbandriss zugezogen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.