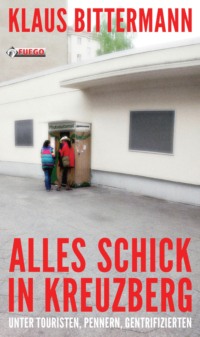Kitabı oku: «Alles schick in Kreuzberg», sayfa 2
Wählt Guy Debord
»Was macht ihr auf meiner Brücke?«, fragt uns der Vorsitzende der PARTEI Martin Sonneborn, als wir über die Admiralbrücke gehen. »Wir müssen nur schnell was erledigen und kommen dann wieder zurück«, antworte ich. Das ist zwar keine Antwort auf seine Frage, aber die habe ich auch nicht verstanden.
Martin Sonneborn nickt freundlich und grinst chinesisch wie immer. Ein paar Meter weiter sagt mir Nadja, was Sonneborn wirklich gesagt hat. Daraufhin finde ich meine Antwort gar nicht so schlecht, denn ich mag es, wenn Leute aneinander vorbeireden.
Martin Sonneborn hat mit seiner PARTEI auf der Admiralbrücke plakatiert, z.B.: »[kriminelle] Touristen raus«. Warum eigentlich nur die kriminellen, frage ich mich? Nicht, dass ich etwas gegen Touristen habe. Einige meiner besten Freunde sind Touristen, zum Beispiel ich. Aber die reichen mir auch schon. Die ganzen anderen müssen jetzt nicht unbedingt sein!
Die Touristen stört das Plakat nicht. Nicht einmal die kriminellen Touristen. Sie haben sich auf Decken niedergelassen, machen Picknick und spielen Karten. Sie lassen sich durch nichts stören, auch nicht von den Plakaten der Grünen, auf denen sich jeweils ein Gesicht und ein Name befindet, wobei weder das eine noch das andere so beschaffen ist, dass man sie sich merken würde.

Dennoch gibt es Menschen, die sich daran stören, und zwar eine Gruppe, die es schon lange nicht mehr gibt und die auch nicht in Berlin, sondern in Paris zu Hause war: die Situationistische Internationale. Ihr Anführer hieß Guy Debord und hat nie im Leben gewählt, weil er für Räte war und gegen die Delegierung von Macht. Jetzt ist die SI wieder auferstanden und überklebt die Grünenplakate mit »Wählt Guy Debord«. Den Touristen fällt das nicht auf. Nicht mal den französischen. Den Einheimischen aber auch nicht.
Ich hingegen finde das so aufregend, dass ich nach Hause eile, um meine Digitalkamera zu holen, um dieses Dokument festzuhalten. Dann gehe ich weiter in die Admiralstraße, wo die PARTEI bei der kpd/rz ihr Wahlbüro aufgemacht hat, um zu fragen, ob ich schon mal meine Stimme abgeben kann. Aber das Büro hat zu. Es hängen nur ein paar Plakate am Schaufenster. Vier PARTEI-Abgeordnete, die in Berliner Hinterhofecken strullen.
Guy Debord hätte das gefallen. Vielleicht aber auch nicht. Man kann ihn leider nicht mehr fragen. Er ist seit 1994 tot.
Letzte Worte
In der Dieffenbachstraße sagt eine Frau zu ihrer Freundin, dass es »hier nicht so geleckt« sei wie in anderen angesagten Bezirken. Stimmt. Zum Beispiel die Post. Seit sie sich in kleinen Ramschläden versteckt, muss ich meine Pakete zum Kottbusser Damm schleppen. Dort ist die Post bei McPaper untergeschlüpft. Ich stelle mich hinter einer Schlange an, deren Schwanz bis zur Straße hinausreicht, wo ich Passanten im Weg stehe. Vor dem Schalter habe ich die Muße, stundenlang pinkfarbene »Miss-Modell«-Produkte wie Kämmchen, Beutelchen, Spieglein zu bestaunen, alles eben, was eine Miss Modell so braucht, um eine Miss Modell zu werden.
Auf dem Weg zum Arzt komme ich beim türkischen Süpermarket Bolu vorbei, wo es Helâl et Pazari gibt. Die Obstauslage nimmt die Hälfte des Bürgersteigs ein. An einem Baum direkt daneben steht ein etwa fünfjähriger Junge und pinkelt. In zweiter Reihe parkt eine fette schwarze und glänzende Mercedes-Limousine. Die Beifahrertür steht offen. Hinter dem Steuer spricht ein dicker Türke auf Türkisch ins Handy. Auf der Rückbank sitzt eine Frau, die in einem Pelzmantel mit hochgestelltem Pelzkragen steckt. Der Junge zieht den Reißverschluss hoch und klettert auf den Beifahrersitz.
Beim Arzt sitze ich neben einem alten unrasierten Mann mit Gehhilfe. Sein Sohn bringt ihm Kaffee: »Hab ick von Kaiser’s jeholt. Die ham auch ne Bockwurst. Willste eene?« Der alte Mann will keine. Aber Kaffee schon. »Schmeckt jut, der Kaffee«, sagt er. »Ja«, sagt sein Sohn wieder, »is von Kaiser’s, aber kipp ihn nicht aus.« »Nene, mach dir mal keene Sorgen«, sagt der Alte. »Schmeckt echt jut, der Kaffee«, sind seine letzten Worte, dann kippt er um. Der Mann. Der Kaffee aber auch.
Nach Camus muss man sich diesen Mann als glücklich vorstellen. Er hat, glaube ich, in seinem Leben genug Felsbrocken vergeblich den Berg hochgerollt. Und der Kaffee hat ihm auch geschmeckt, obwohl das für Kaiser’s jetzt keine gute Werbung war.
Schönen Tag noch
Da geht man morgens trantütig zum Bäcker, um Mr. Fup ein Schokoladencroissant zu kaufen, auf das er zum Frühstück besteht, und schon muss man kurze Zeit später im Zeit-Magazin lesen, dass man irgendwen nicht gegrüßt hat.
Der Irgendwer heißt Harald Martenstein, dem im Zeit-Magazin eine Kolumne eingeräumt wurde, um sich über solche Dinge beschweren zu können, wie dass er nicht gegrüßt worden ist, und das schon früh beim Bäcker. Dabei kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich ihn nicht gegrüßt habe. Aber es tut mir natürlich leid, denn wenn ich gewusst hätte, wieviel Harald Martenstein daran liegt, von mir beim Bäcker gegrüßt zu werden, wäre ich natürlich ganz anders durch die Welt gelaufen, immer mindestens mit einem Auge die Gegend abscannend, ob Harald Martenstein gerade irgendwo herumläuft.
Ich hätte das gemacht, ehrlich, obwohl das gar nicht so einfach ist, denn Harald Martenstein gehört eher zu den unauffälligen Menschen im Viertel, die man ziemlich leicht übersehen kann. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Er trägt beispielsweise keinen rosafarbenen Anorak und auch keine Schuhe in Pink. Das würde mir auffallen.
Manchmal sehe ich ihn vor meinem Fenster vorbeilaufen, und da hat er meistens irgendwas Graues an oder Beiges, was Rentner gerne tragen, und eine Aktentasche, in der er wahrscheinlich sein Pausenbrot hat. Aber das weiß ich natürlich nicht genau. Und bis ich dann, wenn er bei mir vorbeiläuft, das Doppelfenster aufgemacht habe, ist er auch schon wieder weg, und irgendwie wäre es schon komisch, wenn ich ihm dann hinterherriefe: »Hallo Harald! Hallooo!«
Das wär vielleicht schon ein wenig aufdringlich, und wenn er sich dann fragend umdrehte, weil jemand »Harald« gerufen hat, und womöglich denkt, es wär was Wichtiges, dann wäre es vielleicht ein wenig dürftig, wenn ich ihm nur sagen könnte: »Schönen Tag auch noch«, weil was anderes würde mir nicht einfallen, weil ich jetzt nicht was wirklich Wichtiges mit ihm zu besprechen gehabt hätte.
Obwohl, jetzt vielleicht schon. Ich meine, jetzt, wo er sich im Zeit-Magazin darüber beschwert, dass ich ihn nicht gegrüßt habe. Harald Martenstein schreibt nämlich, ich sei ein »Kapitalismuskritiker« und er nicht. Ich bin fast ein wenig gerührt. Das hat nämlich noch nie jemand zu mir gesagt, aber ich finde es schön, dass es endlich mal jemand anspricht. Es stimmt nämlich. Ich habe tatsächlich einiges am Kapitalismus auszusetzen, zum Beispiel Grußzwang frühmorgens beim Bäcker. Nein, das ist jetzt natürlich Quatsch. Aber trotzdem, der Kapitalismus ist schon ziemlich Scheiße, auch wenn man es hier im »Graefekiez« nicht so mitbekommt.
Außerdem schreibt Harald Martenstein, dass ich unter »einer ähnlichen Krankheit leide, wie sie auch Josef Stalin gehabt hat«. Huch, denke ich, und gucke natürlich gleich bei Wikipedia nach, an welcher Krankheit Stalin gelitten hat. Schlaganfall, sagen die einen, er sei vergiftet worden, sagen andere. Ich bin jetzt kein Stalin-Spezialist, und vielleicht hatte er ja noch eine andere Krankheit, aber Schlaganfall hatte ich noch nicht, und vergiftet worden bin ich meines Wissens auch noch nicht. Ich glaube, das hätte ich gemerkt. Aber ich werde das im Auge behalten.
Harald Martenstein schreibt dann noch, dass, wenn ich als Kapitalismuskritiker den Kapitalismus abgeschafft und den Sozialismus eingeführt hätte, er Angst hätte, ich würde ihm dann »irgendwie wehtun«, weil er kein Kapitalismuskritiker ist. Wie er darauf kommt, ist mir noch schleierhafter als Stalins Krankheit, an der ich angeblich leide. Ich glaube aber, wenn tatsächlich so ein unwahrscheinlicher Fall einträte wie Sozialismus in Deutschland, dann wäre ich der Erste, der abtauchen würde, denn schließlich kritisiere ich nicht den Kapitalismus, damit Sozialismus herauskommt, außerdem stand nur eine Woche vorher in der Zeit, dass ich »Anarchist« sei, und denen geht Sozialismus ja wohl total am Arsch vorbei.
Wie auch immer. Ich schätze mal, am ersten Tag des Sozialismus gäbe es sehr viel zu tun. Harald Martenstein weh zu tun, gehört da, glaube ich, nicht dazu. Kann ich mir nicht vorstellen, nicht mal, wenn Harald Martenstein sein Hemd aufreißt und mit nackter Brust durch die Straßen läuft und die Sozialisten auffordert, ihn zu erschießen, weil er den Kapitalismus gut findet.
Die Wagenknecht würde höchstens sagen: »Ach, der Martenstein schon wieder, schreib lieber wieder eine Kolumne darüber, dass dich beim Bäcker irgendwer nicht gegrüßt hat.« Die Sozialisten würden ihn glatt ignorieren, und die Kommunisten auch. Aber wahrscheinlich wäre es genau das, was ihm wehtun würde. Na, dann hab ich ja hiermit meine Therapeutenpflicht erfüllt. Bitte schön. Ich hab das gerne gemacht.
Danke? Da nicht für.
Doktor Seltsam
Ich suche die Hasenheide Nr. 69, aber nicht aus Gründen, die diese Nummer nahelegt (ich meine jetzt in sexueller Hinsicht, falls jemand auf der Leitung stehen sollte, was mir ja ständig passiert), sondern um zu gucken, ob sich hinter dieser Adresse immer noch die Dicke-Pizzateig-Pizzeria von früher verbirgt.
Vor der Tür begrüßt mich Dr. Seltsam. Er hat einen schwarzen Frack an, dazugehörige schwarze Hosen, ein weißes Hemd und eine rote Fliege, die leicht Schlagseite hat. Er hat heute seine nach ihm selbst benannte Wochenshow, und ich bin sein »Hauptact«, wie ich von ihm erfahre.
Zum Glück habe ich mein Buch dabei, aus dem ich was vorlesen kann. Vorher aber erzählt Dr. Seltsam eine kleine Reminiszenz an den vor kurzem verstorbenen Franz Josef Degenhardt. Gut, dass Franz Josef Degenhardt die nicht mehr hören kann. Nach einem Konzert nämlich, als der große und noch sehr junge Fan Dr. Seltsam in Degenhardts Garderobe vorgedrungen war, fragte Degenhardt nicht ihn, seinen Fan, sondern einen »üblen Halunken« von der Plattenfirma: »Und? Wie bin ich gewesen?« Das war der erste große Knacks in der Beziehung zwischen Dr. Seltsam und Franz Josef Degenhardt.
Danach kommt ein sehr expressiv vorgetragenes und vertontes, aber sich nicht reimendes Gedicht von Brecht, das ich nicht verstehe, mich aber sehr beeindruckt. Und danach wiederum kommt der »Hauptact«, also ich. Dr. Seltsam sagt, ich würde schreiben wie Franz Hessel, dessen Sohn Stéphane Hessel ja auch ein Buch mit dem Titel »Empört Euch!« geschrieben habe, und das wäre ja auch mal wieder nötig gewesen.
Ich sage, dass sein Vergleich mit Franz Hessel einen Haken hätte, und zwar den, dass ich jetzt Franz Hessel lesen müsste. Aber das ist gar nicht nötig, denn Dr. Seltsam klärt mich in der restlichen Zeit bis zur Pause auf, wie Franz Hessel hier durch die Gegend flaniert sei, immer wachsamen Auges, und dabei solche Dinge wie ein Einhorn auf der Kirche am Südstern entdeckt habe, und wenn man ein Einhorn sähe, wäre man ein glücklicher Mensch.
Außerdem hätte es schräg gegenüber mal eine Ruine gegeben, in der sich Andreas Baader versteckt hätte, heute befände sich da leider eine Werbeagentur, und ein paar Häuser weiter hätte die Spionageorganisation Rote Kapelle ihr Hauptquartier gehabt, die nur durch einen dummen Zufall aufgeflogen sei, weil die Putzfrau nicht in die geheime Tätigkeit von Harnack und Co. eingeweiht gewesen sei. Ich weiß das alles nicht. Ich glaube, ich bin als Flaneur ein Versager.
Immer Ärger mit der Post
Ich eile zum nächsten Briefkasten, um schnell noch einen Brief einzuschmeißen, aber die Post ist schneller. Mit einem Bagger reißt sie den Briefkasten gerade aus dem Boden. Die Gentrifizierten schreiben sowieso keine Briefe mehr, nur noch Elektropost, und der Bittermann verstopft mit seinen Büchersendungen nur unsere Briefkästen, denkt die Post, und außerdem denkt sie: Wer was von mir will, muss schon zu mir kommen und sich hinten anstellen.
Natürlich versuche ich das zu vermeiden. Wer mag schon die Post immer anbetteln: Bitte, liebe Post, kannst du das Paket für mich in eine andere Stadt bringen?
Ich frage den Paket-Boten, der bei mir die Pakete für das gesamte Haus ablädt, ob er eine Büchersendung, die durch keinen Briefschlitz passt (die schmalen Briefschlitze sind eine weitere ausgetüftelte Strategie, um mich zu ärgern), zur Post mitnehmen könne. Der Mann hat eine Glatze. Ob das was zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber er guckt lange und ungläubig auf die Sendung.
»Büchersendung, schon frankiert«, sage ich.
»Was ist det?«, fragt der Mann, und wendet die Sendung hin und her, als ob es sich um was Unanständiges handeln würde.
»Büchersendung«, sage ich nochmal.
Wieder längeres misstrauisches Beäugen der Sendung.
»Das darf ich gar nich annehmen«, sagt er. »Wenn ich die jetzt einfach wegschmeiße, wa, und die kommt dann nich an, was dann?«
»Sie wollen die Post wegschmeißen?«, frage ich.
»Ne, war doch nur ‘n Beispiel. Aber wenn irgendwas passiert, dann gibt das nur Ärger«, sagt er. »Also ich hätt’s echt gern jemacht, wa, aber det darf ich gar nich.« Ich sage nichts mehr.
Auf dem Weg zur Post komme ich an einer Rest-Alkohol-Fraktion vorbei. Eine Frau mit einem Bier in der Hand beschimpft eine andere: »Du dreckige Fotze, du mieses Stück Scheiße«, denn die andere hat offensichtlich eine Flasche Bier fallen lassen. Vielleicht sollte ich mir von der Frau ein paar Tipps geben lassen, wie man mit gewissen Leuten umgeht.
Occupy Römer
Ich bin eingeladen zu einem »Künstleressen«. Das steht so auf der Einladungskarte. Es gibt dann aber gar keine Künstler, sondern Hühnchen mit Kartoffelgratin und Gemüse. Das schmeckt sehr gut, aber nach der großen Erwartung bin ich etwas enttäuscht, denn Künstler hatte ich noch nicht. Nicht zum Lunch jedenfalls. Höchstens am Hals.
Es sind aber gar keine Künstler da, sondern nur Leute, die mal in der Werbebranche gearbeitet haben und jetzt Fahrräder verkaufen, oder die seit dreißig Jahren dabei sind, ihre Dissertation zu schreiben und sehr langfristig Filmprojekte planen, von denen noch nie eins zustande gekommen ist. Und Oliver Maria Schmitt, der Bürgermeisterschaftskandidat von Frankfurt für die PARTEI, außerdem Autor des »Besten Romans aller Zeiten«, also ein Mensch, an dem die Hybris nicht einfach so vorbeigegangen ist.
Ich frage ihn, wie seine Chancen bei den kommenden Wahlen im März 2012 stehen. »Sehr gut«, sagt er, weil alle anderen Parteien nur Kandidaten hätten, die niemand kennt. Er würde sich an die Occupy-Bewegung dranhängen und mit der Losung »Occupy Römer« einen erfolgreichen Wahlkampf machen, weil er in seinen Reden dann sagen könne, was für alle nur eine Art politische Praxis sei, sei für ihn schon seit Jahren »gelebtes Leben«, denn seine Frau heiße mit Mädchennamen Römer. Leider wolle seine Frau nicht mitmachen, weshalb er für seinen Wahlkampf auf der Suche nach einer attraktiven, jungen blonden Frau sei, die man als Politiker nun mal an seiner Seite brauche, wenn man einen richtigen amerikanischen Wahlkampf machen wolle, und als Hunter S. Thompson von Frankfurt käme für ihn nun mal nichts anderes in Frage. Ob ich ihm nicht jemand für die Zeit des Wahlkampfs zur Verfügung stellen könne. Danach lasse man das Ganze als schmutzigen Wahlkampf durch Bild auffliegen, und »seine« Wahlkampffrau könne anschließend darüber ein Buch schreiben mit dem Titel »Ich war die Frau des Frankfurter Bürgermeisterschaftskandidaten«.
Ich frage ihn, ob ich das nicht machen könne. Ich würde mir auch die Beine rasieren. »Ich weiß deinen guten Willen zu schätzen«, sagt Schmitt, »aber ich sagte ›jung, attraktiv und blond‹.«
Dann überlegen wir weiter, und dann sage ich wieder, dass ich dafür sogar meine Beine rasieren würde, und Oliver Maria Schmitt sagt wieder, dass er meinen guten Willen zu schätzen wisse. Das geht eine ganze Weile so. Da uns einfach niemand sonst einfällt, der den Job übernehmen würde, trinken wir noch etwas.
Dann gehe ich auf die Straße, winke ein Taxi heran und steige hinten ein. Eine junge, attraktive und blonde Frau in sehr kurzem Minirock und roten hochhackigen Lackschuhen steigt vorne ein. Ich sage, das Taxi sei schon besetzt, und zwar mit mir. Sie möchte trotzdem mitfahren. Ich sage, sie wisse doch gar nicht, wohin ich wolle. Das sei ihr egal, sagt sie. Ich lasse sie mitfahren. Ich bin ja kein Unmensch, und schon gar nicht zu so später Stunde. Vielleicht kommt sie ja als Frankfurter Bürgermeisterschaftskandidatengattin in Frage, aber als ich versuche, ihr den Fall darzulegen, reagiert sie mit keinem einzigen Wort. Als wir dann zusammen aussteigen und ich die schweigsame blonde, attraktive und junge Frau frage, ob ich ihr helfen könne, schüttelt sie nur ausdruckslos den Kopf und stöckelt in die Nacht.
Kool & The Gang
Zuerst zur Schneiderin, die eine Hose entweder weiter oder enger machen sollte, was ich aber hier nicht verrate, weil dann jeder mit einer gewissen Genugtuung denkt, der ist also auch fetter geworden, oder neidisch eben das Gegenteil.
Die Schneiderin ist sehr dick, fast so breit wie hoch, also eher eine Kugel. Meine Probleme hat sie nicht. »Hab’s wieder nicht geschafft«, sagt sie, denn gestern hatte sie es auch nicht geschafft. Dann sagt sie: »Setzen Sie sich, ich mach das schnell.«
»Ne, ich hab noch was zu tun«, sage ich.
Sie will mich umstimmen: »Immer, wenn ich Sie hier reinkommen sehe, muss ich an Kool & The Gang denken.«
»Was?«, frage ich, weil mich das verwirrt.
»Kool & The Gang! Kennen Sie nicht?« Dabei schwingt sie ihre Hüftspeckreifen und lacht.
»Doch«, sage ich und lache auch, allerdings mehr aus Verlegenheit, denn von »Kool & The Gang« kenne ich nur den Namen.
Dann gehe ich zum Kuaför, der mir sagt, ich solle mich bitte setzen, da wären noch zwei Leute vor mir. Ich sage, keine Zeit, ich käme später wieder. Auf dem Stempel, den ich im Stempel-Laden abholen will, steht nur die Hälfte, nämlich »Bitter«. Ohne »Mann«. Der Stempel-Mann sagt: »Setzen Sie sich, ich schnitze Ihnen schnell einen neuen.« Sagt er natürlich nicht, aber es hätte mich nicht gewundert.
Eigentlich schade, dass man die ganze Zeit nicht hat, die zu verplempern einem überall großzügig angeboten wird. Laut Hans Magnus Enzensberger bin ich eine arme Sau, denn Reichtum bedeute nicht nur viel Geld, das ich auch nicht habe, sondern auch viel Zeit.
Dieser Gedanke deprimiert mich. Aber nicht sehr. Nur, dass gar nichts von den Erledigungen geklappt hat, macht mich fertig. Wenn ich das gewusst hätte, denke ich, wäre ich gar nicht erst losgegangen. Oder wie Wolfgang Stumph das viel besser sagt, dem es am selben Abend bei Markus Lanz genauso geht wie mir schon den ganzen Tag über: »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht gar nicht so richtig gekommen.«
Daheim gebe ich bei Google »Kool & The Gang« ein. Aber da stürzt mein Computer ab.
Der Flaum im Gesicht der Nazis
Der Tipp kommt von einem Berlinale-Experten. Irgendwas leichtes Französisches. Der Berlinale-Experte sagt natürlich mehr als nur: »Ist irgendwas leichtes Französisches«, aber mehr will ich mir gar nicht merken, weil ich das ja dann sowieso früh genug sehe.
Ich komme mit einem abgelaufenen Journalistenausweis rein, was mich ein wenig skeptisch macht. Vorne in der zweiten Reihe ist noch was frei. Ein Mann im grauen Zweireiher, der ein bisschen hängt – der Zweireiher, nicht der Mann –, stellt den Film vor. Sich selbst brauche er ja nicht vorzustellen, weil ihn sowieso jeder kenne. Da habe ich ja Glück, dass ich nicht »jeder« bin, weiß jetzt aber immer noch nicht, wer er ist.
Er übergibt das Mikrofon dann einer Frau, die sagt, dass sie nur sagen wolle, dass Alfred Holighaus nicht da sei, was schade ist, denn den hätte ich gekannt. Er ist Schalke-Fan und wenn Schalke gegen Dortmund spielt, gucken wir zusammen, wie Schalke verliert.
Dann werden noch ein paar Leute, die den Film gemacht haben, vorgestellt, aber nicht der Regisseur, weil der gerade in seiner Villa in Los Angeles ist.
Als der Film anfängt, stellt sich schnell heraus, dass es nichts leichtes Französisches ist, sondern was schweres Deutsches. Ich merke das daran, dass die Untertitel Englisch sind, was mich zunächst etwas verwundert. Und dann wird auch noch deutsch gesprochen. Trotzdem lese ich die Untertitel mit, weil’s da mehr zur Sache geht. Wenn einer sagt: »Bewegt euch!«, steht unten: »Move your asses!«
Sonst werden viele glatzköpfige Neonazis gezeigt, wie sie in Autos rauchen, kopulieren, laut Nazimusik hören, Bier trinken, schlägern und tun, was Nazis eben so tun. In Nahaufnahme. Man sieht sogar den Flaum im Gesicht der weiblichen Nazis. Das wollte ich eigentlich nicht sehen. Als ich aus dem Kino gehe, wartet schon der Mann im grauen Zweireiher auf mich und sagt: »Das hier sind die Macher des Films.« Ich sage nichts. Das mit dem Flaum hätten sie sowieso nicht verstanden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.