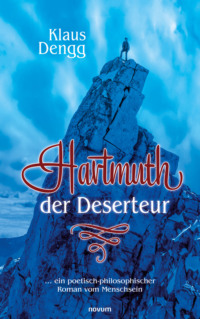Kitabı oku: «Hartmuth der Deserteur», sayfa 2
Jeder Hof hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Stolz und seinen eigenen Geist, der über ihm schwebt, ein Geist, der nicht nur nährt, sondern auch verpflichtet. Ein Geist, der jedem Bauernkind, vor allem aber dem erstgeborenen Sohn, ein massives Bündel von Verpflichtungen auf den Rücken bindet, das dann, wenn er das Talent zum „Bauer sein“ nicht im Blut hat, zur Bürde und zur unsäglichen Last wird und ihn zum Sklavendasein auf Lebenszeit verdammt oder zum Bruch mit seiner Familie oder eben zur Desertation, zur Flucht, auf der sich Hartmuth gerade befand.
Hartmuth beugt sich vor und vergräbt neuerlich sein Gesicht in den Schwielen seiner arbeitsamen Hände, die rau und hart auf die weiche Haut seines jugendlichen Gesichtes drücken. Unter den Fingernägeln hängen noch manche dunklen Reste vom Altöl der Mähmaschine, die er gestern noch repariert hat, und auch Stallgeruch, der Geruch des Bauernstolzes, hängt noch ein wenig an seinen Fingern. Ein Bauernstolz, der es nie ganz bis in sein Herz geschafft hat.
Ein Stolz und ein Geist, an dem allerdings ganz allgemein, landauf landab, seit einigen Jahrzehnten Nagewürmer nagen. Es gelten zwar Gesetze, denen zufolge der Hof-Stolz nicht geschlachtet und der geschlossene Hof nicht geteilt werden darf, aber die bewundernswerten Bauern, die ihre steilen Wiesen weiterhin abmähen, um letztlich ein wenig Milch aus den Eutern ihrer Kühe zu quetschen, können ökonomisch nicht mithalten mit den land- und viehwirtschaftlichen Großunternehmern und Monokulturbauern des fruchtbaren Flachlandes. Die Marktpreise sind viel zu niedrig, um ihren erheblichen Aufwand auf den kleinen, steilen Wiesen zu decken. Die Bauern der Alpenregionen müssen daher seit vielen Jahren bereits mit allen möglichen Subventionen gestützt werden, damit sie wirtschaftlich im globalen Konkurrenzwind nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Dies geschieht vor allem auch in Anerkennung ihrer so segensreichen Landschaftspflege, die besonders in Tourismusregionen gut ankommt.
„Kürzlich“, so ein bitter-ironischer Witz, „erlitt ein Tiroler Bauer beim Mähen auf seiner steilen Wiese einen Herzinfarkt und starb. Er fiel aber nicht um, so sehr war er gestützt.“ Ein gemeiner Witz, der das Jahrhunderte lange Anrecht der Bauern auf ihre Stellung als institutionelle Repräsentanten von Vernünftigkeit, Richtigkeit und Wahrheit verletzt, denn wenn man gestützt werden muss, um zu überleben, kann man nicht mehr stolz in die Welt rufen: „Seht her, so geht das Überleben als Mensch!“
Ja, es ist nicht zu leugnen: Das Anrecht der kleinen Bergbauern auf Stolz ist ins Wanken geraten, ihr Stolz wurde untergraben, sie sind teilweise zu Landschaftsgärtnern mutiert und halten die Spezies „Tiroler Bauernhof“ nur noch am Leben wie die Hüter eines Naturparks ihre geschützten Wildtiere und Pflanzen, ja, und die Touristen kommen in Scharen, um die schönen Wildtiere und Pflanzen zu bewundern. Aus den ehemals stolzen Bauernkindern wurden Naturparkhüter, Liftwarte, Schi- und Rodelverleiher, Schilehrer, Zimmervermieter, Gastwirte, Hoteliers und Liftbetreiber, die darum kämpfen, eine andere Art von Stolz, den man vielleicht als „pekuniären Stolz“ bezeichnen könnte, wieder aufzubauen.
Mit Schwermut im Herzen und in den Gedärmen schaut Hartmuth noch einmal hinauf zu den Bauernhöfen auf dem Angerberg, die an ihm vorbeiziehen wie riesige Theaterkulissen im Schauspiel des Lebens, im Schauspiel seines Lebens.
Die erwähnten Nagewürmer haben natürlich auch den Lahnerhof nicht verschont, auf dem Hartmuth aufgewachsen ist. Auch ihm wäre wohl eine Karriere als Liftwart im Winter oder etwas Ähnliches nicht erspart geblieben, wenn er den Lahnerhof übernommen hätte, denn die Milch- und Fleischpreise stagnierten seit Jahren und die Ertragslage war prekär geworden, trotz der Subventionen.
Mama und der Neophyt
Vor zwei Tagen am frühen Abend stand Hartmuth am Grab seiner Mutter mitten im großen Friedhof in Lanersbach, um sich Mut zu holen und Abschied zu nehmen. Das schlichte Grab war – so wie immer – gut gepflegt, wie auch die vielen schönen Gräber ringsherum. Ein edler Hof des Friedens, eine herzerwärmende Kultur, die sich dort offenbarte, eine Kultur des Gedenkens an liebe Verstorbene und des Erinnerns an unsere Zerbrechlichkeit, beleuchtet von zahlreichen melancholisch flackernden Kerzen und bewacht von kunstvoll geschmiedeten, strengen, eisernen Kreuzen. Ein Panorama liebevoller Gräberpflege, das wohl auch ein klein wenig davon zehrte, dass MAN es als angenehm empfand, wenn das Grab der eigenen Familie ein bisschen schöner war als das der Grab-Nachbarn.
Hartmuth hatte mit klammen Händen eine mitgebrachte rote Kerze angezündet und sie auf den Marmorsockel neben das kleine, weiße Schild hingestellt, auf der linken Seite neben dem Kreuz. Margarethe Egger, geboren am 6.5.1938, gestorben am 27.2.1976, stand darauf und daneben ein kleines Foto von ihr, von ihrem freundlichen Gesicht, das ihn immer liebevoll anlachte, ob er nun dort am Grab stand oder sonst irgendwo in der Welt. Hartmuth sah es an, dieses bezaubernde Foto, und seine Augen wurden feucht und jetzt, beim Erinnern dieser Szene im Zug der ÖBB sitzend, werden sie es wieder.
Mama war der Hafen seiner Geborgenheit gewesen. Welche seelischen Turbulenzen ihn auch immer quälten, in ihrer Nähe wurden sie milder und erträglicher. Er hätte die verrücktesten Dinge anstellen können, sie hätte zu ihm gehalten, sie hätte ihm geholfen, sie hatte ihn bedingungslos geliebt, davon war er überzeugt, das hatte er gefühlt.
Ja, sie ist viel zu früh gestorben, die Mama, Gebärmutterkrebs war es. Einen Monat vor ihrem Ableben wurde sie vor seinen entsetzten Augen auf eine Tragbahre gelegt und mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Gemeinsam mit dem Stiefvater hat er sie dann ein paar Mal im Krankenhaus besucht, das letzte Mal drei Tage vor ihrem Ableben. Von Sterben war da keine Rede, man sprach von: „Es wird schon wieder werden!“ oder „Kopf hoch Margarethe!“ oder man stellte Kalkulationen an, wann sie wieder nach Hause kommen würde oder sollte. Ja, dieses MAN, das wie eine Wolke von Verhaltensrichtlinien über den Häuptern der Menschen zu schweben pflegt und sagt, was man zu denken, was man zu fühlen und was man zu tun habe! Man will dem Tod offenbar nicht in die Augen schauen, man tut so, als beträfe er einen nicht, und man wird von der täglichen Erfahrung in diesem Verdrängungswahn sogar bestätigt, denn solange man selbst lebt, sterben tatsächlich immer nur die anderen.
Ihr Ableben war für Hartmuth eine seelische Katastrophe, es war, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen und er wäre in einen tiefen, dunklen Abgrund haltloser Ungeborgenheit gestürzt. Nur mühsam und langsam ist er aus diesem Abgrund wieder nach oben, ans Tageslicht gekrochen. Sepp, sein Stiefvater hat ihm geholfen dabei, holprig zwar, aber er hat geholfen, doch auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise wurde mit ihr, mit seiner Mama, auch sein Einverständnis, Bauer auf dem Lahnerhof zu werden, zu Grabe getragen, jedenfalls hat sich nach und nach diese Vorstellung, der Glaube an eine solche Zukunft, in seinem Kopf und in seinem Herzen verflüchtigt und in Schall und Rauch aufgelöst.
Mama war in ihren jungen Jahren Magd auf dem Hof eines großen Bauern in Finkenberg gewesen. Auf einem Kirchweihfest im Herbst 1957 hatte sie den feschen Biologiestudenten aus Heidelberg, den Hartmuth Oberlohr, getroffen und die beiden haben sich ineinander verliebt. Hartmuth war quasi auf Forschungsreise und stieg fast jeden Tag hinauf auf die Berge, um deren Flora und Fauna zu erkunden. Er war fasziniert von der Bergwelt, von ihrer wunderbaren Artenvielfalt und auch von der Art der Gretl, der jungen, hübschen Magd, die ihm mit Bewunderung zuhörte, wenn er so klug und voll Begeisterung von den Blumen der Alpen sprach und die immer mitzuhören glaubte, dass er auch sie damit meinte.
Kurz vor Weihnachten 1957 war sein Studienaufenthalt beendet und er kehrte zurück nach Heidelberg, nicht ohne mit Gretl vorher Adressen und Telefonnummern ausgetauscht zu haben, verbunden mit den innigen gegenseitigen Versprechen, sich zu schreiben und sich irgendwann einmal wieder zu sehen. Drei Wochen nach seiner Abreise stellte Gretl fest, dass sie schwanger war. Gretl hatte lange gehofft, dass sich Hartmuth melden würde, aber er hat es nicht getan, kein Anruf, kein Schreiben, nichts! In dieser Situation wäre es wohl an ihr gewesen, sich zu melden, sie hat es aber auch nicht getan und irgendwann, in einem dunklen Moment, in einem Anfall von Enttäuschung, hat sie den Zettel mit seiner Telefonnummer und seiner Adresse in den Ofen geworfen und ein paar Tränen hinterher.
Es sei gekränkter Stolz gewesen, antwortete sie und fügte hinzu: „Und außerdem hatte ich ja dich, mein Schatz!“, als Hartmuth sie vor ein paar Jahren nach den Gründen ihrer Verhaltensweise gefragt hatte. Als der kleine, uneheliche Hartmuth in der Pfarrkirche in Finkenberg unter dem Stirnrunzeln des gestrengen Herrn Pfarrers getauft wurde, da hatte Gretl tief in ihrem Herzen immer noch warme Gefühle für den treulosen, aber charmanten Vater ihres Kindes und auch ein wenig Trotz mag mitgespielt haben, als sie sich entschloss, ihrem kleinen Schatz den Vornamen seines Vaters zu geben.
Ja, Hartmuth war Gretls Schatz. Ein Schatz allerdings, in den sich in späteren Jahren zunehmend auch ein Hauch von Wehmut mischte, denn er wurde mit den Jahren seinem leiblichen Vater immer ähnlicher und das hätte er besser nicht tun sollen, denn das erinnerte Gretl immer wieder an ihre so seltsam geglückte und verunglückte Beziehung zu seinem Vater, dem so geistreichen und feschen Biologiestudenten und dies erinnerte auch den Dorftratsch immer wieder an ihre Jugendsünde. Ja, ihr Söhnchen, der Hartmuth war ein niedliches Kerlchen mit schwarzen Haaren, dunklen hübschen Augen, weichen Gesichtszügen und schmaler Figur, ein bisschen zu weich vielleicht und ein wenig zu schmal vielleicht für die Gegend. Trotzdem blieb Hartmuth Mamas Schatz bis hin zu ihrem letzten Atemzug. Man könnte sagen, die Meinungen in der Gegend über Hartmuth waren geteilt, für Gretl war er ein Schatz, für fast alle anderen war er eine Schande, ein lediges Kind eines Dahergelaufenen.
Gretl aber war stark und sie hat schließlich den um einige Jahre älteren Egger Sepp, vulgo „Lahner Sepp“, kennen und lieben gelernt, sie haben geheiratet und Gretl ist mit Hartmuth nach Hinteraching auf den Lahnerhof gezogen. Er war damals gerade vier Jahre alt und er hat dann bald, auf Drängen seiner Mama und mit freundlicher Zustimmung des Stiefvaters, dessen Familiennamen „Egger“ angenommen, um dem Gerücht um seinen „niederen Stand“ ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen. 1968 kam dann die Hildegard, seine Halbschwester, zur Welt.
Hartmuth steht in dem vor sich hin wackelnden Zug der ÖBB auf und öffnet seinen schäbigen Koffer, vollgestopft mit zerknüllten Klamotten und vielen Büchern, Heften und Mappen, alle abgenutzt und voll beschrieben und bekritzelt. Er blättert in einer Mappe mit der Aufschrift „Landwirtschaftliche Fachschule“ und zieht schließlich ein Blatt mit seinen handschriftlichen Notizen von einer Unterrichtsstunde und seinen bezüglichen Kommentaren heraus und liest:
„Neuerdings werden unsere Wälder, Wiesen und Almen von Neophyten heimgesucht, das sind fremde Pflanzenarten, die aus aller Welt von irgendwelchen ahnungslosen Pflanzenspinnern eingeführt wurden oder deren Samen durch den Wind in unsere Gegend getragen oder mit dem Gepäck von Touristen eingeschleppt wurden und hier mit ihrer fremden Kultur und Art den einheimischen Pflanzen Probleme bereiten, wie z. B. der Staudenknöterich, der kaum auszurotten ist, oder das Drüsen-Springkraut. In Tirol wird in Kürze jedenfalls eine ‚Flurbereinigungsaktion‘ gestartet, um dem Pflanzen-Migranten-Unwesen Herr zu werden und die Fremdlinge großflächig zu vernichten. Begonnen wird im Zillertal, wo der Ausländeranteil bekanntlich besonders groß ist.“
Darunter ist noch mit Bleistift seine Anmerkung hinzugefügt:
„Die Rechtsgrundlage für diese Säuberungsaktion ist mir nicht bekannt, es muss aber wohl so etwas ähnliches wie das deutsche ‚Blutschutzgesetz‘ sein (das ‚Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre‘ – erlassen zu Nürnberg und in Kraft getreten am 15.9.1935 – zum Zwecke der Reinhaltung der Rasse der Arier). Ich vermute, dass auch hier ‚Vergasen‘ und ‚Verbrennen‘ im Pogrom … äh … Programm steht, mit dem Endziel der Ausrottung.“
Damals, 1973, als er dies voll Ironie schrieb, da hatte das alles für ihn noch keinen Bezug auf sein eigenes Leben. Aber jetzt – im Auszug-Zug der ÖBB sitzend – war der metaphorische Bezug auf sein Leben nicht mehr zu übersehen. Ja, er, Hartmuth Egger, war ein Neophyt, im Jahr 1957 aus Heidelberg eingeschleppt in die Zillertaler Alpen von einem Pflanzenspinner namens Hartmuth! Er war ein Neophyt, der dem Gesetz entsprechend jetzt wieder dorthin zurück zu kehren hatte, wo er hergekommen war.
Mutation
Hartmuth ging in Lanersbach mühsam zur Schule. Mühsam, weil der Schulweg weit war und weil sich herausstellte, dass Deutsch eine Fremdsprache war.
Beispielsweise hieß das gewohnte und so flüssig-elegante „i hu“ auf deutsch „ich habe“, wobei das preußische „ch“ im „ich“ noch dazu im Hals kratzte und Husten machte, aus „dü hosche“ wurde „du hast“, aus „ea hoot“ wurde „er hat“ und so ging das weiter bis zum schwindlig werden. Herr Lehrer Geisler meinte, man solle dieses „Hochdeutsch“, wie er es nannte, fest üben und dann sprach er gleich wieder im üblichen, flüssig-eleganten Tuxer Dialekt weiter, so wie immer. Hartmuth meinte zuerst, der Herr Lehrer habe da etwas verwechselt, weil eigentlich ihre Sprache dort oben auf den hohen Bergen „Hochdeutsch“ heißen müsste und die Fremdsprache der Flachländer müsste dann wohl „Niederdeutsch“ heißen, aber es war eben nicht alles logisch in der Welt.
Mühsam war die Schule für Hartmuth aber vor allem auch deshalb, weil er von einigen seiner Schulkameraden immer wieder herabgemacht wurde und sich dies mit den Jahren quasi als „Brauch“ etabliert hatte. In den meisten Köpfen der Menschen dort in dieser Gegend war er angesichts seiner „niedrigen Geburt“ etwas Minderwertigeres, womit sie, die urteilenden Köpfe, ja etwas Hochwertigeres wurden. In den Stuben mancher Familien, beim Mittagstisch oder wo auch immer, flossen diese Vorurteile – geheim verschlüsselt in abfälligen Bemerkungen über ihn und seine Mama – aus den Mündern der Eltern in die Köpfe ihrer Kleinen und diese trugen sie dann in die Schule und warfen sie dem Hartmuth an den Kopf oder stachen ihm damit ins Herz. Aber es waren nicht alle so, nicht alle waren in dieser Klatschmaul-Dorfmoral gefangen, besonders Karli, sein bester Freund hielt ihm immer wieder die Stange, auch bei gelegentlichen kleinen Schlägereien, die allerdings meist unrühmlich endeten.
Karli war der Sohn eines Knechts, der einen schlechten Ruf hatte, weil er angeblich zu viel trank, und auch Karli wurde insoweit ein wenig „geknechtet“ und so bildeten sie also eine Schicksalsgemeinschaft, die auch dadurch gefördert wurde, dass sie einen Teil des Schulweges teilten, denn Karli wohnte ebenso in Hinteraching, nur etwa einen halben Kilometer unterhalb vom Lahnerhof. Über all die gemeinsamen Schuljahre hinweg trabten sie also nebeneinander dahin, mit dem Schulranzen auf dem Rücken, durch den steilen Wald hinunter und dann nach der Schule wieder hinauf und sie plauderten, diskutierten, lachten, jammerten, erzählten und wunderten sich über die Welt und kamen sich näher.
Einmal – im dunklen Wald – erzählte Karli mit geheimnisvoller Miene eine Geschichte die sein Vater ihm am Vorabend erzählt hatte, die Geschichte von den Wölfen. „Weißt du, Harti“, sagte er mit wichtiger Mine, „früher gab es hier viele, viele Wölfe, ganze Rudel gab es, die den Gämsen, Rehen und Hirschen nachjagten und viele auffraßen. Dann aber kamen die Menschen und die Menschen hatten Angst vor den Wölfen und Angst um ihr Vieh und so wurden die Wölfe bekämpft und schließlich ausgerottet. Der größte Fressfeind der Gämsen, Rehe und Hirsche war damit verschwunden und auf einmal gab es unzählige Gämsen, Rehe und Hirschen und immer noch mehr und noch mehr … und sie fraßen alles kahl, sie fraßen vor allem auch die Sprösslinge der Bäume und zerstörten ihre Lebensräume. Bald begannen Wälder und Wiesen zu verkümmern und zu verdorren. Da nahmen die Menschen wieder ihre Gewehre in die Hand und töteten viele Gämsen, Rehe und Hirschen und der Wald atmete wieder auf. Ja, man sieht also: Die angeblich bösen Wölfe waren in Wirklichkeit die Beschützer des Waldes und die Jäger sind also ihre zweibeinigen Nachfahren!“
Beide überkam ein schauriges Kichern. Hartmuth wusste nicht, was er von der Geschichte halten sollte, die Jäger waren ihm jedenfalls irgendwie suspekt.
Mit dem Herrn Lehrer Geisler aber verstand Hartmuth sich gut, manchmal wurde er sogar gelobt, was nachher aber oft wieder zu Reibereien mit „Nichtgelobten“ führte, weshalb er eigentlich auch gar nicht gelobt werden wollte. Oft hielt er sich in der Klasse zurück, um nicht zu zeigen, dass er schon längst begriffen hatte, was die meisten anderen noch nicht kapiert hatten. Er wollte dazugehören, aber es gelang nicht so recht.
Das Schönste an der Schule war für Hartmuth aber die Schul- und Dorfbibliothek, jedenfalls ab dem Zeitpunkt, an dem er die Oberstufe der Volksschule besuchte. Immer wieder versank er dort in irgendwelchen Büchern, die er nicht verstand, aber verstehen wollte und manchmal durfte er auch das eine oder andere Buch mit nach Hause nehmen, nachdem Herr Lehrer Geisler ihm das Versprechen abgerungen hatte, fest auf das Buch aufzupassen und es nach einer Woche wieder zurückzubringen.
Eines der ersten Bücher, das ihn begeisterte, war „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Nach einigem Betteln hatte Lehrer Geisler ihm erlaubt, es länger zu behalten. Ein paar Mal saßen sie im Wald, er und Karli, und Hartmuth las ihm daraus vor, vor allem die Passage mit dem Fuchs, der vom kleinen Prinzen gezähmt werden wollte, gefiel ihnen.
„Was bedeutet zähmen? fragte der kleine Prinz. Das ist leider in Vergessenheit geraten, sagte der Fuchs, es bedeutet sich vertraut zu machen … Ja, für mich bist du bisher nur ein kleiner Junge wie hunderttausend andere kleine Jungs, ich brauche dich nicht, und auch ich bin für dich nur ein Fuchs wie hunderttausend andere Füchse. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig auf der Welt sein und wenn ich weiß, dass du mich zu einem bestimmten Zeitpunkt besuchst, dann beginne ich schon Stunden vorher mich darauf zu freuen. Und auch ich werde für dich einzigartig auf der Welt sein und auch du wirst dich schon Stunden vorher freuen auf meinen Besuch …“
Ja, der weise kleine Fuchs, der gezähmt werden wollte, hatte es ihnen angetan, vielleicht auch deshalb, weil auch sie in ihrer kindlichen Freundschaft insoweit ein wenig „Zähmung“ erlebten. Und dann war da noch die Geschichte mit der ein klein wenig affektierten Rose, in die der kleine Prinz sich unsterblich verliebt hatte. Hartmuth konnte damals natürlich noch nicht wissen, dass er sich, viele Jahre später, auch in eine ein klein wenig affektierte Rose verlieben würde. Ja, aber davon später.
So wie allen Bauernkindern dort wurde auch dem Hartmuth früh beigebracht, was es heißt, zu arbeiten und Aufgaben zu übernehmen, und ihm gefiel dies, besonders wenn ihm gelang, was ihm aufgetragen wurde, denn dann kam er sich wichtig und groß vor. Hauptsächlich ging es ihm dabei darum, dem Stiefvater zu beweisen, dass er zu etwas taugt, und die Mama hat immer aufgepasst, dass ihr Schatz nicht überfordert wird. Den Sommer verbrachte er ab seinem zehnten Lebensjahr stets auf der Alm, zuerst als Hüterbub und dann auch als Melker.
Die Lahner-Alm, quasi die Sommerresidenz ihrer Kühe, Kälber und Schafe, lag weit oben in den Bergen in einem kleinen, verlassenen und wildromantischen Hochtalkessel, an dessen östlichem Rand steile Felswände aufstiegen. Er liebte es, dort oben zu sein, er genoss es, sich dort in das herrliche Alpenpanorama hineinsinken zu lassen wie in einen weichen, von Latschen, Almrosen, duftendem Moos und den Bergen, Sternen und Tagträumen gewebten Lehnstuhl. Er liebte es, den Kühen beim Grasen zuzusehen und den Almrosen beim Wachsen, er genoss es, die Gedanken in die klare Bergluft steigen zu lassen, Luftschlösser zu bauen und zu lesen, wann und wo immer es möglich war, ohne seine Pflichten zu verletzen.
Ja, immer hatte er Bücher dabei und Hefte, in die er ihm wichtig erscheinende Gedanken schrieb. Manchmal, besonders bei Neumond und klarem Himmel, schlich er in der Nacht hinaus aus der Almhütte, hinaus aus der Schlafkammer, in der sein Stiefvater schnarchte, legte sich oben am kleinen Hügel zwischen den beiden großen Steinen flach auf die weichen, duftenden Moospolster und blickte fasziniert hinauf zum Sternenhimmel, der, von dieser Alm aus gesehen – durch diese so klare Luft des Hochtales betrachtet – in einem Glanz und in einer Fülle erstrahlte, wie er es sonst nie und nirgends erlebt hatte. Die Milch der Milchstraße war zum Greifen und zum Trinken nahe – seine „Alm-Milch“, wie er sie manchmal in seinen Tagträumen nannte.
Wohltuende, schöne Erinnerungen sind das und gleichzeitig schmerzliche. Der Zug hat Wörgl bald erreicht. Fabrikhallen, Autohäuser, Werkstätten, Einkaufszentren und deren leuchtende Reklamen ziehen an Hartmuth vorbei – gefärbt von seinem melancholischen Blick und überlagert und in den Hintergrund geschoben von ganz anderen Gedanken. Hartmuth steht auf, öffnet erneut seinen Koffer und zieht ein schmutziges, vollgekritzeltes Heft heraus, auf dem steht: „Alm-Sommer 1973“. Er setzt sich wieder ans Fenster, blättert im Heft und liest:
„Die Milch der Milchstraße soll angeblich aus 100 Milliarden Sternen bestehen, wenn sie sich nicht verzählt haben, die Zählmeister an den Fernrohren. Auch das Hirn des Menschen soll angeblich aus 100 Milliarden Neuronen bestehen, wenn sie sich nicht verzählt haben, die Neurologen an den Mikroskopen. Mein Hirn ist also eine kleine Kopie der großen Milchstraße, die eigentlich schon im Bauch meiner Mama angefertigt wurde in nur 9 Monaten! Oder vielleicht nur in 8 Monaten? Der liebe Gott wird ja nicht gleich beim Schwierigsten anfangen – ja, und etwas Schwieriges ist das schon mein Hirn … oder etwa nicht? – und wenn man bedenkt, dass bei der Geburt das Gehirn angeblich nur ein Viertel so groß ist wie das Gehirn eines Erwachsenen, dann …“ Ja, dann ist im Heft ein langes Gekritzel von Zahlen und Durchstreichungen zu sehen und dann steht dort weiter:
„Das sind 1.205 Neuronen in jeder Sekunde! In jeder Sekunde ihrer letzten 240 Tage der Schwangerschaft, egal ob Mama gerade Nase gebohrt oder mit einer Nachbarin gequatscht oder geschlafen hat, sind in meinem Kopf 1.205 Neuronen aus dem Nichts – oder aus was? – herausgequollen! Eine Explosion des Lebens! Von der Explosion der Zellen aller anderen Organe meines Körpers und den ihnen mitgegebenen wundersamen Informationen und Programmen ganz zu schweigen! Ich bin ein Wunder, meine Mama ist ein Wunder und wir haben es beide gar nicht bemerkt, wir Dumpfbacken!“
Hartmuth schmunzelt, ja, seine Mama, diese wunderbare Frau. Was sie wohl sagen würde zu seiner feigen Flucht, auf der er sich befand, zu seinem mutigen Abenteuer, zu seinem spätpubertären, blödsinnigen Aufstand, zu seiner selbstbewussten Selbstfindungs-Aktion, zu seiner … was auch immer …? Irgendwie würde sie ihn verstehen und ihn in Schutz nehmen, davon ist er überzeugt … ja, aber würde sie noch leben, dann säße er wohl gar nicht in diesem Zug.
Hartmuth blättert weiter in seinem „Alm-Sommer 1973-Heft“. Da steht ein Alm-Gedicht von ihm, das er damals, als sein Herz noch voll Übermut und luftiger Alm-Leichtigkeit war, geschrieben hatte:
Almidylle
Ein Rindviech auf der Almwies’ stand,
am Fuß der hohen Felsenwand.
Es fraß ganz friedlich vor sich hin,
nichts „geistig Hohes“ hatte es im Sinn ,
lies öfters fallen große Haufen,
um dann zu schauen, wie drauf die Fliegen raufen.
Ein Hochgefühl dann als es merkte,
dass es der Senner Maxl melkte.
Doch da!
Ein Stein flog von der Felsenwand, oh weh,
und grad dem Rindviech auf den Zeh.
Das Rindviech schaut lang blöd erschrocken,
und fing dann an, ganz wild zu bocken.
Verwirrt meint es, es sei ein Gaul,
schlägt aus und trifft den Max ins Maul.
Der arme Max, oh weh, oh Graus,
spuckt alle seine Zähne aus.
Da lagen sie, die Zähne nun
und beide schauten ähnlich dumm.
Das Viech hat bald die Sach’ vergessen,
hat friedlich-glücklich weitergfressen,
der Maxl aber, oh mei, oh mei,
aß künftig nur noch Haferbrei.
Ja, damals, als er all das schrieb, war die Welt in seinem Kopf noch einigermaßen in Ordnung. Mit seinem Stiefvater, dem Sepp Egger, den er einfach „Vater“ nannte, kam er noch gut aus damals, ja, er bewunderte ihn oft. Er war ein tüchtiger Mensch, der immer wusste, was wie gemacht werden muss, was richtig und falsch ist und der nie Zweifel aufkommen ließ, wo es lang ging. Er war ein Mensch, der sein Leben dem Hof und dem großen Bündel der Verpflichtungen gewidmet hatte, deren Erfüllung zur Erhaltung des Hofes und der Familie notwendig waren. Urlaub oder freie Tage kannte er nicht. Er hatte eine harte Schale, die keinen Widerspruch zu dulden schien. Eine harte Schale, die ihm die rauen Verhältnisse dieser Gegend wohl antrainiert hatten. Hartmuth wusste aber, dass sich dahinter ein weiches Herz befand, aber meist war es unmöglich, bis dahin durchzukommen.
Er wurde vom Vater oft missbilligend angeschaut, wenn er ihn beim Lesen ertappte, das war üblicherweise ein strenger Blick, verbunden mit einem „Augenroller“, der deutlich sagte: „Mein Gott, sitz doch nicht so faul herum!“ Aber irgendwie hat er dann doch diese „Lese-Flausen“ von seinem „Hartl“, wie er ihn nannte, toleriert.
Einmal, vor einem Jahr etwa, fragte Hartmuth seinen Vater, ob er denn nie über philosophische Probleme, über den Sinn des Lebens und dergleichen nachgedacht habe. Darauf meinte dieser: „Ach, weißt du, Hartl, ich steh früh auf, arbeite den ganzen Tag, erledige meine Aufgaben und lege mich abends müde und zufrieden ins Bett, das kann nicht verkehrt sein!“ Ja, und irgendwie hat diese Philosophie der Einfachheit funktioniert beim Vater, er schien relativ ausgeglichen zu sein, Zeichen von Depression waren von außen nie zu sehen bei ihm, nur manchmal Zeichen von körperlicher Erschöpfung.
Vieles von dem, was auf dem Hof geschah, bereitete Hartmuth seelische Schmerzen. Wenn Vater einem Huhn den Kopf abhackte, dann zuckte er zusammen und drehte sich weg, um seine nassen Augen vor dem Vater zu verbergen. Wenn ein Schwein, ein Schaf oder ein Kalb geschlachtet wurde, dann wollte er nicht dabei sein. Bald aber wurde er angewiesen, bei diesen Massakern mitzuhelfen, was ihn arg bedrückte und Mitleid, Widerwillen und Ekel in ihm aufsteigen ließ. Aber er hat sich zusammengerissen und ließ sich möglichst nichts anmerken, er wollte eben ein Mann sein. Anstatt einen Baum zu fällen, hätte er ihn lieber umarmt und in ihn hineingehorcht. Als er einmal bei solchen Holzfällerarbeiten helfen musste und Vater sein trauriges Zögern sah und spürte, fuhr er ihn an: „Ja, wie willst du denn den Winter überleben, ohne Holz zum Hausbauen und ohne Holz zum Heizen!?“
Ja, er hatte die Überlebenslogik auf seiner Seite, der Vater, wie immer. Hartmuth hat wieder die Zähne zusammengebissen und sich an seinem Vater orientiert. Dies ging so, bis er etwa 15 oder 16 Jahre alt war, dann aber zogen dunkle Wolken auf.
Selbstfindungsprozess oder Persönlichkeitsentfaltung nennt sich jener geistig-seelische Mutationsvorgang, bei welchem Pubertierende daran gehen, sich selbst zu erfinden und zu definieren und ihr Ego – diese seltsame mentale Konstruktion von sich selbst – auszubilden und zu einem Selbstportrait zu verdichten. Sich selbst zu definieren, heißt für einen werdenden jungen Mann vor allem, sich abzugrenzen, also die Unterschiede zwischen sich und den anderen auszumachen und zu betonen und anders sein zu wollen. Es liegt nahe, diesen Prozess der Abgrenzungen, also mit diesem „Anders sein wollen“, gegenüber den Eltern zu beginnen, den bisherigen hauptsächlichen Repräsentanten der Welt. Im Falle von Hartmuth vor allem mit dem „Anders sein wollen“ gegenüber seinem Vater, der ja bislang in seinen Augen der Maßstab für die Welt war. Ja, und Unterschiede fand er dabei jede Menge und das „Anders sein wollen“ fiel ihm da nicht schwer und entsprechend bockig wurde er.
Mama war die gute Seele, welche die aufkeimenden Differenzen immer wieder geglättet hat und auch in Hartmuth die Vorstellung aufrecht und warm erhalten hat, dass er einmal den Hof übernehmen werde. Aber mit ihrem tragischen und viel zu frühen Ableben verlor Hartmuth nicht nur seine geliebte Mama, sondern fortschreitend auch das Gefühl der Verbundenheit mit dem Hof und das Verhältnis zum Vater wurde kühl und manchmal frostig wie der Winter in den Tiroler Bergen.
Religio
Ja, mit dem viel zu frühen Ableben von Mama hatte es begonnen, enger und kühler zu werden in ihm und um ihn.
Der Zug rattert geschäftig und zielbewusst seines Weges. Hartmuth, voll Melancholie, blickt hinaus in das Inntal, in das Land der schönen Täler und Berge, dem er nun den Rücken zuzukehren sich vorgenommen hat. Wohin er seinen düster verschleierten Blick auch wendet, überall, auf jedem geistig geknipsten Foto, inmitten eines jeden Dörfleins, sind auch katholische Kirchen zu sehen, die ihre spitzen Türme keck und fordernd in den blauen Himmel recken.
„Ja, man darf nicht vergessen“, geht es durch seinen Querkopf, „im Tiroler Heldenzeitalter, so um das Jahr 1809 herum, war das Land Tirol vom deftigen Lokalpartiotismus ja sogar heilig gesprochen worden und seither erstrahlt über dem ‚Heiligen Land Tirol‘ ein verbaler Heiligenschein!“