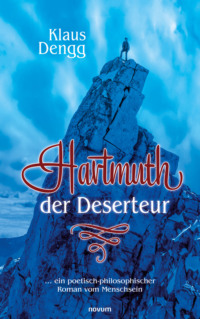Kitabı oku: «Hartmuth der Deserteur», sayfa 3
In Hartmuths Augen aber war der Heiligenschein – sofern er je wirklich „geschienen“ haben sollte – schon vor langer Zeit zum Schein von Scheinheiligen mutiert. Sein Stiefvater jedenfalls schien trotz all dieser kecken Forderungen und Heiligsprechungen bloß ein Sonntagskatholik zu sein, der den örtlichen Gepflogenheiten entsprechend an jedem Sonntag um 8 Uhr mit gefalteten Händen in der Kirche in Lanersbach saß und also das tat, was alle taten, um nachher im Gasthof Kirchenwirt ein Bier zu trinken und mit Kollegen lauthals die Lage der Nation zu erörtern, einer Nation, die meist nur bis zum nächsten Kirchturm reichte. Auch bei Mama, die sich wohl mit der Zeit ihrem Sepp angepasst hatte, war es ähnlich, nur dass sie die Frühabendmesse ohne Kirchenwirt besuchte und dass sie ihn, ihren Schatz – spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem er bis Drei zählen konnte – mitgenommen hat in die Kirche.
Anders als in manchen benachbarten Häusern war bei ihnen zu Hause Religion so gut wie kein Gesprächsthema. Vor dem Essen wurde nicht gebetet und auch die „Gute Nacht“ hat Mama – als er noch klein war – an seinem Bett sitzend ohne Gebet liebevoll gewünscht. Es hing zwar ein Kruzifix in der Ecke oberhalb vom Stubentisch, meist geschmückt mit grünen Buchsbaumzweigen, aber mit dem wurde nicht geredet auf dem Lahnerhof, jedenfalls nicht hörbar.
Im Stillen aber hat Hartmuth sich seit seiner frühen Kindheit interessiert für ihn, für Gott, angestachelt durch sein Interesse an seiner persönlichen, höheren Bestimmung und ermutigt durch die erhebende Vorstellung und Überzeugung, dass da oben jemand sitzt, der sich für ihn interessiert und ihn beschützt. Und so hat er sich in seinen kindlich-jugendlichen Phantasien Bilder von ihm, seinem Gott, entworfen und wieder verworfen, bis es – sein Gottesbild – letztlich sein Gesicht verlor und Gesichter überstieg. Er hat mit ihm gesprochen, viele Male, in Demut und mit großem Respekt, und ihm seine kindlichen Wünsche vorgetragen und ihm sein Schicksal anvertraut, ihm, dem Schöpfer, von dem er fühlte, dass es ihn geben musste, weil er seiner bedurfte.
Bald war er nicht mehr der, von dem der Pfarrer oder der Kooperator sprach, nie war er ein donnernder Gott oder ein strafender. Die Geschichten, die der Herr Kooperator von ihm erzählte, haben ihn stets irritiert, genauso wie der Herr Kooperator selbst ihn irritierte, zumal er damals, in der Schule in Lanerbach, Angst vor ihm hatte. Angst vor seiner überlauten Stimme und seinem dominanten Gehabe, besonders seit er mitansehen musste, wie er den Karli, seinen Freund, der bei der Schülermesse in der ersten Reihe in der Kirche sitzend gekichert hatte – die Messe hatte noch gar nicht begonnen – laut scheltend, auf demütigendste Art und Weise an einem Haarbüschel von der vordersten Kirchenbank zur Kirchentüre hinauszerrte. Hartmuth hat dem Herrn Kooperator seine Geschichten bald nicht mehr geglaubt, er hat bald seine Ohren verschlossen und innerlich an seinem eigenen Gott gebastelt. Was immer vorgetragen worden sein mag, es hat ihn nicht berührt und es hat zu keinen prägenden Eindrücken, nur zu einigen blassen Erinnerungen gereicht und zu einer kleinen Sammlung von Heiligenbildchen, die er dann bald wieder verloren hatte.
„Es war wohl damals in seiner Schule und in der Kirche schon das gleiche hohle Gerede von biblischen Dogmen, welches seit so langer Zeit schon durch die Kirchen hallt, vorbei an den wirklichen seelischen Bedürfnissen der Menschen, ein Gerede, das kaum noch wirklich inhaltlich aufgenommen wird von all den armen Büßern in den Bänken mit den gefalteten, sündigen Händen und dem starren Blick“, geht es Hartmuth durch den Kopf. Ja, und so kam es, dass „man“ es nie so recht geschafft hatte, ihn, den durch die Taufe im Säuglignsalter zwangsrekrutierten Katholiken, „katholisch“ im biblisch dogmatischen Sinne zu machen.
Dennoch, Kirchen übten eine unreflektierte Faszination auf ihn aus, stets ergriff ihn eine diffuse Erhabenheit, die sich schon bei deren Betreten einstellte und die des Aufrufes „Erhebet die Herzen“ nicht bedurfte. Dies galt besonders für die altehrwürdige Pfarrkirche St. Wolfgang in Jenbach, in der er manchmal war, als er die Landwirtschaftliche Lehranstalt in Rotholz besuchte. Stets empfand er Kirchen als Räume der Besinnung, als Räume der Gemeinschaft, als Räume des Weihrauchs und vor allem als Räume der Musik, manchmal herrlicher, bewegender Musik – in Jenbach oft als Räume dröhnender, aufwühlender Orgelmusik oder als Räume des harmonischen Zusammenspiels menschlicher Organe im Geist der Chöre, die dort sangen. Eine Erhabenheit des Raumes, der Ohren und der geschlossenen Augen. Stets hat das Öffnen der Augen ihn gestört und Metastasen der Skepsis und der Unruhe in seinen Raum der Besinnung wachsen lassen, beim Blick auf manch seltsame Äußerlichkeiten, beim Blick auf den Pomp mit den vergoldeten Putten und Schnörkeln, beim Blick auf die bedrohlichen, riesigen Gemälde von Heiligen mit Schwertern, beim Blick auf den Messner, der mit dem Klingelbeutel durch die Reihen ging und wie ein Automat monoton alle 3 Sekunden „Gott vergelt`s“ sagte, und auch beim Blick auf das gleichzeitige Aufstehen, Hinsetzen und Knien im liturgischen Verlauf der Messen, dessen Logik er nie begriffen hatte, weshalb er stets – auf die Seite schielend – das getan hat, was alle taten.
Ja, das zu tun, was alle tun, und das nachzubeten, was vorgebetet wird, das war so etwas wie der Leitgedanke seiner jungendlichen, von außen an ihn herangetragenen, religiösen Erziehung. Aber dies ist in gewisser Weise wohl überhaupt die zentrale Parole für die Erziehung eines Sozialwesens. Wer sich daran hält, wird belohnt, egal, was er nachbetet, denn wer fühlt es nicht, das Wohlbehagen, das „Dabeisein und Dazugehören“ vermittelt, das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in einer Gruppe, in einer Kultusgemeinde, das Prickeln, welches das „Gebetegemurmel“ aus hunderten Kehlen manchmal verursacht, oder das Dazugehören zu einer Mannschaft oder Frauenschaft.
Dieses vorgenannte, von Hartmuth oft empfundene Wohlbehagen und vor allem die von ihm oft erfühlte Erhabenheit des Kirchenraumes waren wohl Ausdruck seiner ihm noch weitgehend unbewussten und unreflektierten, tiefen Sehnsucht nach Rückbindung, nach „Religio“. Ausdruck seines Bedürfnisses nach innerem Halt und Geborgenheit, Ausdruck der Sehnsucht seiner in die Individualität geworfenen Seele nach seliger Kommunion mit dem All-Einen.
Hartmuth glaubte mit ganzem Herzen an den so wunderbaren Kern der christlichen Religion, der im Gebot Jesu „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ so schön zum Ausdruck kommt. Doch die Umsetzung dieses Gebotes bereitete offenbar nicht nur der „Institution Kirche“, sondern auch ihm persönlich erhebliche Schwierigkeiten, denn das Muster für die Nächstenliebe war diesem Gebot zufolge die Selbstliebe, aber nicht die egoistische Selbstliebe, sondern die Anerkenneung seiner selbst als Schöpfung Gottes, als Wesen Gottes, sie war der Ausgangspunkt der Orientierung und die Quelle der Liebeskraft. Doch Hartmuth anerkannte sich nicht wirklich als Wesen Gottes, er glaubte, er war überzeugt, da sei zu viel „zu schräg“ an ihm und in ihm, er anerkannte sich selbst nicht wirklich, jedenfalls nicht so, wie er derzeit war und nicht das, was er derzeit tat.
Er wollte ein anderer werden, deshalb saß er ja in diesem Auszug-Zug der ÖBB. Ein Zug, der ihn zur Selbstliebe bringen sollte?
Rosi
Ja, in gewisser Weise sollte der Zug ihn zur Selbstliebe bringen. Er wollte „jemand“ werden und beim Gedanken an diesen nebulosen „Zukunfts-Jemand“ konnte er sich einen selbstironischen Wackler mit dem Kopf nicht verkneifen.
Der Zug rastet kurz in Wörgl. Hartmuth hört lautes Pfeifen, dann Menschengeplapper und Türengeklapper und schließlich setzt sich der Eisenkoloss wieder langsam und quietschend in Bewegung. Auf der gegenüberliegenden Seite des Waggons liegen drei Fenster in einigem Abstand voneinander. Die Landschaften beginnen wieder an diesen Fenstern vorbei zu ziehen, Straßen, Autos, Dörfer mit ihren Kirchen, Gärten, Wiesen und Wälder.
Hartmuth nimmt sich vor, zumindest kurz – quasi zur Erholung – seine Gedanken auf die Seite zu schieben. Er horcht kurz auf sein Herz, horcht auf seinen Atem, fühlt seinen Körper und im nächsten Moment – allen guten Vorsätzen zum Trotz – verliert sich sein aufgewühlter Geist schon wieder in Gedankenspielen.
„Jedes Fenster, auf der gegenüberliegenden Seite des Waggons, ist ein TV-Bildschirm, der vorderste Bildschirm gewährt mir einen Blick in die Zukunft, der mir gegenüberliegende Bildschirm zeigt die Gegenwart und der hinterste die Vergangenheit. Eine Zeitdemonstration! Die Zeit fließt also von links nach rechts oder von vorne nach hinten und alles geht vorüber im Strom unserer Bewegung und im Strom unserer Zeit. Wären dort größere Fenster, so könnte ich weiter in die Zukunft und weiter in die Vergangenheit schauen, oder wäre die ganze gegenüberliegende Waggonwand ein einziges großes Fenster, so wäre die Gegenwart länger. Hätte ich ein Bewusstsein, das auch das der Fahrgäste im Waggon vor mir und hinter mir umfasste und könnte ich auch mit ihren Augen sehen, so könnte ich noch weiter in die Zukunft und noch weiter in die Vergangenheit blicken, und hätte ich ein Bewusstsein, so groß, dass ich alles im Norden und alles im Süden und alles in allen Himmelsrichtungen im ganzen Universum einsehen und wahrnehmen könnte, so hätte die Zeit endgültig aufgehört, mich zu nerven, sie wäre endlich zum Stillstand gekommen und alles wäre jetzt, und ich wäre der Liebe Gott! Ja, wenn … wenn …! Zeit erweist sich also als jener geistige Defekt, der auftritt, wenn ein Blick zu kurz bzw. ein Bewusstsein zu klein ist! Ihr Wesen als Mangelerscheinung, ihr Wesen als Wahnvorstellung, die auftritt, wenn dem Geist Größe mangelt, wäre somit enttarnt!“
Er lächelt, der Rosi hätten diese verschrobenen Gedankengänge gefallen, auch wenn sie, die liebenswerte Schlaumeierin, sicherlich sofort eingewendet hätte, dass da wohl irgendetwas nicht stimmen könne.
Sie hatten sich im Zug kennen gelernt. Ja, komisch, irgendwie schienen Züge in seinem Leben schicksalshaft zu sein. Er besuchte damals die Landwirtschaftliche Fachschule in Rotholz, allerdings nur ein Jahr lang, quasi um damit das obligatorische 9. Grundschuljahr abzudienen, und Rosi besuchte das Realgymnasium in Schwaz. Beide fuhren also immer wieder zusammen mit der schmalspurigen Zillertalbahn. Rosi wohnte in Aschau und stieg dort ein und aus und er fuhr weiter hinein ins Tal nach Mayrhofen, um dann mit dem Bus noch weiter hineinzufahren nach Hinteraching oder „Hinterarsching“, wie er zu sagen pflegte, wenn er bei schlechter Laune war und kein Hinterachinger zuhörte.
Als sie ihm ihren Namen nannte, machte er ein hocherfreutes Gesicht und sagte: „Ich liebe Rosen“ und damit hatte er schon „einen großen Stein im Brett“ bei ihr. Als er aber beim nächsten Zusammentreffen ihr begeistert von Rilke erzählte, ein zerknittertes Heft aus seiner Schultasche zog und ihr vorlas: „Rose, oh reiner Widerspruch, Lust niemandes Schlaf zu sein unter so viel Lidern“, und ihr erklärte, dass das die Inschrift auf Rilkes Grab sei, runzelte sie schon etwas die Stirn, die Rosi, denn sie sah sich nicht als Widerspruch, sondern als ein klarer, heller Geist, der immerhin das Gymnasium besuchte und Philosophie, Germanistik und Geschichte studieren wollte. Aber beindruckt hat die Rosi das schon, dass er, der Hinterachinger, sich mit so etwas beschäftigte und nach einigen Diskussionen und Nachforschungen hat sich auch in ihrem klugen, hübschen Kopf die vielsinnige Tiefe des Spruches auf Rilkes Grab aufgetan, denn sie haben sich geeinigt, unter „Rose“ das Symbol der mystischen Vereinigung mit dem Göttlichen zu verstehen, welches auch Widerspruch aufzunehmen vermag, und unter „niemand“, das Selbst, frei vom Ego.
Hartmuth fühlte sich seltsam wohl in ihrer Nähe. Einmal – es war im Winter und draußen war es schon dunkel – saßen sie nebeneinander im Waggon der Zillertalbahn und wackelten taleinwärts und schwiegen für eine Weile. Plötzlich legte sie ihr rothaariges Köpfchen, das so gut zu ihrem Namen passte, auf seine Schulter und ihre Hand auf seinen Oberschenkel. Da wurde ihm warm ums Herz und er küsste sie auf ihre sommersprossige Wange und auf den weichen Mund.
Mehr war aber nicht, für lange Zeit, aber seither brannte ein inneres Flämmchen in beiden. Rosi nannte ihn seither „Harti“ und er meinte schmunzelnd: „Ist jedenfalls besser als Softi.“ In Hinteraching nannten ihn alle „Hartl“, was er als grob und auch ein wenig als herabsetzend empfand.
Hartmuths Zugfahrten endeten schon nach einem Jahr, als die Schule für ihn endete, aber sie trafen sich doch immer wieder nach telefonischer Verabredung und manchmal fuhr Hartmuth einfach mit dem Zug, obwohl er gar nicht musste.
Vor ungefähr einem Jahr hatten sie sich zu einer Wanderung durch die „Glocke“, den Zauberwald im Bereich von Finkenberg verabredet. Ein dunkler, wunderbarer Wald, in dem sich immer wieder zwei Bäume, eine Buche und eine Fichte oder eine Birke und eine Föhre, eng umschlungen halten wie ein glückliches Ehepaar, das seinen Nachwuchs rundherum bewundert. Hartmuth erzählte ihr voll Begeisterung von den Geheimnissen der Bäume. Sie blieben vor einer besonders schönen und mächtigen Buche stehen und bedeutungsvoll meinte er: „Schau Rosi! Dieser Baum, er holt sich nur etwa 0,5% seiner Substanz aus dem Boden, alles andere holt sich der Baum aus der Luft! Ein richtiger Luftikus ist das!! Sie lachten. „Aus den anorganischen Elementen CO2 und H2O werden mit Hilfe der Sonnenstrahlen in der Photosynthese, die sich in den Chloroplasten der Blatt- und Nadelzellen abspielt, organische Zellen, nämlich Glukose und daraus werden dann Kohlenstoffe etc.! Ein Baum, ein Kunstwerk aus Luft und Sonne! Auch die Statik der Bäume ist unglaublich und von einer Komplexität, die an Wunder grenzt!“
„Ach ja“, sagte er dann, „setzen wir uns doch hier ein wenig hin!“ Sie breiteten die mitgebrachten Decken im weichen duftenden Moos aus und setzten sich, weitab vom Gehweg, am Fuße einer riesigen Buche mit edler, glatter Haut, die mit ihren Armen eine blonde Birke umfasste. Hartmuth erzählte weiter von seinen Freunden, den Bäumen, er erzählte geheimnisvoll von den Baum-Nymphen der griechischen Mythologie, von den wundersamen Qualitäten des Mondholzes, welche sich der Welt nur dann präsentieren, wenn das Holz im Winter bei abnehmendem Mond geschlagen wird, er erzählte euphorisch vom Werden und Vergehen der umstehenden Bäume, nannte ihre Namen und berichtete von ihrem Charakter, von ihren Stärken und Schwächen und auch von ihren Untermietern, den Eichhörnchen, den Vögeln, den Borkenkäfern, den Holzwürmern und vielem mehr. Rosi hörte ihm mit Bewunderung zu, sie fragte viel und wollte alles wissen, sie labte sich an seiner Euphorie, sie genoss in zunehmendem Maße ihre so naturverbundene Zweisamkeit und lehnte ihr rosig-haariges Köpfchen an seine Schulter.
Hartmuth holte dann plötzlich einen Zettel aus seiner Hosentasche und flüsterte ihr ins Ohr: „Ein Gedicht von mir an die Bäume“, und las:
„Baumtraum
Unendlich langsam streben sie nach oben,
stetig und im Lot zum Licht gezogen.
Balancegefühl in allen Baumsaft-Venen
lehrt Ast und Ästchen, sich recht auszudehnen,
bis sie gerade oben stehen, die stolzen Riesen,
auf Felsen und auf steilen Berghang-Wiesen.
Nichts bringt sie aus dem Gleichgewicht,
nicht der Sturm und auch der schräge Boden nicht.
Über Hunderte von Jahren ziehen sie mit ihren sanften Krallen
Lebenskraft aus Fels und Boden, um grad’ zu stehen und nicht zu fallen.
Leg dein Ohr an ihren Stamm, um ihren Herzschlag zu erlauschen,
und horche auch, wie ihre Atemzüge durch die Wälder rauschen,
und seht Ihr, Freunde, auch ihr liebevolles Wiegen
und ihre Nachsicht, wenn sie sich im Winde biegen.
Es sind Tiefen-Riesen und sie wissen es im Stillen,
edle Schöpfungen aus großem Schöpferwillen.
Rosi war begeistert von ihrem „Harti“ und gerührt, sie umarmte ihn zärtlich, küsste seine Wange und meinte: „Ich weiß nicht, was du da hinten in Hinteraching auf dem Bauernhof zu suchen hast, du gehörst wo anders hin.“ Sie redeten noch lange und angeregt und lachten und neckten sich gegenseitig und verzehrten ihre mitgebrachte Jause und den Tee.
Es war inzwischen dämmrig geworden. Der Redefluss aber versiegte allmählich, irgendwas in ihrem Inneren schien immer mehr ihre Plappermäuler zu bremsen, irgendeine geheime Macht hatte von ihnen zunehmend Besitz ergriffen, sie schauten sich schließlich lange an, sie schauten sich tief in die sehnsüchtigen, jungen Augen, sie umarmten sich und küssten sich, sie entkleideten sich gegenseitig, sie rollten sich in die Decken und verloren mit innigster Wonne und unter dem Applaus zahlreicher in ihren Decken herumkrabbelnden Ameisen ihre Unschuld.
Der aufregendste und schönste Tag in Hartmuths jungem Leben, der „Baumtraumtag“ wie er ihn später taufte.
Doch schon wenige Tage später hieß es auf dem Lahnerhof: „Auf geht’s, Hartl, du musst mithelfen, Bäume fällen!“
Hartmut blickt aus seinem Zugfenster in die vorbeiziehende Landschaft, aber er nimmt sie im Moment nicht wirklich wahr, er ist in Gedanken und in Gefühlen bei dem, was war und nicht mehr sein würde.
Er liebte Rosi. Wieso fuhr er von ihr fort? Wieso hat er dem Stiefvater damals nicht mit Nachdruck gesagt, dass er keine Bäume fällen will? Ja, er wollte wohl ein „Kerl“ sein und „seinen Mann stellen“, er wollte dazugehören zur Denkkultur, die dort galt, und nicht das Sensibelchen sein, das er in Wirklichkeit war. Vielleicht war dieses burschikose „Mann-sein-wollen“ angesichts des Haufens sonstiger Probleme, vor dem er stand, tief in ihm drinnen auch das Argument, das es still und heimlich irgendwie rechtfertigte und ihm ermöglichte, jetzt von Rosi wegzufahren, obwohl er sie liebte.
Gauderbock
Rosi und Hartmut hatten glückliche Stunden miteinander verbracht. Sie trafen sich, so oft sie konnten, doch das war nicht oft, denn zu sehr abgelegen wohnte Hartmuth und zu sehr eingefangen waren beide im Netz ihrer alltäglichen Aufgaben. Dann aber, zum Gauderfest im Mai 1978 in Zell am Ziller, hatten sie sich wieder verabredet und beide freuten sich schon sehr darauf.
Auch Vater freute sich schon auf das Gauderfest, denn er hatte einen wunderbaren, silbergrauen Schafbock, den „Hansi“, wie er ihn liebevoll nannte, und mit dem wollte er beim Widderstoßen im Rahmen des Gauderfestes groß auftrumpfen, denn der „Hansi“ war jetzt 4 Jahre alt und damit im Schafbocks-Mannesalter. „Ein reinrassiges Tiroler Steinschaf“, wie er immer wieder mit Stolz betonte, mit straffen und nicht zu langen Hoden, schön geschwungenen mächtigen Hörnern und natürlich einem harten Schädel.
Sie luden den Hansi in einen kleinen Tiertransporter, hängten diesen an ihren klapprigen Jeep und fuhren erwartungsfroh nach Zell, Vater in Gedanken an seinen prächtigen Hansi und Hartmuth in Gedanken an seine prächtige Rosi.
Ja, das traditionsreiche Gauderfest in Zell am Ziller! Wahrlich ein Kuriosum der Extraklasse. Der Gauderbock und das Gauderfest sind in der örtlichen Tradition seit jeher fest miteinander verbunden. Der Gauderbock vom Egger Sepp, dem Lahnerhof-Bauern, war in diesem Jahr der „Hansi“, das war klar, aber „Gauderbock“ heißt auch Österreichs stärkstes Fest-Bier, das seit dem Jahr 1500 von der Brauerei hier jährlich anlässlich des Gauderfestes gebraut wird, ein Starkbier mit beachtlichen 7,8 Volumenprozenten, das auf schelmische Art gerne dazu verführt, Böcke zu schießen, wie beispielsweise: „laut zu grölen und zu lallen oder einfach plötzlich umzufallen oder nach viel zu vielem Saufen fürchterlich zu raufen oder romantisch der Geliebten die Liebe zu gestehen und die Geliebte kann kein Wort verstehen oder sich von all dem Trubel geistig locker loszulösen und im Bierzelt sitzend einzudösen.“
Ja, früher wurden im Rahmen dieses Frühlingsfestes vor großem Publikum – fast wie einst in der Arena des Kolosseums in Rom – auch Wettkämpfe für so richtige Männer ausgetragen, man könnte auch sagen „maskuline Balzrituale“, wie Fingerhakeln, Hufeisenwerfen und Handumlegen. Irgendwann aber haben die Herren der Schöpfung erkannt, dass auch Siege in diesen Kämpfen bei den Damen keine Paarungsreflexe mehr auslösen, sondern höchstens noch Pflegereflexe in Bezug auf den körperlichen und geistigen Zustand der kämpfenden Männer und dann wurden diese Wettkämpfe aus dem Programm genommen und durch andere, gleichartige ersetzt. Bei den Tierwettkämpfen war die Entwicklung ähnlich, auch wenn diese schließlich ganz abgesagt wurden. Das Widderstoßen aber war beim Gauderfest 1978 noch hoch im Kurs.
Der Egger Sepp hatte schon lange und ungeduldig am „Hansi“ herumgezupft und ihm Mut zugeredet und als dann Hartmuth, der die ganze Zeit mit der Rosi an der Hand durch die Gegend lief, wieder vorbeikam, rief er ihm zu, er solle endlich dableiben und auf den Hansi aufpassen. Gut, also blieben sie eben beim Hansi und passten auf.
Ja, und dann, nach ewig langer Zeit kam der Aufruf aus dem lauten Lautsprecher: „Egger Sepp vom Lahnerhof, Hinteraching“! Hartmuth umarmte von hinten seine Rosi, sie steckten die Köpfe zusammen und er hielt ihre Hände: „Daumen drücken“, flüsterte er ihr ins Ohr. Gebannt schauten sie in den großen, von Tausenden Menschen umzingelten Ring auf der großen Festwiese. Voll Stolz, Würde und Aufregung schritt der Sepp in die Arena, mit dem Hansi, dem Prachtkerl von einem Schafbock, einem reinrassigen Tiroler Steinschaf eben, an der Leine. Dann wurde der Gegner aufgerufen: „Oberhuber Horst vom Schindlerhof, Schlitters“ und der Horst schritt ebenso in die Arena, mit einem noch prächtigeren Schafbock. Hartmuth meinte zu erkennen, dass der Horst dem Bock die Haare mehr oder weniger in die Höhe frisiert hatte, um ihn noch größer erscheinen zu lassen und so Angst zu verbreiten, so ähnlich wie kleine Katzen sich manchmal aufplustern und sich schräg hinstellen, um groß und stark und gefährlich zu erscheinen.
Die Böcke wurden einander vor- und gegenüber gestellt und damit ihr burschikoses „Kopfstoßprogramm“ in ihrem Stammhirn hormonell gestartet, denn da hatte doch tatsächlich ein anderer Bock sich erdreistet, sich ihm gegenüber zu stellen! So eine Frechheit! Zwei Rivalen im Kampf um den Chefposten in der Schafherde, einer Herde, deren Rolle in diesem Falle das Publikum übernahm. Die Leinen wurden gelöst, die stolzen Eigentümer der Böcke zogen sich zurück, es wurde leise in der Arena, die Spannung stieg.
Die beiden Böcke sahen sich tief in ihre Bocks-Augen, senkten ihre Schafsköpfe, gingen langsam 3 Meter zurück, Gefährlichkeit verbreitend, gingen noch langsamer noch einen Meter zurück, ohne dabei den Rivalen aus den Augen zu lassen. Dann rannten sie los und krachten mit ihren harten Schädeln aufeinander, dass es weitum von den Bergen gehallt hätte, wenn nicht das Publikum – die Schafherde – laut aufgeschrien hätte. Hansis Vorderbeine waren kurz eingeknickt, aber beide schalteten gleich wieder mit bedrohlichen Gesten den Rückwärtsgang ein, um erneut Anlauf zu nehmen. Als aber der Bock vom Horst mit seinen auftoupierten Haaren wieder losrannte, da drehte sich der Hansi um, zog seinen Schwanz ein und rannte davon.
Ein Raunen ging durch die Menge und ein ächzendes Stöhnen durch die Brust vom Sepp. Er senkte seinen Kopf! Er blickte niemanden mehr an, er blickte nur noch auf den Boden.
Der Name des Siegers wurde verkündet. Sepp Egger, der nicht mehr erwähnte und gedemütigte Lahner-Bauer, hingegen fing seinen Versager ein und band ihm eine Leine um den Hals, mit der er ihn am liebsten gleich erwürgt hätte. Er drückte die Leine dem Hartmuth in die Hand, damit er ihn verräumte, wie er sagte, wobei er hinzuraunte: „Eine Schande das Vieh! Was für eine Schande!“ Dann begab er sich in das Bierzelt, um mit ein oder zwei oder drei richtigen Gauderböcken die Enttäuschung hinunter zu spülen.
Auch Hartmuth ließ den Kopf hängen wie sein Stiefvater. Rosi versuchte noch, ihn zu trösten, und meinte humorvoll: „Ach, Harti, schau, der Hansi war eben der Klügere. Wer will schon mit seinem Kopf gegen so einen harten Sturschädel anrennen?“ Aber Rosi konnte nicht wissen, was in Hartmuth vorging. Was ihn erschütterte, war nicht das Verhalten vom „klugen Hansi“, sondern das seines Stiefvaters. Hartmuth hatte sich nämlich vor ein paar Tagen nach einer kleinen Auseinandersetzung mit dem Stiefvater in stiller, dunkler Nacht definitiv entschlossen, den Hof, das Tal und Alles eben, ja, sogar seine Rosi, zu verlassen und sich in Deutschland oder sonst wo in der Welt eine bessere Zukunft zu suchen.
Betroffen war er vor allem deshalb, weil er nun wusste, dass er dann, wenn er dem Vater seine Entscheidung wegzugehen mitteilen würde – und dies musste er wohl in den nächsten Wochen tun – in den Augen seines Vaters als die gleiche Schande dastehen würde wie der Hansi, der eben seinen Schwanz eingezogen hatte und abgehauen war. Hartmuth gab mit Beklemmung dem Hansi zu fressen und zu trinken und band ihn an den Tiertransporter, der in der Wiese stand, ahnend, dass die Tage des armen Hansi wohl gezählt sein dürften.
Konservation
Die erlebten Szenen hatten ihm auf kuriose Weise die Ungeheuerlichkeit seiner Absicht „abzuhauen“ schmerzvoll vor Augen geführt – ein ungeheurer Affront gegenüber seinem Stiefvater, gegenüber seiner Rosi und gegenüber der Tradition in der er aufgewachsen war. Würde er sich je damit trösten können, zu sagen, „er sei eben der Klügere gewesen“?
Er hätte sich am liebsten irgendwo verkrochen und Rosi merkte wohl sein plötzliches Unbehagen, aber sie kannte die wahren Ursachen seiner Verstimmung nicht, sie wusste noch nichts von seinen verräterischen Plänen. Rosi war das erste Mal in ihrem Leben auf dem Gauderfest und wollte den traditionellen Gauder-Umzug sehen und „ihr zuliebe“, wie man so schön sagt, ließ er sich mitschleppen.
Wie ein grauer Stein stand er dann da, am Straßenrand im Dorfzentrum von Zell, neben seiner schönen, jugendfrischen, rosaroten Rose, inmitten der lebens- und erwartungsfrohen Menge, in Erwartung des großen Festumzuges. Ja, wie ein grauer und schwerer Stein stand er da, voll Beklemmung, am Rand der Straße und am Rand der Gesellschaft. Man hatte ihm schon allerlei erzählt von diesem Umzug, einiges hatte er gelesen und manches wurde über Lautsprecher gerade eben lauthals verkündet.
Hartmuth schließt die Augen im Gewackel des Zuges und versucht, sich an die damaligen Geschehnisse und Erlebnisse zu erinnern. Sein damaliger Blick auf die Ereignisse war gefärbt von seiner inneren Irritation und so gefärbt ist daher auch jetzt seine Erinnerung:
„Der Prozession voran fuhr – wie angeblich schon seit 500 Jahren – ein riesiges Fass Bier, auf dem eine mit Bierbauch wohl ausgestattete Karikatur des Gottes Dionysios saß, in der dort greifenden Barbarenvariante allerdings genannt ‚Gambrinus‘, der Gott des Bierrausches, ein mythischer König, der angeblich die Kunst des Bierbrauens vor Tausenden von Jahren erfunden haben soll. Bekleidet mit Rüschen und Gamaschen, auf dem Haupt einen Kranz aus Hopfenblüten, im Gesicht ein gutmütiges Grinsen, in der Hand einen riesigen Bierkrug, aus dem er immer wieder kräftig trank und den er, zum Trinken aufmunternd, herumschwenkte wie einen Pokal nach errungenem Sieg. Verkörpert wurde der Göttliche – wie hätte es anders sein können – von einem Mitglied des Theatervereins!
Dem Allerheiligsten folgte dann das Volk, fein organisiert in Grüppchen, jedes Grüppchen in Eintracht, es ist ja ein Trachtenumzug, jedes Grüppchen in sich uniform, konform und konservativ, der eigenen, separaten, wohlgepflegten, vermutlich uralten Tradition verpflichtet und erlegen.
Dann eine Blaskapelle aus Südtirol mit roten Jacken und spitzen, befiederten Hüten. Ein kleiner Menschenknäuel, der sich zum Zusammenspiel verpflichtet hatte, ein im Gleichschritt marschierendes und inbrünstig in Instrumente blasendes Netz von gegenseitigen Versprechungen, Verpflichtungen und Nötigungen, das sich im Laufe von vielen Jahren über diesen ganzen in eine Uniform geschlüpften Knäuel gelegt hatte. Ein Netz, ohne welches die schneidige Marschmusik nicht erklingen hätte können, die erklang. ‚Sie haben sich ihre Eintracht und ihre Unterscheidung vom Rest der Welt und ihre harmonisch klingende Zusammengehörigkeit redlich erarbeitet und verdient‘, fand Hartmuth.
Dann eine Gruppe ‚richtiger‘ Tiroler Bauern, in den Kostümen der Heldenepoche 1809, mit Sensen und Knüppeln bewaffnet und – ihnen voran – ihr Gewissen, ein betender Kapuzinerpater, und in ihrer Mitte ihr Herzstück, eine kleine Kanone, aus der sie mit sichtlichem Vergnügen und mit maskulinem Balzgehabe an markanten Stellen des Umzugs, jedenfalls auch vor der Ehrentribüne, mittels Schwarzpulver Zeitungspapierfetzen in die Luft schossen und sich schelmisch freuten, wenn alle zusammenzuckten.
Dann die nächste Trachtengruppe, ‚gegründet 1894‘ stand auf einer Tafel, die der Gruppe vorangetragen wurde, und dahinter eine Trachtenkapelle, die in diesem Jahr stolz ihr 175-jähriges Bestandsjubiläum feierte.
Eine Orgie, offensichtlich nicht nur zu Ehren des Gambrinus, des Gottes des Bierrausches, sondern auch zu Ehren des Konservativismus! Eine Prozession uralter, aus den tiefsten Kellern der Seelen geholter Konserven, die sich stolz im Licht des Festes präsentierten. Die Dinge sollen so bleiben, wie sie immer waren, so schrie es aus allen Gesichtern, so verkündeten es die Täfelchen, die vorangetragen wurden, und so roch es stark aus allen Trachten, die einträchtig herumgetragen wurden! Eine beispiellose Demonstration dessen, was alles Leben will! Alles Leben will sich erhalten und es ist dieser unbändige Selbsterhaltungstrieb, der alles festnageln und fixieren will, so wie es war und so soll es gefälligst bleiben, um festen Boden zu schaffen, auf den sich ein Fuß setzen lässt, um sich an etwas festzuhalten, um nicht hinweggeschwemmt zu werden vom Fluss des Lebens, letztlich um nicht vergehen und sterben zu müssen. Es ist der Bleibewillen des Welt-Ichs der hier, begleitet von Marschmusik, so pompös seine Aufwartung machte. Es war erstaunlich, mit welchem Ernst und mit welcher theatralischen Würde sie einherschritten, diese Jünger des Konservativismus, mit dem Stolz ihrer Väter im Gesicht und auch mit Freude im Herzen, weil sie dazugehörten und dabei waren.“
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.