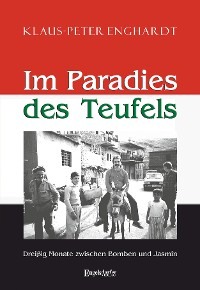Kitabı oku: «Im Paradies des Teufels», sayfa 5
Als wir dann in das Camp kamen, ging ich zuerst zur Kiste und war tatsächlich zu Tode erschrocken. Der kleine Hund lag auf der Seite und war kaum noch am Leben. Das war kein Wunder, denn der Deckel lag auf der Kiste und die Stauwärme ließ dem Tier kaum Luft zum Atmen.
Ich lief sofort los, um einen Eimer mit Wasser zu holen, denn kampflos wollte ich den Hund nicht aufgeben. Ich nahm ihn aus der Kiste und bettete ihn im Schatten. Vorsichtig legte ich sein Köpfchen auf meine linke Hand und träufelte ihm mit der rechten Hand Wasser auf seine kleine Schnauze.
Nach einer gefühlten Ewigkeit begann er, das Wasser abzulecken und mit der Zunge zu hecheln, da schöpfte ich Hoffnung.
Dieser Welpe war ein Kämpfer und hatte sich nach etwa einer Stunde so weit erholt, dass er schon wieder sitzen konnte und ich freute mich riesig, dass sich meine Mühe gelohnt hatte.
Aus Kaffeesahne, Wasser und Weißbrotteig bereitete ich ihm seine erste Mahlzeit.
Am Abend nahm ich ihn zu mir und meinem Zimmerkameraden Rodschi und legte ihm ein Handtuch unter das Bett. Er schlief sanft darauf ein. Ich verbrachte eine längere Zeit damit, den schlafenden Welpen zu beobachten. Mit seinem flauschigen hellbraunen Fell, das gelb und weiß gefleckt war, glich er einem Spielzeughund und genau so groß war er auch nur.
Zufrieden legte auch ich mich in mein Bett, doch als ich am Morgen aufstand, bemerkte ich, dass ich kein Hundekenner war. Ich hätte nämlich daran denken müssen, dass ein kleiner Hund, der am Abend eine ganze Menge Milch getrunken hatte, irgendwann auch mal sein Beinchen heben musste und das war nun unverkennbar in unserem Zimmer geschehen.
Jetzt durfte ich erst einmal das Zimmer wischen und mir wurde schlagartig klar, dass mich am Abend die gleiche Situation erwarten würde.
Ich wollte mir also auf der Baustelle schnellstens eine Behausung für den kleinen Racker suchen, in der er den Tag verbringen konnte.
Schließlich fand ich eine schöne Kiste, in die ich einen Eingang schnitt, gerade so groß, dass der Welpe hineinschlüpfen konnte, in den aber die großen Hunde aus unserem Camp nicht hineinpassten. Dann nagelte ich einen Rest Maschendrahtzaun über die Kiste und stellte sie so, dass der Maschendraht zur Seite zeigte und der kleine Kerl hinausschauen konnte.
Als wir zum Feierabend nach Hause kamen, war es so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich musste das Zimmer erneut wischen. Nun hatte ich jedoch für Abhilfe gesorgt und es galt, für die Hundehütte eine geeignete Stelle zu finden. Sie sollte die meiste Zeit des Tages im Schatten stehen und so eine Stelle fand ich zwischen unserem Bungalow und dem Küchentrakt.
Der Platz war ideal.
In den folgenden Tagen ließ ich den Welpen allerdings noch in unserem Zimmer schlafen, selbst auf die Gefahr hin, wieder ein paar Pfützen aufwischen zu müssen.
Ich überlegte mir, dass der Hund einen Namen brauchte, er sollte ja irgendwann auf mich hören.
Die Namenssuche war gar nicht so einfach, aber schließlich kam mir dann eine gute Idee, nachdem mir meine Kollegen vorher nur Unsinn vorgeschlagen hatten.
Ich dachte daran, wo wir ihn gefunden hatten – das war in der Wüste. Sein Gesicht und seine Färbung sahen einem Fuchs recht ähnlich, also Wüste und Fuchs, das ergab „Wüstenfuchs“.
Spontan kam mir die Idee, in Anlehnung an einen großen deutschen Heerführer und General aus dem II. Weltkrieg, der von den Landsern den Namen „Wüstenfuchs“ erhalten hatte, den Hund „Rommel“ zu nennen.
Der Name fand unter meinen Kollegen Anklang und so blieb es dabei.
Rommel entwickelte sich prächtig. Er war ein kluges Kerlchen und ich war jeden Tag froh, ihn zu haben.
Den Tag verbrachte er inzwischen in seiner Hundehütte, in die ich einen Pantoffel von mir legen musste, da er abends ständig mit meinem Hausschuh im Maul herum rannte. Kaum von der Arbeit gekommen, nahm ich ihn aus der Hütte und ab diesem Zeitpunkt, war er nicht mehr abzuschütteln. Er lief mir ständig hinterher und schnappte dabei immer vorsichtig in meine Hacken.
Wir waren unzertrennlich, aber da gab es eine Menge Neider.
Nein, ich meine nicht meine Kollegen, sondern es handelte sich dabei um die wilden Hunde im Camp, denen es offensichtlich nicht gefiel, dass es einen Artgenossen gab, der sich sein Futter nicht selbst suchen musste.
Nachts, wenn er einmal raus musste, ging ich mit ihm und achtete genau darauf, seine großen Artgenossen auf Distanz zu halten. Die Hunde aus dem Camp kamen jetzt tatsächlich bis an unseren Bungalow und mussten von mir oft mit einem Knüppel vertrieben werden.
Der größte Hund dieser Horde war dabei besonders dreist, wahrscheinlich war das der Leithund. Er hatte ein struppiges, dunkles Fell und war wegen seiner Größe und der Farbe des Fells gut von den anderen Hunden zu unterscheiden. Ein paar Mal kam er mir bedenklich nahe, aber er wagte es nicht, mich anzugreifen.
Es gelang mir manchmal sogar, ihm mit dem Knüppel einen Hieb zu versetzen. Oder ich warf ihm einen Stein hinterher, auch das brachte für ein paar Tage Erfolg.
Inzwischen hatte ich Rommel beigebracht, dass er mich wecken sollte, wenn er mal raus musste. Dazu stellte er sich auf die Hinterbeine und zog mit seiner Schnauze meine Bettdecke weg.
Die Tagesabläufe glichen sich stetig. Nach der Arbeit wurde geduscht und dann gegessen. Dabei hatten wir es bisher so gehalten, dass jeder Kollege aus unserem Zimmer und zwei Kollegen aus dem Nachbarzimmer im Wechsel an der Reihe waren, für das Abendessen zu sorgen.
Im Gegenzug erledigten die anderen Kollegen den Abwasch.
Da wir sehr schnell herausfanden, dass nicht jeder von uns ein begnadeter Koch war, wurde der Modus geändert.
Man sagte mir als Hobbykoch die größten Talente nach und so kam es, dass jeder Kollege im Wechsel den Vorrat bereitstellen musste, ich allerdings nun allabendlich kochte. Ich machte das gerne und es befreite mich vom leidigen Abwasch.
Beim Kochen war ich sehr erfindungsreich und es gab nie Klagen, dass mein Essen nicht schmackhaft wäre, aber vielleicht auch deshalb nicht, weil sich die Kollegen vor dem Kochen drücken wollten, so wie ich mich vor dem Abwasch.
Am nächsten freien Tag führte uns ein Ausflug mit unseren Bussen zu einem der berühmtesten Bauwerke des Irak, dem Sassaniden- Palast von Ktesiphon, dreißig Kilometer südlich von Bagdad.
Dieser Palast wurde im dritten Jahrhundert von König Sapur errichtet, der von 241 bis 272 regierte und sich als König der Könige bezeichnete.
Der Palast, von dem nur noch Teile vorhanden waren, ist ein Wunderwerk architektonischer Baukunst. Seine Audienzhalle besteht aus dem größten, frei tragenden Backsteinbogen der Welt.
Es ist ein so genanntes Tonnengewölbe und wird „Der Bogen des Khosrow“ genannt. Seitlich des Bogens schlossen sich die Nebengebäude an, von denen nur der linke Flügel erhalten geblieben war. Ursprünglich befand sich spiegelverkehrt neben diesem Palast noch ein zweiter, doch der wurde bei den Kämpfen zwischen britischen Truppen und Soldaten des osmanischen Reiches zerstört.
Die monumentale Größe war, gemessen an den technologischen Möglichkeiten zur Zeit seiner Entstehung, sehr erstaunlich.
Die Mauerstärke des Bogens beträgt an der dicksten Stelle sieben Meter und wurde zunächst in dreiundachtzig Schichten leicht nach innen versetzt gemauert, um einen Bogen zu erhalten. An der Spitze des Bogens, in der Höhe von dreiunddreißig Metern, beträgt die Mauerstärke noch einen Meter.
Der Palast wurde von den Sassaniden Königen noch bis in das Jahr 633 genutzt. In der Schlacht von Quadissiya um Ktesiphon und Seleukia im Jahr 637 wurde die Doppelstadt von den Muslimen erobert. Mit der Gründung Bagdads im Jahr 732 verfiel die einstmals prächtige Metropole der Sassaniden.
In einem Korral vor dem Palast standen zwei Kamele, die von einem alten Mann betreut wurden, der so aussah, als wäre er aktives Mitglied bei der Schlacht von Quadissiya im Jahr 637 gewesen.
Ebenso alt schienen die Kamele zu sein. Die Kleidung des alten Mannes unterschied sich ebenfalls nicht von der Kleidung vor hunderten Jahren.
Er trug einen gewaltigen weißen Schnauzbart und war unrasiert, hatte aber lustige Augen und einen gutmütigen Gesichtsausdruck. Er bot den Touristen seine Kamele zum Reiten und zum Fotografieren an und hatte auf Wunsch, auch arabische Kleidung zur Verfügung, um die Fotos noch authentischer aussehen zu lassen.

Mit einfachsten Polaroid Kameras machten die irakischen Fotografen die ausgefallensten Fotos, indem sie das Objektiv mit Tape teilweise zuklebten, den Bildtransport blockierten und so auf einem Bild mehrere Aufnahmen machen konnten.
Ich wollte gern ein paar professionelle Fotos mit arabischer Kleidung als Souvenir mit nach Hause nehmen und suchte mir die entsprechende Kleidung aus. Schließlich entschied ich mich für ein Gewand mit üppiger Goldborte und goldener Stickerei und dem dazugehörenden Kopfschmuck.
Ein kostbar aussehender Gürtel und ein verzierter Säbel rundeten das Bild ab.
Meine dunklen Haare und mein gezwirbelter Schnauzbart passten perfekt zu der Kostümierung.

Vor dem Bogen des Khosrow
Als ich die Kleider angelegt hatte, ging ich zu dem Kamel, um aufzusitzen. Das war übrigens bei einem Kamel gar nicht so einfach, vor allem, wenn das Kamel schon oft zum Auf- und Absteigen beansprucht wurde.
Da das bei meinem Kamel glücklicherweise noch nicht der Fall war, ließ es sich mit einem Tritt gegen das linke Vorderbein von dem Kamelführer, den man „Kabashi“ nennt, überreden, sich hinzuknien, damit ich aufsteigen konnte. Als sich das Kamel dann erhob und ein paar Meter lief, erklärte sich für mich der Begriff „Wüstenschiff“. Beim Aufstehen des Tieres wäre ich schon beinahe nach hinten heruntergefallen. Durch den wankenden Gang wurde ich hin und her geschüttelt, wie auf einem Dampfer bei Seegang.
Ich ritt ein paar Meter und ließ dabei einige Fotos machen. Als ich dann absitzen wollte, knickte das Kamel urplötzlich so in den Vorderbeinen ein, dass ich mich nur mit aller mir in wenigen Minuten angeeigneter Reitkunst an den Zügeln und am Fell festklammern konnte, um nun nicht nach vorn herunterzufallen.
Ich hatte den Ritt aber gut überstanden und ging mit der Zustimmung des Kamelführers hinüber zum Palast, um mich auch dort noch einmal in den Kleidern fotografieren zu lassen. Als ich für meine Kollegen zum Gaudi theatralisch zum Bogen des Khoshrow schritt, um davor abgelichtet zu werden, bemerkte ich zunächst gar nicht die staunenden Blicke der Touristen, als ich es jedoch registrierte, dass ich wegen meiner prächtigen Kleidung so angestaunt wurde, machte ich mir den Spaß, ein wenig wie ein Emir herumzustolzieren und ich muss sagen, dass mein Auftritt seine Wirkung nicht verfehlte und mein Konterfei wohl in manchem japanischen Fotoalbum gelandet sein dürfte.
Die Wirkung war grandios und als ich meine Kleider wieder ablegte und darunter Jeans und T-Shirt zum Vorschein kamen, gab es ein Riesengelächter. Auch die anwesenden japanischen Touristen hatten mir meine Mogelei nicht übel genommen.
Vom Park aus gelangte man innerhalb weniger Minuten zu einem kleinen Dorf direkt am Tigrisufer. Dort gab es durch die Nähe des Wassers langgezogene Palmenhaine, in deren Schatten kleine Häuser, mit meist flachen Dächern, Schutz suchten.
Es waren die typischen weiß gekalkten Lehmziegelhütten, die nicht sehr groß waren, aber trotzdem für eine große Familie Platz bieten mussten.
Um die Häuser herum bot sich uns ein Pflanzenreichtum dar, den man schon von weitem riechen konnte.
Vor den Häusern saßen alte Männer auf wackeligen Schemeln im Schatten riesiger Dattelpalmen. Sie rauchten und schauten den Frauen bei der Arbeit zu, Kinder spielten mit dem Ball und durch das Dorf tollten Hunde.
Die Nähe des Palastes und des Parks erschloss den Dorfbewohnern eine kleine Einnahmequelle, in dem sie kalte Getränke oder kleine Souvenirs verkauften oder Grillspieße aus Hammelfleisch anboten. Mit einem zweirädrigen Karren fuhren die Straßenköche zu den Plätzen, von denen sie sich den meisten Umsatz versprachen. Und wenn man einen robusten Magen hatte und die mangelnde Hygiene nicht unbedingt Anlass zum Verzicht gebot, dann konnte man für relativ wenig Geld die schmackhaften Lammspießchen oder andere Speisen genießen.
Auch Zigaretten wurden an den Mann gebracht, allerdings zu unverschämten Überpreisen.
Der Handel florierte selbst an den entlegensten Orten und war den Arabern angeboren.
Nach diesem Ausflug ging es zurück ins Camp und ich ahnte nicht im Geringsten, dass dieser erlebnisreiche Tag zugleich für mich der bisher schwärzeste Tag im Irak werden würde.
Im Camp erwartete mich in seinem Hundestall mein kleiner Freund Rommel und ich musste mich ihm nun ausgiebig widmen, sonst wäre er beleidigt gewesen. Ich ging mit ihm im Camp spazieren und bemerkte, wie die ausgewachsenen Hunde uns beobachteten. Ich achtete darauf, dass Rommel sich nicht zu weit von mir entfernte. Ein paar Mal kamen uns die Hunde gefährlich nahe und ich vertrieb sie mit gezielten Steinwürfen. Ich spürte jedoch ihre Aggressivität und zog es deshalb vor, mit Rommel lieber nach Hause zu gehen.
Am Abend fütterte ich ihn und nahm ihn vorsichtshalber für die Nacht in meinen Bungalow. Wenn er raus musste, weckte er mich ja, indem er auf mein Bett sprang, in die Decke biss und sich mit der Decke im Maul einfach fallen ließ. Ich stand dann auf, öffnete die Tür und wartete, bis er sein Geschäft erledigt hatte. Anschließend kam er wieder herein und wir schliefen weiter.
So geschah das auch in jener Nacht. Er weckte mich und ich ließ ihn hinaus, aber anstatt nach seinem Geschäft wieder herein zu kommen, wollte er mit mir spielen und tollte vor der Tür hin und her.
Ich schimpfte leise mit ihm und sagte, dass ich keine Lust hätte, jetzt in der Nacht zu toben aber er hörte nicht auf mich. Da ließ ich die Tür offen und dachte mir, dass er von selbst hereinkommen würde, wenn er sich ausgetobt hatte. Ich legte mich wieder hin und war fast eingeschlafen, als mich markerschütternde Schreie blitzartig hochfahren ließen.
Ich lief schnell hinaus, da ich das Schlimmste befürchtete, und sah gerade noch, den großen zotteligen Hund um die Ecke laufen.
Ich ging ein paar Meter und suchte Rommel. Da hörte ich ihn leise wimmern und sah ihn seltsam verkrümmt auf dem Boden liegen.
Am Hals war er blutig und als ich ihn aufheben wollte, bemerkte ich, dass wahrscheinlich durch einen Biss ins Genick seine Wirbelsäule gebrochen war. Aus seinen kleinen dunklen Kulleraugen schaute er mich an, als ob er mich bitten wollte „Hilf mir doch!“, aber ich konnte ihm nicht mehr helfen. Ich legte dem kleinen Racker meine Hand unter sein Köpfchen und sprach beruhigend auf ihn ein. Mir schossen Tränen in die Augen, weil ich wusste, dass ich das liebe Kerlchen in wenigen Minuten verlieren würde.
Ich hatte mich so sehr an ihn gewöhnt und konnte mir gar nicht vorstellen, dass sein kurzes Leben so schnell zu Ende gehen sollte. Er schaute mich traurig mit seinen braunen Knopfaugen an und unter Schütteln seines kleinen Körpers starb er in meinen Händen.
Ich hob den Hund sanft auf meine Arme und trug ihn in seinen Hundezwinger.
Am Morgen nahm ich ihn dann mit zur Baustelle und begrub ihn dort an einer schattigen Stelle hinter einem Container. Die Ägypter, die sonst den ganzen Tag auf mich einredeten, bemerkten meine Trauer und ließen mich an jenem Tag in Ruhe.
Mich hatte eine unbändige Wut gepackt und ich war fest entschlossen, auch dem Leben des schwarzen Hundes ein Ende zu bereiten. Ich lag die folgenden Abende mit einem Eisenrohr auf der Lauer, doch als ob er es geahnt hätte, ließ sich der Schwarze nicht mehr blicken.
MOHAMMED
Wenige Tage nach dem traurigen Ereignis rückte die erste Montagekolonne zu meiner Baustelle an, um die Hallen zu stellen.
Mit ihr kamen auch neue Ägypter. Unter ihnen befand sich ein älterer Mann, den eine starke Aura umgab. Sein Name war Mohammed und er sah mit seinen langen, weißen Haaren und seinem gepflegten, weißen Bart tatsächlich wie ein Nachkomme des gleichnamigen Propheten aus.
Bereits bei unserem ersten Blickkontakt befiel mich eine starke Sympathie zu diesem mir völlig unbekannten Menschen und ich spürte, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhte.
Die Achtung der ägyptischen Arbeiter vor diesem Mann und der sich entwickelnde Einfluss zu ihnen trugen dazu bei, dass er von seinen Kollegen zum Sprecher und von den deutschen Kollegen schon bald zum Vorarbeiter bestimmt wurde.
Er war ein sehr ruhiger, besonnener Mann mit einer tiefen, sympathischen Stimme. Schon am ersten Tag kamen wir beide ins Gespräch und ich stellte sofort fest, dass er nicht nur äußerst höflich, sondern darüber hinaus auch sehr intelligent war.
Er sprach mich grundsätzlich mit „Sir“ an und hatte große Achtung vor mir, obwohl ich wesentlich jünger war als er. Ihm fiel sofort auf, dass ich den ägyptischen Arbeitern englische Arbeitskommandos gab und dass einige der Männer mich deshalb nicht verstanden, da ein Großteil aus einfachen, ungebildeten Schichten stammte.
So war es bisher zuweilen vorgekommen, dass Arbeiten falsch oder nicht vollständig erledigt wurden und das war ärgerlich.
Er bot mir deshalb an, mir die arabische Sprache in ihren Grundzügen beizubringen, vor allem die Zahlen und die Bezeichnungen, die für unsere Arbeit wichtig waren.
Mohammed sprach ein ausgezeichnetes Englisch, was mir sehr entgegenkam, da ich auf diese Weise auch mein Schulenglisch verbessern konnte. Außerdem beherrschte er die persische und die türkische Sprache perfekt. Den Grund für seine Vielsprachigkeit erfuhr ich einige Zeit später, als wir uns angefreundet hatten und er mir an zahlreichen Abenden seine außergewöhnliche und überaus spannende Lebensgeschichte erzählte, die mich noch viele Jahre später auf eine besondere Weise beschäftigen sollte.
Als hätte ich das zu jenem Zeitpunkt bereits geahnt, machte ich mir von Mohammeds Berichten Stichpunkte in meinem Notizbuch, in dem ich auch sämtliche arabische Vokabeln notierte, die er mir beibrachte. Ich notierte mir Orte, die mir unbekannt waren, Angaben über seine Stationen in der Türkei, in Syrien oder in Ägypten, um dies alles später einmal in Landkarten suchen zu können oder in Lexikas nachzulesen. Das Internet gab es ja zu jenem Zeitpunkt leider noch nicht.
Eines Abends lud mich Mohammed zu sich in die Unterkunft ein und es war das erste Mal, dass ich im Camp der ägyptischen Arbeiter zu Besuch war. Wir saßen draußen vor den Unterkünften, er bot mir Tee an und wir rauchten eine Zigarette. Nach einer Weile bat er mich, ihm von meinem Leben zu erzählen. Es genügte tatsächlich ein einziger Abend, um die Erlebnisse und die wichtigsten Ereignisse meines Lebens zusammenzufassen.
Mohammed versprach mir anschließend, an den kommenden Abenden seine Lebensgeschichte zu erzählen und ich war sehr gespannt darauf, denn es sprach einiges dafür, dass dieser Mann eine Menge erlebt hatte.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Mohammed ein Geheimnis umgab.
Bereits am nächsten Abend ergab sich die Gelegenheit zu einem Gespräch.
Wir setzten uns auf unsere Bank, zündeten uns zwei Zigaretten an und schließlich eröffnete mir Mohammed, dass er mir seine Lebensgeschichte erzählen möchte – eine Geschichte, deren Tragweite mich an jenem Abend und auch an den Abenden darauf sehr erschütterte. Er verriet mir, dass es nicht viel mehr, als eine Handvoll Männer gab, denen er diese Geschichte im Verlauf von neununddreißig Jahren berichtet hatte, und es zeugte von seinem großen Vertrauen zu mir, dass er auch mich in sein Lebensgeheimnis einweihen wollte.
Wir saßen auf der kleinen, wackeligen Bank, zogen an unseren Zigaretten und blickten in den sternenklaren Himmel.
Mohammed wurde seltsam ernst, schaute auf eine unbestimmte Stelle in der Ferne und begann mit seiner tiefen, sanften Stimme zu erzählen. Ich war sofort gebannt und obwohl unser Gespräch auf Englisch geführt wurde, verstand ich jede Einzelheit.
Schon am ersten Abend wusste ich, dass dieser Mann die Wahrheit sagte. Ich spürte das an seinen Emotionen. Er sprach von Orten, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte, und von Abenteuern, die so unglaublich klangen, dass sie einfach wahr sein mussten. So etwas konnte sich kein Mensch ausdenken.
Seine Lebensbeichte, die mit einer Messerstecherei begann, als er seinem Vater mit neunzehn Jahren zu Hilfe sprang, zog sich über viele Abende hin und berührte mich tief. Es war für mich fast unvorstellbar, dass dieser Mann, der wie selbstverständlich neben mir saß, diese Fülle an Abenteuern und Schicksalsschlägen überstanden hat, ohne daran zu zerbrechen.
An jenen Abenden grenzenloser Vertrautheit, hatte ich nicht geahnt, dass mich sein spannendes Leben fünfundzwanzig Jahre nach seinen Ausführungen noch immer nicht loslassen, und ich eine Möglichkeit finden würde, um Mohammed auf eine ganz besondere Weise zu würdigen.
An einer Stelle, als Mohammed von seiner Heimat und seinem Zuhause sprach, brach er plötzlich seine Erzählung ab und schwieg sichtlich aufgewühlt.
Ich dachte bewegt: „Wo ist denn eigentlich nach über dreißig Jahren sein Zuhause? Ist es nicht längst in Ägypten oder war es noch immer in Zehnever, am Urmiasee im Norden Persiens?
Gab ihm Allah in diesen Tagen eventuell ein Zeichen, dass Mohammed inzwischen nur noch wenige Kilometer vom Iran entfernt lebte. Könnte es für ihn gar einen versöhnlichen Ausgang dieser „Reise“ geben?
Mohammed hatte wohl noch nie intensiv darüber nachgedacht, doch nachdem er mir seine Lebensgeschichte erzählt hatte, schienen die Bilder aus seiner Jugend an ihm vorüberzuziehen und etwas in seinem Inneren auszulösen. Er hatte sein Elternhaus seit der Messerstecherei nie mehr wiedergesehen und es war ihm auch in all den Jahren nicht möglich gewesen, Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen. Sein unstetes Leben trug dazu bei, dass er nie eine eigene Familie gründen konnte.
Dieses Glück war ihm leider versagt geblieben und ich glaube, dass er sehr darunter litt.
Als er, der wesentlich Ältere und Lebenserfahrenere, mich dann fragte, was ich an seiner Stelle tun würde, dachte ich einen Moment nach und antwortete ihm ehrlich: „Mohammed, Freund, du bist so nahe an deiner Heimat, wie du vielleicht nie mehr sein wirst. Du hast tausende Kilometer hinter dich gebracht, was sind da die fünfhundert Kilometer bis nach Hause? Es wird nichts mehr so sein, wie du es kanntest, vielleicht leben deine Eltern nicht mehr, aber du hast Geschwister. Und sollte ein Mann sein Leben nicht in der Heimat beschließen? Mache Frieden mit dir selbst und höre auf zu zweifeln. Kein Mensch wird dich nach so vielen Jahren noch wegen deiner Notwehrtat bestrafen wollen. Kehre in deine Heimat zurück!“
Mohammed antwortete mir nicht, aber in seinem Inneren arbeitete es. Schließlich legte er seine Hand auf meinen Arm, nickte leicht und sagte bewegt: „Thank You, Mr. Pieter, Sir. No other man i can talk like you with. I’ll do what you advise me.“ („Mit keinem Mann kann ich sprechen wie mit dir. Ich werde tun, was du mir rätst.“)
Sein Angebot, mich sprachlich unter seine Fittiche zu nehmen und sich mit mir abends zu unterhalten, war für Mohammed wie eine Art Vaterrolle, aber auch ich genoss die Zeit mit ihm. Wir verbrachten in den nächsten Wochen viele solcher Abende, an denen er mir von seinen zahlreichen Abenteuern erzählte oder mich in der arabischen Sprache unterrichtete.
Während der folgenden Wochen und Monate erlernte ich die arabische Sprache so weit, dass ich mich mit den ägyptischen Arbeitern und den Händlern in ihrer Sprache unterhalten konnte.
Ein weiterer Vorteil bei den Verhandlungen auf den Basaren war mein fast arabisch zu nennendes Aussehen.
Mit der Zeit eignete ich mir auch die arabische Gelassenheit an, ohne die man in einem arabischen Land nur schwer bestehen konnte.
Dass ich abends oft mit Mohammed zusammen saß, gefiel einigen meiner deutschen Kollegen nicht so gut, weil sie dachten, dass sich die ägyptischen Arbeitskräfte auf diese Weise einen Vorteil verschaffen wollten.
Als Leitmonteur war ich für den reibungslosen Arbeitsablauf an meinem Arbeitsplatz verantwortlich und das schloss für mich auch einen kollegialen Umgang mit den ägyptischen Kollegen ein. Ich konnte mich auf ihre Arbeit nur dann verlassen, wenn ich sie als gleichwertige Arbeitskräfte behandelte und das funktionierte nur, wenn mir die Ägypter vertrauten und wussten, dass auch ich ihnen vertraute.
Mohammed war also für mich ein wichtiger Ansprechpartner.
Meinem Kollegen und Stubenkamerad Harald gefiel das allerdings gar nicht, und er entwickelte eine nicht zu begreifende Antipathie gegenüber Mohammed, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckte und fast in einer Tragödie geendet wäre.
Einen Tag vor meiner Heimreise war noch einmal großer Einkauf, das hieß – wir fuhren am Mittag nach Bagdad und kauften in aller Ruhe auf dem Basar ein, vor allem Obst und Gemüse, welches zu Hause unbekannt war.
In den letzten Wochen hatte ich schon so oft den Basar unsicher gemacht und sowohl Stoffe, Schmuck, Messingartikel, Gläser und verschiedene Kleidung für die Familie eingekauft, deshalb zog es mich an jenem Tag auf den Gewürzbasar, da ich als Hobbykoch auch gern einige ausgefallene Gewürze mit nach Hause nehmen wollte.
Wir fuhren mit unserem Coaster Bus bis zum Buskreisel und die meisten Kollegen strömten sofort dem Basar zu. Ich allerdings wählte eine andere Richtung und tauchte allein in das betriebsame Leben Bagdads ein.
Ich schlenderte über den mir lieb gewordenen Rashid bis zur Kalifenmoschee und atmete den unbeschreiblichen Duft des Orients ein, der an jener Stelle besonders ausgeprägt war, denn nur wenige Meter entfernt befand sich der Gewürz-Souq, übrigens der größte des Landes.
In einem unübersehbaren Gewirr aus Ständen und kleinen Läden boten die Händler dort ihre Waren an. Die Gewürze waren kunstvoll in Schalen platziert, zu Pyramiden aufgeschichtet oder auf lange Fäden gezogen und ihre Farben waren ebenso vielseitig wie die aromatischen Düfte.
Der Besuch dieses Basars war ein ganz besonderes Erlebnis für mich.
Die Gerüche, die auf mich einströmten, waren unbeschreiblich und außerordentlich vielfältig und stellten alles in den Schatten, was ich auf anderen Basaren an Düften wahrgenommen hatte. Außerdem war die Präsentation der Gewürze in den einzelnen Ständen sehenswert und schon fast mit Kunstwerken zu vergleichen. Jeder Maler hätte in dem Gewirr der Stände seine Freude und auch ich war von der Faszination des Souq inspiriert und machte viele Fotos. Zum Glück ließen sich die Händler gern und bereitwillig fotografieren, waren sie doch stolz auf ihre Waren und wussten, dass die Fotos jetzt in einem fernen Land gezeigt wurden.
Man handelte mit allen bekannten Gewürzen der Welt, das jedenfalls versicherte mir einer der Händler und angesichts der Vielfalt der Gewürze, hunderter Gefäße, Schalen Tüten und Kästchen Gewürzketten und Gewürzpyramiden, glaubte ich es ihm auch unbenommen.
Zum ersten Mal roch ich den betörenden Duft des Safrans, genoss das Aroma von Zimtstangen und Vanilleschoten, Nelken, Sternanis, Kardamom und auch all der mir unbekannten Gewürze.
Ich fragte den Händler, ob er wüsste, wie viele verschiedene Gewürze es auf diesem Basar gab, aber darauf konnte er mir keine Antwort geben. Er sagte mir jedoch, dass ich jedes erdenkliche Gewürz bei ihm kaufen könnte und wenn er es nicht vorrätig hätte, würde es ihm zur Ehre gereichen, es in kürzester Zeit für mich zu besorgen.
Für diesen Tag genügten mir allerdings ein paar mir bekannter Gewürze, doch vor allen anderen Gewürzen war ich wegen des berühmten Currys hier, der ganz frisch, auf Wunsch der Kunden zusammengestellt wurde. Ich wollte mich da jedoch lieber auf die Kenntnisse des Händlers verlassen und bat ihn, mir ein Curry zu komponieren. Sichtlich stolz über mein Vertrauen mischte er über zwanzig Gewürze zu einer grandiosen Komposition zusammen. Dann schüttete er die Gewürze in eine Mühle und beim Zerkleinern der Gewürzmischung strömte das herrlichste Aroma aus, das man sich vorstellen kann. Frisch gemahlen, schüttete der Händler das Currypulver dann in ein luftdichtes Gefäß.
Bei meinem Abschied wusste ich genau, dass ich den Gewürzsouq sicher noch oft besuchen würde.
Nach einem Bummel durch die Gassen der Kupfer-und Messingschmiede, der Goldhändler, und der Textilverkäufer zog es mich jedoch in das Lokal am Buskreisel, denn der Appetit auf ein Bier war durch die lange Enthaltsamkeit sehr groß. Beim Eintreten sah ich, dass bereits einige meiner Kollegen an den Tischen saßen und auf die Heimreise anstießen. Ich schloss mich diesem Prosit gern an.
Am nächsten Tag fand dann meine Heimreise statt.
Auf dem Vorplatz des Flughafens standen hunderte Passagiere und warteten auf die Abfertigung, aber was ich an jenem Abend zu sehen bekam, verschlug mir einfach die Sprache.
Da standen mehrere hundert Chinesen in blauen Arbeitsanzügen und mit Schirmmützen auf dem Kopf, artig wie Schulkinder in Zweierreihe, hintereinander aufgereiht, wie auf eine Perlenschnur.
Wir deutschen Monteure warteten im Pulk auf den Vorplatz aber mit so einer Unordnung konnte die irakische Flughafenbehörde natürlich nicht zufrieden sein.
Ein Sicherheitsbeamter des Flughafens ging durch unseren ungeordneten Haufen, laut „one by one, one by one“ rufend, was bedeutete, dass auch wir uns in Zweierreihe aufstellen mussten, um in den Flughafen eingelassen zu werden. Peinlich genau wurde überwacht, ob das auch klappte. Das war mir so zum letzten Mal in der Grundschule passiert.
In geordneter Formation durften wir nun also, Pärchen für Pärchen, in die Empfangshalle einrücken. Im Unterschied zur Grundschule, brauchten wir uns jedoch nicht an den Händen zu halten.