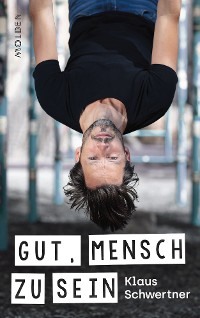Kitabı oku: «Gut, mensch zu sein»
Klaus Schwertner


Für Matilda, Valentin,
Severin und Moritz
INHALT
Cover
Titel
00 Vorneweg
01 Ohne Krise kein Happy End
02 Politisch unkorrekt
03 Von Höhen und Tiefen – Meine Kindheit, und warum die eigenen Krisen immer am meisten wehtun
04 Vom Shitstorm zum Flowerrain
05 Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Altruist
06 Follow me! Warum wir jetzt ein neues Netz brauchen
07 Kommen Gutmenschen eher in den Himmel?
08 Was am Ende zählt
09 Vom Mut, den ersten Schritt zu tun – Jetzt musst du springen!
Danke an
Der Autor
Impressum
VORNEWEG
Die Gedanken und Begegnungen, die Gespräche und Erfahrungen für dieses Buch trage ich schon lange in meinem Herzen, aber ich war ebenso lange nicht in der Lage, sie zu Papier zu bringen. Mit der Corona-Krise schien plötzlich der richtige Augenblick gekommen, um dieses Buch zu schreiben. Ganz einfach, weil ich immer stärker spürte, dass die Fragen, die mich seit Jahren beschäftigten, auch ganz viele andere Menschen umtreiben. Menschen, denen ich Tag für Tag begegne – persönlich oder auf Social Media. Und weil ich hoffte, dass die Antworten, die ich in den vergangenen Jahren für mich gefunden habe, jetzt auch für den einen oder die andere nützlich sein könnten. Gerade in dieser verrückten Zeit. Gerade in einer verrückt gewordenen Welt, von der seit Jahren gebetsmühlenartig behauptet wird, sie wäre aus den Fugen geraten.
Wie soll ich leben, wenn plötzlich alles infrage gestellt wird? Wenn wir uns nach der Vergangenheit sehnen und wissen, dass sie nicht mehr so kommen wird? Woran kann ich glauben, wenn die Wahrheit von Fake News immer schwieriger zu unterscheiden ist? Worauf dürfen wir hoffen? Was zählt? Was ist wichtig und was egal? Wer sind die Guten, wer die Bösen? In den vergangenen Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, das Match „Gut gegen Böse“ wäre längst entschieden! Alles geht den Bach runter. Das Ende ist nah. So hieß es oft. Und ich gebe schon zu: Es gab vermutlich schon entspanntere und hoffnungsvollere Zeiten. Eine Krise jagt die andere. Klimakrise. Finanz- und Wirtschaftskrise. Corona und Massenarbeitslosigkeit. Krieg in Syrien und im Jemen. Terror weltweit und zugleich in unseren Wohnzimmern. Alles rückt in Echtzeit näher. Das ist bedrohlich, macht Angst. Die Welt scheint dominiert von Populisten und Despoten, von Menschen, die andere klein machen, anstatt sie aufzurichten – nicht nur in der Politik, aber dort geballt. Bedacht auf den eigenen Vorteil, geschichts- und zukunftsvergessen. Egoismus anstelle von Solidarität.
Gerecht und gut fühlt sich das alles gerade nicht an. Aber dann ist da noch diese andere Welt voller Hoffnung und Mitmenschlichkeit. Die vielen Begegnungen und Gespräche, der Zusammenhalt und die Zuversicht. Vielleicht bin ich gerade deshalb überzeugt: Die Endzeitstimmung mit all den Bad- und Breaking-News lähmt nicht nur, sie verstellt auch den Blick auf all das Gute, das geschieht und das möglich ist. Mehr noch: Ich glaube, das Gerede von der drohenden Apokalypse ist was für Anfänger!
„Gut, Mensch zu sein“ ist der Versuch einer Ermutigung. Der Ermutigung, sich nicht vor dem angeblichen Ende zu fürchten, sondern stattdessen lieber Teil von etwas Neuem, Teil einer Veränderung zu sein – hier und jetzt. Der Erlöser wird nicht kommen! Wir sollten endlich erkennen: Die Erlöserinnen und Erlöser, das sind wir selbst. Denn das Match Gut gegen Böse ist keines, das nur auf den großen Bühnen und in den Hinterzimmern der Mächtigen dieser Welt entschieden wird, sondern zuallererst auch eines, das jede und jeder von uns selbst bestreiten muss. Da gibt es keinen Ausweg, keine Fluchtmöglichkeit und kein Entkommen. Wir selbst sind Teil des Problems – mit all unseren Schwächen, mit unseren Ängsten, den Bequemlichkeiten und Gewohnheiten! Wir können aber eben auch Teil der Lösung sein! Zumindest dann, wenn wir erkennen: Wir müssen nicht auf die Veränderung zum Positiven warten, wir können sie selbst sein. Es ist gut, Mensch zu sein.
Dieses Buch zu schreiben fühlte sich so an, als würde ich mich in Lockdown-Zeiten auf eine lange Reise begeben. Das Schreiben führte mich gedanklich zurück in die eigene Vergangenheit, an Orte, die ich lange nicht mehr besucht hatte, an Grenzen – persönliche und geografische. Nach Lesbos und zurück in die eigene Kindheit. Hinaus auf die Straße – dorthin, wo jene Menschen wohnen, die kein Zuhause mehr haben. Und an Orte, an denen man dem Tod näher ist als dem Leben. Hinein in die politische Arena, wo kaum etwas so ist, wie es scheint. Und hinab in meine eigenen Tiefen und Untiefen. Meine Geschichten handeln vom Gelingen und vom Scheitern. Von der Angst und dem Zweifel. Aber auch vom Mut und der Zuversicht. Und davon, dass eine bessere Welt möglich ist.
Liebe Leserinnen und liebe Leser, ich habe Fehler, Zweifel, und auch mich plagen häufig Ängste. Trotzdem möchte ich Ihnen mit meinem Buch „GUT, MENSCH ZU SEIN“ so richtig Bock auf das Gute machen! Mit einem Buch, das Sie inspirieren soll, das Gute zu sehen und sich selbst dafür einzusetzen. Denn das Match Gut gegen Böse ist noch lange nicht entschieden. Das Rennen ist offen. Der Einsatz und das Engagement lohnen sich. Und jede und jeder Einzelne von uns kann und muss selbst entscheiden, auf welcher Seite der Macht er oder sie stehen will. Wir werden das Ungleiche, das Ungerechte, die Krisen und Katastrophen nicht mit einer Methode, einer Handvoll Prinzipien oder mit den Zehn Geboten erfolgreich bekämpfen oder lösen können. Wir werden einen ganzen Werkzeugkasten voll mit Ideen und Lösungen brauchen. Einen Werkzeugkasten voll Mut und Entschlossenheit.
Veränderung ist möglich, wenn wir unsere eigene Komfortzone verlassen, über Grenzen zu gehen bereit sind, die Veränderung, die wir wollen, selbst vorantreiben. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dort, wo wir uns gerade befinden, leben und wirken. Dort, wo wir gebraucht werden und gefordert sind.
Wir selbst müssen zu jenen Menschen werden, die wir sein wollen, um unseren Kindern eine fairere und gerechtere Welt zu hinterlassen. Dazu ist es nicht nötig, zur Heldin oder zum Helden zu werden. Es kann schlicht und einfach genügen, uns immer und immer wieder in Erinnerung zu rufen: Es ist gut, Mensch zu sein.
Klaus Schwertner, Frühling 2021


Ohne Krise kein Happy End
Diesen Moment habe ich nicht kommen sehen. Dabei kam die Krise nicht aus dem Nichts, sondern mit Anlauf. Die ersten Meldungen erreichten uns im Januar 2020, mehrere Wochen, bevor es tatsächlich ernst wurde. Doch, dass es ernst werden würde, wollten die meisten von uns nicht sehen. Ich weiß nicht, ob es ein nicht „wollen“ oder ein nicht „können“ war – ein Mangel an Fantasie oder die Angst vor der anrollenden Gefahr. Zu dystopisch schien die Vorstellung, dass ein unbekanntes Virus unsere Gesellschaft mir nichts, dir nichts aus den Angeln heben könnte. Unvorstellbar. Kurze Zeit später schon werden wir uns zur Begrüßung und zum Abschied nicht mehr die Hand geben, unsere Liebsten nicht mehr umarmen. Die Straßen leergefegt. Geschlossene Geschäfte, Hotels, Kaffeehäuser und Restaurants. Homeoffice und Videokonferenzen. Homeschooling und Distance Learning. Nicht nur unser Land, die ganze Welt befand sich im Lockdown. Das Coronavirus stellt uns und die Art und Weise, wie wir bislang lebten, mit einem Federstreich infrage. Was bislang galt und unverrückbar schien, steht plötzlich zur Disposition. Wir machen die Erfahrung, dass wir verdammt verletzlich und angreifbar sind. Als Gesellschaft, über Grenzen und Kontinente hinweg – eine gesellschaftliche Nahtoderfahrung.
Wir erlebten in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten eine regelrechte Inflation an Krisen. Finanz- und Wirtschaftskrise: krachende Banken, schwankende Staaten. Flucht- und Migrationskrise: unfassbares Leid und überforderte Behörden. Die Klimakrise: Hitze, Artensterben, Gletscherschwund und die Unfähigkeit, diese Krise entschieden und konsequent gemeinsam zu bekämpfen. Als Nächstes also Corona. Die vier apokalyptischen Krisenreiter. Die Offenbarung unserer jüngeren Geschichte. War in den Nullerjahren eigentlich irgendwann mal keine Krise? Irgendwas war doch immer: Terror in den USA und in Europa, Krieg in Syrien, der Ukraine und in Afghanistan, die Erosion des Politischen, die Zweifel an der Demokratie und der rasante Aufstieg des Populismus. Trump und Brexit. Ibiza und Orbán. Und über allem eine veritable Krise des Vertrauens: in Wissenschaft und Glauben, in Politik, Medien und Wirtschaft. Als würde uns der Boden, auf dem wir bis vor Kurzem noch so sicher und trittfest standen, regelrecht unter den Füßen weggezogen. Das Ende der Gewissheit, gefolgt von einer großen Unsicherheit.
Ich frage mich in solchen Augenblicken oft: Was bleibt? Was hat noch Bestand, wenn wir alle spüren, dass das Alte nur noch bedingt Gültigkeit besitzt, das Neue aber noch nicht greifbar ist – wenn wir also mittendrin stecken in einer grundlegenden Zeit der rasanten Veränderung, in einer Zeit, in der die Karten neu gemischt werden? Aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich: Es gibt viele Menschen, die angesichts dieser Entwicklungen das Grundvertrauen in unseren Weltenzusammenhang zu verlieren drohen. Die Zuversicht und den Glauben, dass sich die Dinge zum Guten oder zumindest zum Besseren entwickeln können. Dass wir bei allem, was schwierig ist, in einer guten Welt und einem wunderschönen Land leben. Dass wir gemeinsam einen Weg aus diesen Krisen finden können – und werden.
Ich verstehe das. In seltenen Momenten beschleichen mich diese Zweifel, Sorgen und Ängste genauso. Meist dann, wenn ich spätabends im Bett liege und in den umliegenden Zimmern meine Kinder friedlich schlafen. Es ist die Welt, in die sie hineinwachsen. Die Welt, die wir ihnen hinterlassen. Wenn die Zukunft nicht zuallererst offen und im besten Fall verheißungsvoll, sondern düster und eher bedrohlich wirkt, dann macht das etwas mit uns Menschen. Es lässt uns straucheln.
Nicht zu wissen, was kommt, das Gefühl von Unsicherheit und Kontrollverlust halten wir nur sehr schwer aus. In unserer stark regulierten Gesellschaft unternehmen wir in der Regel alles, um Risiken zu minimieren, um auf Basis von Wahrscheinlichkeiten unsere Zukunft vorherzusehen. Und heute wissen – oder zumindest erahnen – wir, dass sich diese Zukunft nicht mehr so einfach aus der Vergangenheit ableiten lässt. Was gestern galt, kann morgen schon ganz anders sein. Sogar das Wort Momentaufnahme hat während der Corona-Krise eine ganz neue Bedeutung bekommen.
Hand aufs Herz: Wer hätte es vor wenigen Jahren schon für möglich gehalten, dass ein unbekanntes Virus weite Teile unserer Welt aus den Angeln heben würde? Wer hätte darauf gewettet, dass die Vereinigten Staaten, „the land of the free“, schon bald von einem irrlichternden und gefährlichen Populisten via Twitter regiert werden würden? Dass es Anfang 2021 einen Sturm von einem wildgewordenen Mob auf das Kapitol in Washington, D.C., geben könnte? Dass unsere britischen Nachbarn die EU verlassen? Dass in der Ukraine – und damit mitten in Europa – Krieg wahrscheinlicher scheint als Frieden? Wer hielt es vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ernsthaft für möglich, dass wir plötzlich vor der Frage stehen würden, ob man Griechenland abwickeln könne, wie den sterbenden Greißler ums Eck? Man braucht keinen Abschluss in Zeitgeschichte, um festzustellen: Der Blick in die jüngere Vergangenheit ist nicht gerade das, was uns Lust auf Zukunft macht. Das Dumme an solchen Gedankenspielen: Apokalypse nervt, sie quält und sie lähmt. Und erlebten wir nicht auch Jahrzehnte des Wohlstands in Österreich, Jahrzehnte des friedvollen Miteinanders in Europa (mit Ausnahme des schrecklichen Kriegs am Balkan), und gelang es uns nicht gerade in den vergangenen Jahrzehnten, den Hunger in der Welt und die Kindersterblichkeit maßgeblich zu reduzieren? Diese Tatsachen vor Augen, stelle ich mir immer wieder die Frage, ob das Gerede vom Weltuntergang nicht einfach auch ein verdammt alter Hut ist. Das Ende ist nah! So hieß es in der Vergangenheit schließlich schon zu oft. Der deutsche Journalist Malte Henk machte sich die Mühe, einige angekündigte Weltuntergänge der Vergangenheit aufzuschreiben.
Mit dem Ausbruch der Pest im 14. Jahrhundert etwa wähnten viele Menschen in Europa das Ende der Zeit gekommen. Die Zeugen Jehovas erwarteten bis zum Jahr 1975 knapp neun Mal den Beginn des Weltuntergangs. 1997 dann der Massenselbstmord einer Sekte in den USA. Die Geschichte war kompliziert: Der Guru brauchte ein Ufo, doch an Bord gelangte nur, wer sich zuvor suizidierte. Im Mai 2012 sagten bei einer Umfrage in 21 Ländern immerhin ganze acht Prozent der Befragten, sie rechneten mit dem Ende der Welt noch im selben Jahr. Dann der Maya-Kalender und das angebliche Ende im Juni 2020. Auch schon vorbei und überlebt. All diese Offenbarungen mit den tatsächlichen Bedrohungsszenarien der heutigen Zeit gleichzusetzen verbietet sich natürlich. Aber sind sie nicht auch Ausdruck einer gewissen Angstlust, die auch heute wieder um sich greift? Warum sind wir so verdammt stark darin, uns zu fürchten? Und warum glauben wir in diesen Augenblicken der Krise lieber an die Apokalypse statt an Utopien? Wäre nicht der Moment der Krise genau der richtige Zeitpunkt und ein Ausgangspunkt, um von einer besseren Zukunft zu träumen?
Als der englische Schatzkanzler Thomas Morus im frühen 16. Jahrhundert seine Vision von Utopia verfasste, darin von der Gleichheit der Menschen schrieb und feudale Vorrechte literarisch abschaffte, hätten Utopie und Wirklichkeit kaum weiter auseinanderliegen können. England war zu dieser Zeit stark von sozialer Ungleichheit geprägt. Es herrschte extreme Armut in der Bevölkerung. Die Menschen bettelarm, wenig gebildet und geknechtet. Und doch: Mit dem Aufkommen des Humanismus, dem Zeitalter der Menschen, waren die Horizonte plötzlich offen. Eine andere Welt schien möglich.
Vielleicht ist es also doch auch so, dass Krisen unsere Fantasie beflügeln können. Vielleicht ist Hoffnung eine Quelle, die gerade auch im Dunkeln fließt. Daran schließt auch eine Erfahrung an, die nicht nur ich persönlich immer wieder mache, sondern die vermutlich jede und jeder auf die eine oder andere Weise schon erlebt hat: Gerade in Krisensituationen gelingt es uns Menschen, ungeahnte Kräfte zu mobilisieren, ein hohes Tempo zu gehen, mit voller Energie und mit letztem Einsatz zu versuchen, möglichst viele Dinge gemeinsam zum Positiven zu verändern – Dinge, die zuvor aus guten Gründen oder einfach aus Gewohnheit und „weil es immer schon so war“ noch unmöglich waren. Als klar war, dass das Virus die Insel Österreich nicht verschonen würde, als sich die Intensivstationen in Italien und Spanien rasch füllten und erste Pflegewohnhäuser in Frankreich und Belgien zu Corona-Clustern wurden, viele Menschen in weiterer Folge verstarben, da ging es mir im ersten Moment vermutlich wie den meisten anderen in unserem Land. Ich verspürte großes Unbehagen. Ich wusste nicht, was uns erwarten würde. Ich wusste aber von Beginn an, dass uns diese Krise ganz grundlegend verändern wird. Ich fürchtete diese Veränderung mehr als das Virus selbst. Während der ersten Tage verfiel ich in eine große Passivität. Ich starrte auf die Ereignisse, verfolgte die Nachrichten, als würde ich Zeuge einer großen Naturkatastrophe. Gebannt von den Naturgewalten, die freigesetzt werden. Unfähig, darauf zu reagieren. Damit beschäftigt, zu verarbeiten, was sich gerade vor meinen Augen abspielte. Rückblickend war dieser Moment, der eine gefühlte Ewigkeit zurückliegt, vielleicht auch jener Augenblick, an dem ich zuletzt tief Luft holen konnte – nicht wissend, was als Nächstes alles passieren würde, aber überzeugt, dass wir auch als Hilfsorganisation massiv gefordert sein werden. Es war in gewisser Weise ein letztes Luftholen und Durchatmen vor dem Sprint, der vor mir lag. Nicht ahnend, dass es sich nicht um einen Kurzstreckenbewerb, sondern um einen Ultramarathon handeln würde.
Augenblicke wie diesen habe ich schon mehrfach erlebt. Der Moment, in dem sich ein Schalter in mir umlegt. Raus aus der Passivität, rein ins Tun. Irgendwas tun – sei es, um etwas zu verhindern oder etwas anderes zu ermöglichen, oder sei es nur, um das Gefühl niederzuringen, dass ich dem Geschehen um mich herum hoffnungslos ausgeliefert bin. Deshalb beginne ich zu laufen. Schnell zu laufen. Wie Forrest Gump im gleichnamigen Film. Ich beginne Möglichkeiten zu sehen, wo andere die Gefahr wähnen. Ich sehe Chancen, wo andere zur Vorsicht mahnen. Ich bewege mich, wo andere erstarren. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Vielleicht daran, dass ich in den vergangenen Jahren mit jeder Krise – ganz gleich, wie groß sie war, ob im Job oder im Privaten – auch die Erfahrung gemacht habe, dass in der Krise eben nicht nur das Risiko größer und die Gefahren mehr werden, sondern auch die Chancen und Möglichkeiten. Plötzlich sind Dinge möglich, die zuvor unverrückbar und in Stein gemeißelt waren. Unsere Gesellschaften werden durch Regelwerke zusammengehalten. Sie geben uns Stabilität und Orientierung. Sie geben uns Struktur. Doch in Krisen gehen viele dieser Regeln über Bord, sind hinderlich und störend. Ich verstehe, dass das sehr vielen Menschen Angst macht. Doch ich glaube, es kann auch sein Gutes haben, weil in einem Regelvakuum zugleich immer etwas Neues entstehen kann.
Das Gerede von der „Krise als Chance“ nervt. Und es ist auch zu banal. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Zu gut weiß ich, dass Krisen für viele Menschen immer auch existenzbedrohend sind, Schmerz, Leid und bittere Armut bedeuten. Egal ob Krieg, Klima-, Corona- oder Wirtschaftskrise. Aber vielleicht sind wir oft erst dann imstande zu handeln, wenn wir zu verlieren glauben, was uns wichtig ist, wenn viel auf dem Spiel steht und wir uns klar darüber werden, dass es nicht mehr viele Gelegenheiten gibt, um das Ruder noch herumzureißen und die Segel neu zu setzen. Vielleicht gibt es ohne Krise überhaupt kein Happy End!
Doch was bedeutet das für das Hier und Jetzt – in einer Phase, in der uns dämmert, dass die größte aller Utopien – die Mär von einem unendlichen Wachstum auf einem endlichen Planeten – nicht hält? Viele sehen bereits das Zeitalter des Anthropozäns gekommen. Ein neuer Epochenbegriff wird populär. Er besagt, dass der Horizont, vor dem wir handeln, nicht mehr offen ist. Humanismus war Verheißung. Anthropozän ist Abgesang. Der Hinweis, dass wir uns mit Riesenschritten den planetaren Belastungsgrenzen nähern. Mit der Ausbeutung der Natur, der fortschreitenden Industrialisierung und mit der Globalisierung hat der Mensch begonnen, die Regeln, nach denen dieser Planet tickt, selbst zu verändern. Die Klimakrise ist real! Und wir wissen es seit langer Zeit. Anders als im Fall der Corona-Krise kündigt sich diese Katstrophe bereits seit Jahrzehnten an. Die Fakten liegen schon lange auf dem Tisch. Seit der Konferenz von Rio im Jahre 1992 ist klar: Der Punkt, an dem die Gleichgewichts- und Reparatursysteme von Flora und Fauna nicht mehr funktionieren, ist bald erreicht. In Paris verpflichteten sich 2015 alle Staaten der Welt zum Klimaschutz, definitiv ein historischer Moment, doch den Worten und Dokumenten von damals hinken die Taten bis heute dramatisch hinterher.
Ich glaube, die einfache Erkenntnis, dass unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht möglich ist, beginnt erst langsam einzusickern. Nicht nur in die Köpfe der Politikerinnen und Politiker, sondern auch in unser aller Köpfe.
Stéphane Hessel beschäftigt sich in seinem Buch „Engagiert euch!“ unter anderem mit der Erkenntnis, dass der Schutz der Natur ebenso wichtig sein muss wie die Wahrung der Menschenrechte. Für die Zukunft sieht er demnach die Rechte der menschlichen Person und der Natur als gleichberechtigt nebeneinander. Doch noch immer haben wissenschaftliche Fakten erstaunlich wenig Einfluss auf unser Handeln. Das Leid, dass infolge der Pandemie keine Billigflüge mehr möglich waren, überwiegt. Noch. Wir schließen die Augen und hoffen, dass es schon nicht allzu heiß, dass die Meere nicht allzu stark steigen werden. Warum sollte morgen nicht mehr funktionieren, was gestern noch kein Problem war?
Doch vielleicht gibt es auch für diese Krise ein Happy End. Krisen sind Zeiten, in denen Menschen mehr als sonst bereit sind, geliebte Gewohnheiten und über Generationen Gelerntes zu hinterfragen – „das System“, vielleicht auch sich selbst. Neue Gedanken, neue Ideen können wachsen, Kräfteverhältnisse können sich verändern, was gestern noch Nische war, irritierend und seltsam wirkte, kann morgen schon Mainstream sein. Wer heute „Klimakrise“ sagt, der kann auch „Fridays for Future“ sagen. Wer heute vor einer polarisierten und unsolidarischen Gesellschaft warnt, der kann auch von der großen Welle der Hilfsbereitschaft berichten, die wir seit Ausbruch der Pandemie erleben. Tausende neue Freiwillige meldeten sich in der Corona-Krise allein bei der Caritas. Nachbarinnen und Nachbarn gehen füreinander einkaufen. Kinder schreiben Briefe an alte Menschen, selbst dann, wenn es nicht die eigenen Großeltern sind. Die überwiegende Mehrheit geht diszipliniert durch diese Zeit, auch wenn sich mit zunehmender Dauer der Krise Erschöpfung und Müdigkeit, Gereiztheit und Empörung breitmachen. Wir halten Abstand und bleiben uns dennoch innerlich nahe.
Ja, wir stehen in vielerlei Hinsicht an einem Scheideweg. Aber es liegt an uns, das Gute zu erkennen, darauf aufzubauen und es zu stärken. Das ist uns historisch immer wieder gelungen. Es ist nicht bequem, es ist oft mühsam, anstrengend und sogar zeitweise frustrierend. Und vieles spricht dafür, dass es auch in absehbarer Zukunft ungemütlich bleibt. Doch das Match ist offen. Es geht um die Frage, für welche Richtung wir uns entscheiden. Welche Dinge wir stärken, auf welcher Seite wir stehen wollen.
Gerade die Erfahrung der Corona-Krise zeigt uns, dass so vieles möglich ist, wenn auf den ersten Blick nichts mehr geht. Papst Franziskus warnte bereits im Jahr 2013 vor einer „Wirtschaft, die tötet“, und wurde dafür stark kritisiert. Wenige Monate später schrieb er in einer Botschaft zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass „der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, nicht der Drang nach Macht oder Profit“. Galt für Jahrzehnte das Primat der Wirtschaft über die Politik, so waren Regierungen plötzlich aufgrund der Pandemie in der Lage, (auch schmerzliche und extrem weitreichende) Entscheidungen zu treffen, die zuvor unter Hinweis „auf die Märkte“ niemals möglich gewesen sein sollen. In diesem Zusammenhang ist für mich völlig unverständlich, dass ausgerechnet jene Unternehmen und Konzerne wie Amazon & Co., die am stärksten von der Krise profitieren, nach wie vor kaum Steuern zahlen. Das muss sich ändern.
Wir alle haben gelernt, dass das Tun und Lassen von jeder und jedem einen großen Unterschied machen kann. Was oft floskelhaft daherkommt, haben wir in der Pandemie ganz intuitiv verstanden: Vermeintlich kleine Handlungen wie regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen können Einfluss auf die weltweite Entwicklung einer Pandemie und damit auf unsere eigene Gesundheit und unser Leben haben. Dass das Kleine oft im Großen mündet, ist eine Erfahrung, die ich in meiner Arbeit häufig mache. Veränderung fängt oft im Kleinen an, mit einem Gedanken, einem Wort, einem Posting, einem ersten Schritt, aber vor allem mit dem Überwinden von Ängsten, mit Dialog, Zuhören, Geduld und Begegnung.
Diese Erfahrung kann uns keiner mehr nehmen. Sosehr all die Maßnahmen während der Krise auch immer von oben herab verordnet wurden, so steckt doch im Händewaschen, im Maskentragen, ja sogar im Abstandhalten eine selbstermächtigende Erfahrung – nämlich die, dass es nicht egal ist, wie ich mich verhalte. Dass es um Eigenverantwortung geht und um gemeinsame Verantwortung für unsere Nächsten, die in einer globalisierten und digitalisierten Welt viele tausende Kilometer entfernt leben können. Ich bin überzeugt: Diese Erfahrung ist es, die wir für unsere eigene und für die Zukunft unserer Kinder brauchen – gerade dann, wenn es um die Rettung des Klimas, der Demokratie und letztlich des friedlichen Zusammenlebens und somit auch um die Rettung unser aller Lebensgrundlagen geht.
Wir werden dazu an der einen oder anderen Stelle unsere Komfortzone verlassen, liebgewonnene Gewohnheiten ablegen und uns auf Neues einlassen müssen. Mit Sicherheit. Es wird uns alles andere als leichtfallen, wir werden uns gewaltig anstrengen müssen und wir werden lernen, mit Unsicherheiten und Ängsten besser umzugehen, resilienter und widerstandsfähiger zu werden. Die Pandemie ist geradezu ein Lehrstück, um das Leben mit dieser Ungewissheit geduldig zu üben und daraus laufend zu lernen.
Während der Corona-Krise habe ich die für mich überraschende Erfahrung gemacht, dass gerade alte Menschen – also die Hochrisikogruppe Nummer eins – oft gelassener auf das Virus reagierten. Ein hochbetagter Herr aus unserem Pflegewohnhaus in Breitenfurt sagte: „Ich habe in meinem Leben so viele Krisen und sogar Krieg und große Not erlebt, wir werden auch diese Krise überstehen.“ Er verlor eine Angehörige, als in Europa die Spanische Grippe wütete, er überlebte den Zweiten Weltkrieg und er machte die Erfahrung von Entbehrung und bitterer Armut im Österreich der Zwischen- und Nachkriegszeit.
Mit der Pandemie wurde eine globale Bedrohung für viele von uns zum ersten Mal nicht nur als Erkenntnis, sondern auch als simultanes Ereignis und als kollektives Schicksal spürbar. Selten zuvor war uns so bewusst: Wir sitzen alle im selben Boot. Und das ist eine gute Nachricht. Eine Nachricht, die Gutmenschen Hoffnung geben sollte. Und allen anderen im Übrigen unbedingt auch. Vielleicht wird das Jahr 2020 irgendwann in der Zukunft nicht mehr als „Krisenjahr“ beschrieben werden, sondern als ein Jahr der Wende. Als jener Moment in der Geschichte der Menschheit, in der Staaten nach anfänglichen Abschottungstendenzen und nationalstaatlicher Kraftmeierei weltweit begannen, verstärkt zu kooperieren – zuallererst im Kampf gegen die Pandemie, später aber auch im Kampf gegen die Klimakrise und schließlich im gemeinsamen Einsatz für eine Welt ohne Armut und Hunger. Vielleicht wird das Jahr 2020 irgendwann einmal als jenes Jahr gelten, in dem den Menschen weltweit zu dämmern begann, dass sie etwas und sich selbst verändern müssen, um eine gemeinsame und gute Zukunft auf diesem Planeten zu haben. Das ist naiv? Keinesfalls, denn vielleicht werden spätere Generationen über uns einmal sagen, dass wir die Zeichen der Zeiten spät, aber doch noch rechtzeitig erkannt haben, dass das, was uns half, die Pandemie zu besiegen – diese gemeinsame Kraftanstrengung und dieses gemeinsame Engagement –, uns letztlich dabei helfen sollte, der Klimakrise die Stirn zu bieten oder den Hunger in der Welt endlich erfolgreich zu überwinden. Vielleicht werden die aktuellen Krisen irgendwann als jener Punkt in der Geschichte der Menschheit gelten, an dem wir uns grundsätzlicher mit der Frage zu beschäftigen begannen, wie ein gutes Leben in Sicherheit für möglichst alle Menschen auf dieser Welt möglich sein könnte.
Ob das tatsächlich so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt: Das Gerede vom „nahen Ende“ ist was für Anfänger. Wenn das Unvorstellbare in den vergangenen Jahren in so kurzer Zeit plötzlich Wirklichkeit werden konnte, dann kann auch das Gegenteil davon in den nächsten fünf Jahren in die Welt kommen. Wo Dystopie möglich ist, ist auch Raum für Traum und Utopie – und Raum für Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen.