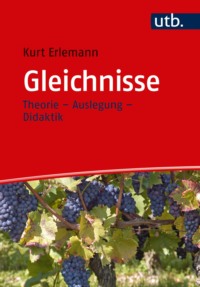Kitabı oku: «Gleichnisse», sayfa 2
1.4 Vergleichende Textformen1
Rund um die Gleichnisforschung sind einige Fachbegriffe vorab zu klären. Mehr als hundert Jahre verzweigter Forschungsgeschichte über verschiedene Fachdisziplinen hinweg führten zu uneinheitlichen Begriffsdefinitionen, so etwa die vergleichenden Textformen selbst und Jülichers formkritisch motivierte Bestimmung von Gleichnistypen.2 Andere Begriffe, wie Bildhälfte, Sachhälfte, ‚Sache‘, Sachebene, Bildwort und Gleichnisdiskurs, sind kritisch zu prüfen (→ 1.5; 2.1.3).
1.4.1 Parabel / Gleichnis / Parömie
Der Begriff Parabel (gr. parabolḗ) ist vom griechischen Verb parabállein abgeleitet, was daneben stellen, vergleichen meint. Verglichen werden in der Parabel zwei ursprünglich unabhängige Größen oder Wirklichkeitsbereiche, die durch bestimmte Merkmale vergleichbar erscheinen (z. B. menschliche Alltagswirklichkeit und Wirklichkeit Gottes in den Reich-Gottes-Gleichnissen).
Parabel ist im Neuen Testament der gängigste Terminus für bildhaft-vergleichende, fiktionale Rede. Sie kann morphologisch äußerst unterschiedlich ausfallen; die Palette reicht von klassischen Gleichnissen über Rätselworte und Weisheitssprüche bis hin zu Vergleich und Denkspruch. So betrachtet, ist parabolḗ ein umfassender, dem biblischen Sprachgebrauch adäquater Sammelbegriff. Ihm entspricht im Deutschen der Sammelbegriff Gleichnis, wie er auch in diesem Buch Verwendung findet. Von Jülicher werden die Begriffe Parabel und Gleichnis nicht als Sammelbezeichnung verwendet; er differenziert vielmehr zwischen Gleichnis, Parabel und anderen Gleichnistypen (→ 2.1.3; 2.5.1).
Definition: Parabel / Gleichnis ist ein Sammelbegriff für bildhaft-vergleichende, fiktionale Texte aller Art (Rätselwort, Sprichwort, Vergleich, Gleichnis u. a.).1
Parömie (gr. paroimía) ist das johanneische Pendant zu parabolḗ und bedeutet Rätselrede, Sprichwort (Joh 10,6; 16,25.29). Der Begriff impliziert die Deutungsbedürftigkeit der Rede. Der Gegenbegriff lautet parrhesía (offener, mutiger ‚Klartext‘, Joh 16,29). In diesem Band gelten die Parömien nicht als eigenständige Textform; sie werden den Identitätsgleichnissen zugeordnet (→ 2.1.3e; 2.5.7).
Definition: Parömie ist der johanneische Ausdruck für Gleichnis. Der Begriff charakterisiert die gleichnishafte Rede Jesu als deutungsbedürftige Rätselrede.
1.4.2 Fabel / Mythos / Deklamation
Mit dem Gleichnis teilt die Fabel Kürze, Fiktionalität, Anschaulichkeit, analogischen Charakter, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel der Plausibilisierung umstrittener Inhalte.1 Der grundlegende Unterschied ist die fehlende Realistik insbesondere der Tierfabel, was sie in die Nähe anderer surrealer Textsorten, wie Traum und Allegorie, rückt (→ 2.5.7c). Jülicher definiert die Fabel als
die Redefigur, in welcher die Wirkung eines Satzes (Gedankens) gesichert werden soll durch Nebenstellung einer auf anderm Gebiet ablaufenden, ihrer Wirkung gewissen erdichteten Geschichte, deren Gedankengerippe dem jenes Satzes ähnlich ist. [Das heißt für ihn:] Die Mehrzahl der parabolaí Jesu, die erzählende Form tragen, sind Fabeln wie die des Stesichoros und des Aesop.2
Während Gleichnisse eine religiöse Dimension haben, fehlt diese bei den Fabeln.
Definition: Eine Fabel ist eine fiktionale, bildhaft-vergleichende, bisweilen surreale Kurzgeschichte, die eine allgemeine, oft moralische Lebensweisheit vermittelt.
Ebenfalls im Bereich des Surrealen bewegt sich der Mythos.3 Der Duden definiert den Mythos als
Sage und Dichtung von Göttern, Helden und Geistern [der Urzeit] eines Volkes [bzw. eine] legendär gewordene Gestalt od. Begebenheit, der man große Verehrung entgegenbringt.4
Surreal wirken Mythen, da sie etwa Naturmächte personifizieren und Götter in Menschengestalt wunderbare Dinge tun lassen. Seit der Neuzeit werden auch biblische Wundergeschichten als Mythen gedeutet. – Mythen teilen mit Gleichnissen Fiktionalität, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel, eine bestimmte Wirklichkeitssicht plausibel zu machen. In dieser Wirklichkeitssicht spielen Götter eine gewichtige Rolle. Gleichwohl fallen Mythen, wie auch die Fabeln, wegen ihrer Surrealistik und anderer Merkmale aus der weiteren Betrachtung heraus.
Definition: Ein Mythos zeigt mittels einer vorgeschichtlichen, legendenhaften Erzählung über Götter und Menschen den Ursprung der geltenden Weltordnung auf.
Die Deklamation ist die formkritisch und textpragmatisch nächste Analogie narrativ ausgestalteter (Alltags-)Gleichnisse.5 Declamationes (lat.) sind antike, fiktionale Fallbeispiele für angehende Anwälte und sollen deren Argumentations- und Urteilsfähigkeit verbessern. Die Deklamation ist Teil eines Plädoyers vor Gericht und läuft auf einen im Sinne des Autors gelenkten, paradigmatischen Rechtsentscheid hinaus.6 Damit die Strategie gelingt, werden rhetorische Stilmittel zur Hörerlenkung eingesetzt, die denen narrativ ausgestalteter Gleichnisse ähneln. Hierzu gehören die Plausibilität des Geschilderten, perspektivische Darstellung zur Schaffung von Sympathie, suggestive Fragen, Emotionalität usw.7 Für die Nähe zu Deklamationen sprechen auch die juristischen Bildfelder in vielen Gleichnissen. – Paradigmatische Rechtsentscheide sind schon im Alten Testament eine beliebte Form, ein göttliches Rechtsurteil plausibel zu machen (vgl. 2 Sam 12; Jes 5,1-7). Deklamationen sind demnach nicht zwingend Prätexte für die neutestamentlichen Gleichnisse, sie unterstreichen aber deren rhetorischen Kontext.
Definition: Eine Deklamation ist ein fiktional-vergleichendes Fallbeispiel, das Rhetoren und Anwälten hilft, ihre Argumentationsfähigkeit, etwa für Plädoyers, zu steigern. Der textpragmatische Zuschnitt ist dem von Gleichnissen ähnlich.
1.4.3 Allegorie
Laut den römischen Rhetoren Cicero (106-43 v. Chr.) und Quintilian (35-100 n. Chr.) ist die Allegorie eine fortgeführte Metapher, die auf der Ähnlichkeit zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was gemeint ist, aufbaut.1 Dieses Verständnis wurde von Jülicher aufgegriffen.2 Die Definition von Allegorie wurde im Verlauf der Gleichnisforschung revidiert. Der Jülichersche Gegensatz von Gleichnis und Allegorie als ‚eigentlicher‘ bzw. ‚uneigentlicher‘ Rede wird heutzutage, unter Hinweis auf viele Mischformen sowie aufgrund der Neubestimmung der Metapher und einer präzisierten Begrifflichkeit, weithin abgelehnt (→ 2.2.1; 2.2.5).
Im vorliegenden Entwurf bezeichnet Allegorie erstens ein literarisches und nicht-literarisches Stilmittel. Allegorische Stilelemente begegnen in allen möglichen Textsorten, z.B in Romanliteratur und Lyrik, selbst in der Malerei oder in der Musik, sofern das eigentlich Gemeinte jenseits des wörtlichen Sinns bzw. des optischen oder akustischen Ersteindrucks zu suchen ist. – Zweitens gilt Allegorie nach wie vor als literarischer Gattungsbegriff. Charakteristisch sind die Dominanz verschleiernder Transfersignale (→ 1.5.9), erzählerische Surrealistik und Inkonzinnität. Allegorien sind nicht werbend-missionarisch, sondern subversiv-hermetisch ausgerichtet;3 das ist der einzige Gegensatz zu den Gleichnissen (→ 2.5.2a).
Definition: Die Allegorie ist ein literarisches oder nicht-literarisches Artefakt, das etwas anderes sagt, als es meint. Charakteristisch ist die systematische Verhüllung des Gemeinten durch Codierung und Chiffrierung. Allegorien sind tendenziell subversiv-hermetisch angelegt und richten sich exklusiv an eingeweihte Insider-Kreise.
1.4.4 Rhetorische Stilformen
Neben narrativ ausgestalteten Gleichnissen werden eine Reihe vergleichender, rhetorischer Stilformen, die den Umfang eines Satzes in der Regel nicht überschreiten, vorgestellt. Zu erkennen sind diese figurativen Stilelemente anhand des Ko- bzw. Kontextes, der ein wörtliches Verständnis nahelegt oder verhindert.1
a) Vergleich
1. Semantik
Literaturwissenschaftlich betrachtet, ist ein Vergleich eine „[s]prachliche, meist syntaktisch explizite Verknüpfung zweier mindest in einem Punkt ähnlicher Vorstellungen aus getrennten Sphären“, die durch eine Vergleichspartikel (‚wie‘, ‚als‘, ‚denn‘) bzw. durch Verben des Scheinens und Gleichens miteinander in Verbindung gebracht werden.1 Die Relation wie – so ist für Vergleiche typisch; sie kann aber auch fehlen. Ein Vergleich verbindet demnach zwei Wirklichkeitsbereiche und benennt dabei ausdrücklich den Vergleichspunkt zwischen beiden Bereichen.
Beispiele: Paul ist schlau wie ein Fuchs (Vergleichspunkt: schlau), Maria ist fleißig wie eine Biene (Vergleichspunkt: fleißig). Biblische Beispiele: Mt 13,43 (‚Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne‘), Mt 24,27 (‚Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein‘) und Jak 2,26 (‚Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot‘).
Voraussetzung für die Plausibilität des Vergleichs ist, dass Füchse sprichwörtlich schlau und Bienen fleißig sind bzw. dass diese Attribute sowohl vom Autor als auch den Adressaten des Vergleichs zuerkannt werden. – Ein Vergleich kann auch in Form einer Aufforderung stehen. In diesem Falle liegt eine vergleichende Mahnung vor.
Beispiel: Mt 10,16 (‚Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben‘).
Die sprichwörtliche Klugheit der Schlangen und die Ehrlichkeit der Tauben sind die Grundlage des Vergleichs und seiner Wirkung.
2. Intendierte Wirkung
Der Vergleich macht zum einen den Charakter bestimmter Personen wie Paul und Maria anschaulich (illustrierende Funktion), zum anderen verändert er die Sicht auf die beiden Wirklichkeitsbereiche: Sie haben mehr miteinander zu tun, als man denkt; wer Paul sieht, assoziiert zukünftig einen (schlauen) Fuchs, wer Maria sieht, assoziiert zukünftig eine (fleißige) Biene, wer Christinnen und Christen sieht, darf besondere Klugheit und Ehrlichkeit, wie man sie sprichwörtlich im Tierreich vorfindet, erwarten (poietische Funktion). Ob die intendierte Wirkung erreicht wird, hängt an der unmittelbaren Evidenz des Vergleichs – weniger im Sinne rationaler Beweisbarkeit (Bienen sind ‚fleißig‘, Schlangen sind ‚klug‘!), sondern im Sinne spontaner, affektiver Zustimmung. Das heißt, Vergleiche zielen nicht nur auf den Verstand, sondern auch auf das Herz.
3. Funktion
Die emotive Komponente macht vergleichende Sprache zu einem beliebten Argumentationsmittel. Biblische Vergleiche und andere bildhafte Textsorten finden sich daher regelmäßig im Kontext längerer Argumentation und unterstützen diese.
Beispiel: Der Vergleich Mt 10,16 motiviert Jesu Anweisungen für die Missionsarbeit (Mt 10,5-26) und zielt auf Emotionen (Angst, Sicherheitsbedürfnis).
4. Abgrenzung
Der Vergleich benennt ausdrücklich den Vergleichspunkt und muss daher nicht gedeutet werden – er ist eindeutig. Das ist der Unterschied zur Metapher. Im Unterschied zum ausgeführten Gleichnis überschreitet der Vergleich die Satzgrenze nicht und entwickelt auch keine Dramaturgie. Anders als beim Exemplum werden keine konkreten Größen aus der Natur oder der Historie zitiert.
Definition: Ein Vergleich verknüpft zwei unterschiedliche Wirklichkeitsbereiche im Hinblick auf einen klar definierten, einleuchtenden Vergleichspunkt, um etwas Unanschauliches bildhaft anschaulich zu machen.
b) Metapher
Die Metapher ist eine „herausragende Form der nicht-wörtlichen und übertragenen Rede.“1 Sie unterscheidet sich vom Vergleich durch ihren Deutungsbedarf. Dieser kommt dadurch zustande, dass der Vergleichspunkt verschwiegen wird. So bleibt offen, worauf die Aussage ‚Paul ist (wie) ein Fuchs‘, ‚Maria ist (wie) eine Biene‘ oder ‚Achill ist (k)ein Löwe‘ hinausläuft.2 Die Metapher ist nicht eindeutig; daher bleibt es der Interpretation der Hörer- bzw. Leserschaft überlassen, den oder die Vergleichspunkte zu entdecken.
1. Etymologie und Funktion
Der Begriff Metapher bedeutet etymologisch eine Übertragung (gr. metaphorá) bestimmter Merkmale eines Wirklichkeitsbereiches auf einen anderen.1 Literaturwissenschaftlich gesprochen, werden bei der Metapher Bedeutungsanteile von einem Bildspender auf einen Bildempfänger übertragen.2
Beispiel: Bei der Metapher ‚Achill ist ein Löwe‘ ist die Tierwelt der Bildspender und die Menschenwelt der Bildempfänger.
Die beiden ursprünglich unabhängigen Wirklichkeitsbereiche werden durch die Metapher (wie durch den Vergleich) zusammengebracht und in ihrer punktuellen Vergleichbarkeit bzw. Unvergleichbarkeit transparent. Hierdurch wird eine neue Sicht auf beide Bereiche ermöglicht: Es werden neue Sinnbezüge geschaffen, Erfahrungen gebündelt, die Alltagswirklichkeit neu gedeutet und Emotionen wachgerufen (po[i]etische Funktion). Damit leisten Metaphern einen wichtigen Beitrag zur Erschließung von Wirklichkeit: Neues, Unbekanntes wird durch Analogieschluss mit Bekanntem greifbar oder in seiner Differenz verstehbar. Diese Entdeckung führte in den 1960er Jahren zu einer Neubewertung der Metapher (→ 2.2.3b). Die Entdeckung der po(i)etischen Funktion der Metapher ergänzt die frühere Ansicht, Metaphern dienten lediglich der Illustration eines unanschaulichen Sachverhalts oder Geschehens. Wäre dem so, wäre die Metapher durch klares Benennen des Vergleichspunkts übersetzbar und ersetzbar:
Beispiel: ‚Achill ist ein Löwe‘ wäre dann etwa durch die Auskunft ‚Achill ist sehr stark‘ zu ersetzen – die ‚uneigentliche‘ Rede (Achill ist ja kein Löwe!) durch eine ‚eigentliche‘ Rede (Achill ist sehr stark).3
Die po(i)etische Funktion und die grundsätzliche Mehrdeutigkeit (Polyvalenz, bleibender Sinnüberschuss) lassen die Metapher indes unersetzbar erscheinen.
Metaphern zielen, gerade weil sie unübersetzbar sind, auf die Erfahrung, sie wollen in der Praxis des Lebens angewendet werden.4
Metaphorische Mahnreden wie Lk 10,2 (‚bittet den Herrn der Ernte‘) oder Mt 8,22 (‚lasst die Toten ihre Toten begraben‘) bestätigen die Aussage von Hans Weder.
2. Semantik und Morphologie
Die Metapher ist eine semantische, keine lexikalische Sprachform; sie ist nicht ein einzelnes Wort, sondern ein Begriff, der in Spannung zu einem anderen Begriff innerhalb eines Satzes steht.1 Die Spannung lässt sich auch als Konterdetermination (→ 1.5.7) zwischen Begriff und Kontext begreifen. Durch diese Spannung eröffnet sich „in unserem Sprachbewußtsein ein Bildfeld als virtuelles Gebilde“2, das gewisse Deutungsspielräume vorgibt.
Metaphern sind äußerst pluriform. Über die gemeinsame, als Satzphänomen und Konterdetermination gekennzeichnete Gemeinsamkeit gibt es für die Formulierung von Metaphern nahezu keine semantischen Grenzen.
Beispiele: ‚Achill ist (k)ein Löwe‘ ist als Aussagesatz ebenso metaphorisch wie die Komposita Luftschiff, Drahtesel, Redefluss, Elbflorenz oder die Alltagsmetapher Wasserhahn. Metaphern können auch in Genitivverbindungen stehen (vgl. ‚Mauer des Schweigens‘, ‚am Ende der Schlange‘, ‚Himmel voller Geigen‘ oder biblisch ‚Frucht der Buße‘ [Mt 3,8]). – In metaphorischer Spannung können in einem Satz auch Substantiv und Attribut (vgl. ‚wässrige Herbstluft‘, ‚bleierne Schwüle‘), Substantiv und Prädikat (vgl. ‚der Himmel weint‘, ‚die Sonne lacht‘ oder biblisch ‚wir rühmen uns der Bedrängnisse‘ [Röm 5,3]) oder Subjekt und Prädikativum (vgl. johanneische Ich-bin-Worte) stehen.3 Poetische Neubildungen wie ‚Seelenlandschaft‘, ‚blaues Klavier‘4 oder ‚der Himmel fließt in steinernen Kanälen‘5 erweitern das Spektrum enorm. Metaphorische Mahnreden nutzen das Potenzial der Metaphern, um Aufforderungen emotional zu intensivieren (biblische Beispiele: Mt 8,22; Lk 10,2).
3. Lexikalisierung und Wirkung
Aus ursprünglich kühnen Metaphern werden mit der Zeit usuelle, geprägte, konventionalisierte bzw. lexikalisierte Metaphern.1 Eine neu in die Sprache eingeführte Metapher und damit eine neu entdeckte Analogie zwischen zwei Wirklichkeitsbereichen wirkt fremd, überraschend, aufrüttelnd, kühn und sorgt für einen deutlichen Zugewinn an Wirklichkeitserfahrung.
Ein Beispiel ist die paulinische Redeweise ‚ich rühme mich der Trübsale‘ und Ähnliches (Röm 5,3; 2 Kor 11,30; Gal 6,14; vgl. Jak 1,10). Dass sich jemand negativ konnotierter Sachzusammenhänge ‚rühmt‘, erscheint fremd, verdeutlicht aber den sachlogischen Zusammenhang zwischen Evangelium und Kreuzestheologie.
Neben der Bibel produziert insbesondere die Lyrik immer wieder kühne Metaphern. Auch hier ist die Unersetzbarkeit metaphorischer Redeweise offenkundig. Bei häufiger, langfristiger Verwendung verlieren Metaphern freilich das Moment von Überraschung und Fremdheit und werden Teil des normalen Sprachgebrauchs. Der metaphorische Charakter wird nicht mehr bewusst wahrgenommen.
Beispiele: Sohn Gottes, Luftschiff, Glühbirne, Zebrastreifen, Drahtesel.
4. Bedeutungsspielraum und Polyvalenz
Metaphern sind grundsätzlich bedeutungsoffen und polyvalent. Das bedeutet, sie können ihre Bedeutung je nach Kontext und Hörer- bzw. Leserschaft wechseln.
Beispiel: Die biblische Metapher ‚Weinberg‘ verweist nicht immer auf das Volk Israel (so expressis verbis im Weinberglied Jes 5,1-7). ‚Weinberg‘ meint in Mt 20,1-16 eher die Welt insgesamt, in Mk 12,1-12 ein besonderes Erwählungsprivileg. Selbst in ein und demselben Text kann ‚Weinberg‘ Unterschiedliches bedeuten; in Mt 20,1-16 lässt sich in ihm, je nach Deutungsrahmen, die Welt, die Gemeinde oder Israel als Missionsgebiet früher Christen sehen. – Ein weiteres Beispiel findet sich unter → 3.3.1.
Für wen der Hausherr, König oder Sämann in neutestamentlichen Gleichnissen steht, ist längst nicht eindeutig.1 Die vom Autor intendierte Bedeutung der Metapher ergibt sich in der Regel durch den Ko- oder Kontext. Hinzu kommen der Verstehens- und Erwartungshorizont der Hörer- bzw. Leserschaft. Mit veränderten Verstehensbedingungen und Leserschaften ändert sich oft die Bedeutung. Metaphern haben im Unterschied zu Vergleichen einen bleibenden Sinnüberschuss, der sie für die Rezeption reizvoll (aber auch schwierig) macht (→ 3.3).
5. Zur Sprachkraft der Metapher
Die Frage der Sprachkraft der Metapher wird kontrovers diskutiert. Können Metaphern lediglich eine neue Sicht auf die (ansonsten unveränderte) Wirklichkeit vermitteln1 oder auch Wirklichkeit konstituieren?2 Hintergrund der Debatte ist die dogmatisch-theologische Frage nach der Qualität die Gleichnisrede Jesu: Ist sie lediglich ein Augenöffner, ein Appell an die Herzen oder ist sie Offenbarungsrede im Sinne eines Sprachereignisses, in dem Gottes Reich nicht nur zur Sprache kommt, sondern zugleich Wirklichkeit wird (→ 1.5.11; 2.2.3a; 2.5.4d)?
6. Abgrenzung
Wie der Vergleich kennt die Metapher keine Dramaturgie, erzählende Elemente fehlen. Der Unterschied zum Vergleich liegt nicht in der fehlenden Vergleichskopula, sondern darin, dass das tertium comparationis unterdrückt wird.1 Im Gegensatz zum Gleichnis weist die metaphorische Mahnrede einen direkten Hörerbezug (Verwendung der 2. und 3. Person) auf; Elemente einer narratio mit ausgeprägter Dramaturgie fehlen. Im Unterschied zur Chiffre wird der Bildempfänger genannt.
Definition: Die Metapher verknüpft bildhaft zwei unterschiedliche Wirklichkeitsbereiche miteinander und ermöglicht so die Erschließung von Unbekanntem durch Bekanntes. Da der Vergleichspunkt unterdrückt wird, ist die Metapher deutungsbedürftig und polyvalent und hat dadurch einen bleibenden Sinnüberschuss.