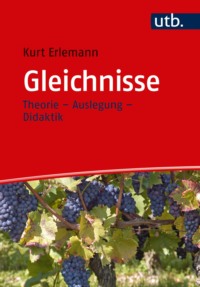Kitabı oku: «Gleichnisse», sayfa 8
b) Fiktionalität und Pseudorealistik
Von Tropen abgesehen, teilen Gleichnisse als weiteres gemeinsames Merkmal die Fiktionalität. Die Texte bieten erfundene Konstellationen, Situationen und Begebenheiten, die dem Anspruch allgemeiner Plausibilität genügen; der Inhalt des Textes ist realitätsnah. Durchbrochen wird die Plausibilität mitunter durch verfremdende Elemente (Extravaganzen). Die Realitätsnähe des Geschilderten erweist sich hierdurch als Pseudo-Realistik. Eben diese bildet die Brücke zwischen der erfahrbaren Alltagswelt und der prinzipiell unzugänglichen Welt Gottes (Deutungsebene), die Analogien und Unterschiede zur Alltagswelt zugleich aufweist.1
Beispiele: Extravagant ist die überschwängliche Freude des Vaters des verlorenen Sohnes Lk 15,11-32, ebenso die Vernichtung der Stadt der unwilligen Hochzeitsgäste im Hochzeitsgleichnis Mt 22,1-14 und der Erlass einer astronomischen Schuld im Schalksknecht-Gleichnis Mt 18,23-35. Was extravagant ist, bemisst sich an der Kenntnis der antiken Lebensumstände (Realien).
Eine Ausnahme bilden Naturgleichnisse: Sie sind nicht frei erfunden, sondern bieten plausibel erscheinende Naturvorgänge oder natürliche Zusammenhänge in typisierter Form. In diesem Falle liegt der Fokus ausschließlich auf Analogien zwischen Erzähl- und Deutungsebene; Differenzen werden ausgeblendet.
c) Transfersignale
Dass Gleichnisse überhaupt als analogische Texte wahrgenommen werden, ist, neben der Vertrautheit mit dem Genre als solchem, auf Transfersignale zurückzuführen (→ 1.5.9). Diese können die tiefere Bedeutung der narratio klar benennen, sie lediglich andeuten oder sie sogar verschleiern. Der Anteil klärender, andeutender und verschleiernder Signale ist von Text zu Text unterschiedlich. Je höher der Anteil nur andeutender oder gar verschleiernder Signale ist, desto größer der Deutungsbedarf bzw. der ‚allegorische‘, hermetische Charakter des Erzählten. Allegorien als Textgattung zeichnen sich durch das weitestgehende Fehlen klärender Transfersignale aus (weiter → 2.5.2a).
Klärende Transfersignale sind z. B. der Hinweis auf das ‚Reich Gottes‘ in Einleitungsformeln; weiterhin religiöse Termini und Anwendungen. Andeutende Transfersignale sind geprägte, aber polyvalente Metaphern wie Ernte oder Weinberg, sodann Weckrufe wie Mk 4,9parr., weiterhin zeitgeschichtliche Anspielungen wie Mt 22,7 sowie Extravaganzen. Verschleiernde Transfersignale sind Chiffren, ungeprägte bzw. kühne Metaphern sowie surreale Züge, wie sie häufig im Kontext apokalyptischer Visionen zu finden sind (Dan 2 und 7; Apk 6; 9; 12 u. a.).
d) Pointe und Vergleichspunkt(e)
Zwischen Bildspender und Bildempfänger bzw. zwischen dem geschilderten Vorgang und der Deutungesebene gibt es einen oder mehrere Vergleichspunkte. Diese sind im Falle narrativ ausgestalteter Gleichnisse der gemeinsamen Zielaussage (Pointe) zugeordnet. Die Erschließung und Formulierung der Pointe ist für die Gleichnisexegese von entscheidender Bedeutung (→ 3.1; Beispiele in Kapitel 4).
2.5.2 Gleichnis und Allegorie / Metapher
Das Verhältnis von Gleichnis und Metapher / Allegorie ist ein Dauerthema der Gleichnisforschung (→ 2.1; 2.2.3). Im vorliegenden Entwurf gestaltet es sich so:
a) Gleichnis und Allegorie – ein Gegensatz?
Der Allegorie-Begriff wurde von Hans-Josef Klauck 1978 kritisch revidiert (→ 2.2.5). Auf seinen Erkenntnissen gründen die folgenden Überlegungen.
1. Allegorie als problematischer Begriff
Gab für Jülicher die Allegorie das Feindbild seiner Gleichnistheorie ab, hat sich das Allegorie-Verständnis im Verlauf der Gleichnisforschung radikal gewandelt (→ 1.4.3; 2.1.3g). Allegorisierung gilt heute als positiv zu wertender Prozess (→ 2.2.5b; 2.5.5b). Da der Begriff allegorische Elemente missverständlich und negativ vorgeprägt ist, wird er durch den Ausdruck Transfersignale ersetzt.1 Die gattungskritische Einordnung eines Textes als Allegorie unterliegt strengen Kriterien.
2. Allegorie als Stilelement
Die Entgegensetzung von Allegorie/Metapher vs. Gleichnis/Vergleich ist hinreichend widerlegt (→ 1.5.12; 2.1.1f.; 2.2.1). Die Beobachtung von Allegorien jenseits der Bibel (Romane, Lyrik, Musik, bildende Kunst), lässt Allegorie als Stilelement subversiv-hermetisch ausgerichteter Genres mit dem Zweck erscheinen, das im Kunstwerk Gemeinte kunstvoll zu chiffrieren bzw. zu verschleiern, um es ausschließlich mit dem Verstehenscode vertrauten Insidern zugänglich zu machen.
3. Allegorie als Extremfall vergleichender Rede
Vom letzten Satz und von Klaucks Neuansatz (1978, → 2.2.5) her stellt sich die Allegorie als Extremfall vergleichender Rede dar, in der klärende und andeutende Transfersignale weitestgehend fehlen und verschleierende Transfersignale (→ 1.5.9; 2.5.1c) dominieren.1 Die damit angezeigte, subversiv-hermetische Tendenz unterscheidet Allegorien grundsätzlich von den werbend-missionarisch ausgerichteten Gleichnissen. Hierin besteht ihr eigentlicher Gegensatz. Biblische Allegorien finden sich als Baustein prophetischer und apokalyptischer Visionen (vgl. Dan 2 und 7; Apk 6; 9; 12 u. a.).2 – Eine Tabelle verdeutlicht das Verhältnis von nicht-vergleichendem Text, Gleichnis und Allegorie anhand des Verhüllungsgrades. Die Tabelle zeigt den graduellen, fließenden Übergang zwischen den Formen:3

b) Gleichnis als erweiterte Metapher?
Gleichnis und Metapher sind bildhafte Sprachformen und bringen eine unanschauliche Sache anschaulich auf den Punkt. So ermöglichen sie eine neue Sicht auf die Alltagswirklichkeit; insofern sind beide Sprachformen poetisch (→ 2.2.3c). Ein Gleichnis freilich ausschließlich von seiner Metaphorizität her zu definieren, übersieht die bleibenden Unterschiede zwischen Metapher und Gleichnis (→ 2.2.4): Metaphern können lediglich Analogien oder Differenzen zwischen Bildspender und Bildempfänger aufzeigen, Gleichnisse können beides zugleich; sie sind narrative Texte, die zwar mit Metaphern arbeiten, denen aber eine ganz andere Dynamik eigen ist. Zudem lassen sie unterschiedliche textpragmatische Strategien erkennen (weiter → 2.5.7).1
Beispiele: Das Ich-bin-Wort ‚Ich bin das Licht der Welt‘ (Joh 8,12) macht auf eine Analogie zwischen Christus und Licht aufmerksam. Die Metapher ‚Achill ist kein Löwe‘ unterstreicht den Unterschied zwischen beiden Bereichen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) zeigt die Ähnlichkeit, aber auch die Differenz zwischen Gott und einem ‚normalen‘ Vater.
2.5.3 Poetische Rhetorik, rhetorische Poetik
Rhetorik und Poetik vergleichender Texte wurden lange Zeit als sich ausschließende Alternative gehandelt. Der vorliegende Entwurf sieht keinen Gegensatz zwischen rhetorischer und poetischer Bestimmung der Gleichnisse, sondern sich gegenseitig ergänzende Aspekte.
a) Textbeobachtung: Kontextuelle Einbindung
Gleichnisse und Metaphern sind Teil antiker Kommunikationsgeschehen zwischen einem Autor, seinen Adressaten und einer bestimmten Ausgangsfrage bzw. -situation.1 Gleichnisse sind regelmäßig Teil längerer Argumentation, heben diese auf eine andere, bildhaft-narrative Ebene und befördern durch Einsatz spezieller textpragmatischer Mittel wie Fiktionalität, (Pseudo-)Realistik, Spiel mit Emotionen und Bildfeldern, Identifikation und konkurrierenden Verhaltensmustern das Argumentationsziel. Anders gesagt: Die Poetik von Gleichnissen und Metaphern sind in einen rhetorisch-argumentativen Kontext eingebunden.
Gleichwohl gibt der Autor durch die Metaphorik nur eine Deutungsrichtung vor. Innerhalb des Deutungsrahmens bzw. Verstehenshorizonts erfolgt die Deutung je und je neu durch die Rezipienten. Die Polyvalenz der Metaphern und Bildfelder sowie die Dynamik der narratio sorgen für einen bleibenden Sinnüberschuss. Intention und Interpretation ergänzen einander zum Akt der Sinngebung.
b) Verhältnis von Rhetorik und Poetik
Sind Gleichnisse rhetorische oder poetische Formen? Die Alternative erweist sich bei näherem Hinsehen als Scheinalternative. Gleichnisse sind bildhaft und fiktional, arbeiten mit Metaphern und zielen auf emotionale Zustimmung. Das macht sie zu poetischen Sprachformen: Sie verbinden Altes mit Neuem (Mt 13,52), lassen die Welt mit anderen Augen sehen, indem sie Analogien zwischen einzelnen Wirklichkeitsbereichen aufzeigen (z. B. zwischen Gottes Wirklichkeit und menschlicher Hochzeitsfeier).
Die Poesie ist jedoch kein Selbstzweck, sondern regelmäßig Teil längerer Argumentation. Gleichnisse fungieren als plausibles und emotional ansprechendes Argument (‚Werbung um die Herzen‘).1 Durch das Mittel (pseudo-)realistischer narratio heben sie die Sachargumentation auf eine andere Ebene; die unumstrittene Plausibilität des bildhaft Geschilderten provoziert Zustimmung, die auf die kontextuelle, nicht-bildhafte Argumentationsebene zu übertragen ist.
Die Zwischenstellung analogischer Redeweise zwischen Rhetorik und Poetik ist bereits bei Quintilian angelegt.2 Das bestätigt die kompositionskritische Beobachtung, dass Poesie und Argumentation einander zugeordnet sind.3 Metaphorische Rede hilft, unmetaphorische Argumentation persuasiv auf den Punkt zu bringen, frei nach dem Motto: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Beispiele: Die Auskunft der Bergpredigt: „Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben“ (Mt 6,15) gewinnt durch das Schalksknecht-Gleichnis Mt 18,23-35 eine narrative Ausgestaltung. Diese lässt die Motivlage des Spruchs deutlich werden und sorgt so für unmittelbare Plausibilität. Dasselbe gilt für den programmatischen Spruch Lk 19,10: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“; er wird durch die Gleichnisse vom Verlorenen (Lk 15) konkret und nachvollziehbar (himmlische Freude als leitende Motivation).
Der aus metaphorischer Rede resultierende Deutungsbedarf spielt den Ball des Verstehens den Adressaten zu; sie haben die Freiheit und die Aufgabe, das Gesagte zu deuten (→ 2.2.6d). Ob dies gelingt, hängt von der Bereitschaft ab, sich in die Nachfolge Jesu zu begeben, sprich: das Herz für die göttliche Perspektive zu öffnen (vgl. die synoptische Parabeltheorie Mk 4,10-13parr.). Insofern haben die Gleichnisse eine esoterische Tendenz: Sie bieten Sonderwissen für diejenigen an, die sich auf den Weg Jesu und die nahe basileía Gottes einlassen. Genau hierzu laden die Gleichnisse ein; hierin liegt ihre missionarisch-werbende Ausrichtung.4
2.5.4 Wirkung und Sprachkraft
Dieser Theorie-Aspekt hat seit der ‚metaphorischen Wende‘ intensivere Beachtung gefunden (→ 2.2.3; 2.4.2). Die Erkenntnis, dass Gleichnisse und Metaphern die Sicht auf den Alltag verändern, ist seither common sense. Umstrittener ist die Ansicht, Gleichnisse seien performative ‚Sprachereignisse‘ (→ 2.2.3d; 2.4.6).
a) Textbeobachtung: Polarisierende Wirkung
Die Evangelisten bezeugen die polarisierende Wirkung der Gleichnisse. So unterscheidet die synoptische Parabeltheorie Mk 4,10-13parr. zwischen Insidern und Outsidern, zwischen Menschen, die ins Geheimnis der Gottesherrschaft eingeweiht sind, und Verstockten, die nicht eingeweiht sind und denen die Gleichnisse als Zugangscode rätselhaft bleiben. Das Winzergleichnis Mk 12,1-12 bezeugt, dass Jesus mit seiner Gleichnisrede teilweise auf erbitterten Widerstand stieß. Die ambivalente Rezeption der Gleichnisse kommt dem Vollzug des Endgerichts in erster Instanz gleich, das heißt: Gleichnisse haben eine eschatologisch-kritische Funktion.1 Das angekündigte Weltgericht als zweite Instanz ratifiziert lediglich am Ende der Zeit das bereits feststehende Urteil. Die Gleichnisse hatten keine zwingende Beweiskraft und waren kein missionarischer Selbstläufer; das erklärt für die Evangelisten, weshalb Jesus zu weiten Teilen abgelehnt wurde (→ 4.5.2e).
b) Veränderung der Wirklichkeitssicht
Gleichnisse und Metaphern verändern die Weltsicht, stellen Verhaltensmuster in Frage und öffnen ein ‚Fenster zum Himmel‘. Damit sind sie poetisch. Weiterhin sind sie dank ihrer Erzähltechnik dazu geeignet, Widerstände gegen die göttliche Wirklichkeit mit ihrem Anspruch auf Geltung und Umsetzung zu überwinden (→ 2.5.7). Wesentlich ist die Plausibilität der narratio, die das strittige Thema spielerisch auf eine vordergründig unverfängliche und unumstrittene Ebene führt.
Beispiele: Das Sämanngleichnis Mk 4,3-9 provoziert die Frage der Jünger nach dem Sinn der Gleichnisse (V.10-13). Das Gleichnis von den bösen Winzern Mk 12,1-12parr. lässt die Ablehnung der Angesprochenen erkennen (V.12). Die Hirtenrede Joh 10,1-18 erzeugt Streit unter den Zuhörern (V.19, gr. schísma). Mk 12,37 und Lk 19,48 signalisieren Zustimmung des Volkes zu den Worten Jesu.
Demnach sind Metaphern und Gleichnisse kein Mittel zwingender Beweisführung; sie werben vielmehr um Zustimmung und sind auf Glauben aus (‚Werbung um die Herzen‘). Sie laden dazu ein, sich die göttliche Perspektive auf die Welt und die Menschen anzueignen; sie zwingen nicht dazu. Dank ihrer Sprachkraft können sie Umdenken (gr. metánoia), Glauben und heilvolle Verhaltensänderung in Gang setzen. Damit sind sie eine adäquate Sprachform der Mission. Wer sich nicht auf sie einlässt, an dem vollzieht sich das Endgericht gleichsam in erster Instanz.1
c) Angemessene Rede von Gott
Auch mit Blick auf das Gottesbild sind die Gleichnisse die Sprachform der Wahl: Sie sprechen von Gott, ohne ihn festzulegen. Sie reden menschlich von Gott, ohne ihn zu vermenschlichen. Sie entsprechen mit ihrer Dynamik dem dynamisch agierenden Gott Israels. Gleichnisse lassen sich nicht in starre Dogmatik überführen; sie sind eher einem an den Rändern ausfransenden Puzzle zu vergleichen, das bei aller Vergleichbarkeit die bleibende Differenz Gottes wahrt. Gleichnisse machen Analogien und Differenzen zwischen Gott und Welt gleichermaßen bewusst. Hierin liegt ihr hermeneutischer Vorzug, ihre theologische Sprachkraft. Daher verstoßen sie auch nicht gegen das alttestamentliche Bilderverbot (→ 2.2.3e).
d) Das Gleichnis als ‚Sprachereignis‘?
Die Rede vom Gleichnis als ‚Sprachereignis‘ ist zu kritisieren: Die Wirkung der Gleichnisse ist empirisch nicht fassbar. Die Behauptung, sie ließen die Welt neu verstehen und Gottes Reich faktisch Wirklichkeit werden, betont, apologetisch motiviert, die Einzigartigkeit Jesu und seiner Verkündigung. Die Gleichnisse erzählen von Gott und seiner Herrschaft, sie realisieren sie aber nicht. ‚Sprachereignisse‘ sind Gleichnisse nur, sofern sie bei den Adressaten eine heilvolle Veränderung bewirken. Außerdem haben vergleichende Texte einen bleibenden Sinnüberschuss; ihre Deutungsoffenheit ermöglicht immer neue Rezeptionen.1
2.5.5 Grundlagen der Gleichnisauslegung
Wissenschaftliche Gleichnisexegese setzt voraus, dass Gleichnisse und Metaphern deutungsbedürftig und deutungsfähig sind. Dieser Auffassung wurde und wird in der Gleichnisforschung teilweise widersprochen: Gleichnisse seien grundsätzlich klar, eindeutig, ‚eigentliche Rede‘ (Jülicher; → 2.1) oder wirkten unmittelbar, unabhängig vom Verständnis ihres historischen Entstehungskontextes (u. a. Vertreter der ästhetischen Autonomie und psychologischer Zugänge; → 2.2.6g).
a) Textbeobachtung 1: Rätselrede
Ausdrücklich gelten Gleichnisse als rätselhafte, deutungsbedürftige Rede im Kontext der synoptischen Parabeltheorie Mk 4,10-13parr. Die Jünger verstehen sie nicht und erhalten eine exklusive Allegorese (Mk 4,14-20parr.; Mt 13,36-43). Die Wortverkündigung Jesu gilt in den johanneischen Abschiedsreden generell als rätselhafte paroimía (Joh 16,25.29; vgl. Joh 10,6). Hinzu kommt die Beobachtung, dass Metaphern und Gleichnisse bedeutungsoffen (polyvalent) sind; die Identifizierung des oder der Vergleichspunkte wird den Rezipienten überlassen.
b) Textbeobachtung 2: Allegorisierung
Die hermeneutische Hochschätzung der mündlichen Gleichnisrede Jesu (→ 2.1.1; 2.2.3) sowie die negative Bewertung nachträglicher Allegorisierung und Verschriftlichung (Jülicher: Missverständnis, Verfälschung; Harnisch: Sprachverlust) geht von fragwürdigen Prämissen aus (Gleichnis-Idealtyp; Kontextfreiheit der ipsissima vox Jesu; → 2.2.1; 2.2.4). Auch mündlich vorgetragene Gleichnisse hatten einen situativen Rahmen, der auf den theologischen Bezugsrahmen hinwies und damit als Transfersignal fungierte: die Person Jesu und das Vorwissen um seine Bedeutung.1 Ein grundsätzlicher, hermeneutischer Unterschied zwischen mündlichen und schriftlichen Gleichnissen ist nicht erkennbar. Die nachträgliche Kontextualisierung der Gleichnisse, von Jülicher als verfälschende Allegorisierung kritisiert, ist historisch wie hermeneutisch positiv zu werten (→ 2.2.5b). Die verschriftlichten Gleichnisse sind authentische Modelle hermeneutisch angemessener Rezeption der ursprünglich mündlich vorgetragenen Gleichnisse Jesu.
c) Grundlagen der Gleichnisexegese
Folgendes ist zu berücksichtigen: Erstens, der bleibende Sinnüberschuss macht Gleichnisse und Metaphern unersetzbar. Gleichwohl sind sie als vergleichende Texte zu deuten. Zweitens, ihre Produktion und Rezeption sind nicht ohne vorgegebene Sprachkonventionen möglich.1 Um sie angemessen zu verstehen, sind die Verstehensvoraussetzungen der Rezipienten zu klären. Drittens, um der Gefahr von Allegorese zu begegnen, ist die Ermittlung der Pointe bzw. der Vergleichspunkte zwischen Bild- und Deutungsebene (im Falle von Metaphern des dominanten tertium comparationis) vorrangig. Viertens, zu ermitteln ist die Deutungsebene, auf die der Gleichnistext referenziert (Analyse von Transfersignalen).
Methodisch ergibt sich aus dem Gesagten die Verschränkung historischer und narrativer, rhetorischer und poetischer Betrachtungsweisen. Der jeweilige Textsinn eines Gleichnisses ist durch diachrone (historisch-sozialgeschichtliche, traditionsgeschichtliche, religionsgeschichtliche) und durch synchrone (kompositions- und redaktionskritische, textlinguistische, formkritische, textpragmatische) Methodenschritte zu erheben (→ Kapitel 3; Beispiele in → Kapitel 4).
d) Enttabuisierung von Allegorese
Das Verdikt gegen die Allegorese gilt als bleibendes Vermächtnis Jülichers (→ 2.1.4). Aufgrund der Revision des Allegoriebegriffs und aufgrund von Textbeobachtungen (Mk 4,10-20.34 u. a.) empfiehlt es sich, die Allegorese zu enttabuisieren – zumindest für Allegorien im strengen Sinne und für Gleichnisse mit hermetischer Tendenz. Wo klärende und andeutende Transfersignale weitestgehend fehlen, wie im Sämanngleichnis Mk 4,3-9parr. und anderen Naturgleichnissen, ist Allegorese, das heißt die Übertragung einzelner, dekorativer Erzählzüge, schon durch die synoptische Praxis legitimiert. Für alle anderen Gleichnisse gilt im Rahmen historisch-kritischer Exegese weiterhin die strenge Ausrichtung an der Pointe.
2.5.6 Der theologische Bezugsrahmen
Wovon handelt die Deutungsebene der Gleichnisse – von einer ‚Sache‘ im Sinne Jülichers oder schlicht vom ‚Reich Gottes‘? Der Entwurf differenziert nachhaltig.
a) Zum Begriff ‚Sache‘
Die Deutungsebene der Gleichnisse enthält keine ‚Sache‘, die auf einen präzisen Begriff zu bringen wäre (→ 1.5.10; 2.4.8). Der Ausdruck theologischer Bezugsrahmen signalisiert, dass es um einen theologischen Zusammenhang geht, präziser: um einen Rahmen, der mehrere theologische Aspekte enthält.1 Diese lassen sich nur durch vergleichende Sprache vermitteln, denn sie beziehen sich auf eine transzendente, menschlicher Erkenntnis entzogene, himmlisch-göttliche Wirklichkeit, die nicht auf Gottes basileía einzugrenzen ist.2 Diese Rahmenmetapher ist nur bei einem Teil der Gleichnisse expressis verbis die theologische Bezugsgröße.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.