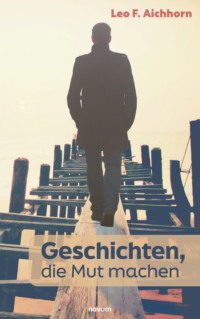Kitabı oku: «Geschichten, die Mut machen», sayfa 2
Johanna und Ludwig waren am Ende ihrer sonst so starken psychischen Kräfte angelangt und an eine therapeutische Hilfe war nicht zu denken. Nach dem zerbombten Elternhaus und den zweimaligen Übersiedlungen eines landwirtschaftlichen Unternehmens standen sie nunmehr wiederum vor dem Nichts. Sie kannten keine Menschen in diesem Ort und hatten deshalb auch keine Freunde, die ihnen mit aufmunternden Worten zur Seite hätten stehen können. Als die Kriminalabteilung der Gendarmerie feststellte, dass es sich bei diesem Brand um Brandstiftung gehandelt hatte, wurde Ludwig dieser Tat verdächtigt und stundenlang verhört. Verdächtigt wurde er, weil er sich vorher nach der Versicherungssumme erkundigt hatte, was objektiv gesehen als absoluter Schwachsinn bezeichnet werden kann. Wer zündet schon sein Haus an, wenn er der Meinung ist, dass es unterversichert ist. Für Ludwig, der stets um Redlichkeit bemüht war, brach eine Welt zusammen. Eine Welt, die es wirklich nicht gut mit ihm und seiner Familie meinte, die ihn permanent zurückwarf und seine Ehre zutiefst verletzte. Erst einige Wochen später konnten die Brandstifter ermittelt werden. Ein Knecht eines örtlichen Bauern war mit dem Pferdefuhrwerk in unmittelbarer Nähe des Hauses gewesen, als er zum Tatzeitpunkt zwei Buben im Alter von sechs und acht Jahren aus dem später brennenden Heustadel herauslaufen sah. Die minderjährigen Nachbarbuben gestanden gegenüber der Gendarmerie, dass sie von der Altbäuerin zu dem Brandanschlag angestiftet worden waren. Ludwig war damit zwar rehabilitiert, litt aber noch lange unter dem falschen Verdacht.
2 So wurde damals der Gemeindesekretär bzw. Amtsleiter genannt und sogar sein Sohn Josef hörte auf den Namen Schreiber Peperl.
Der Wiederaufbau
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war etwa ein Zehntel aller Wohnungen in Österreich zerstört und die Verkehrsinfrastrukturbauten und Produktionsmittel waren so schwer beschädigt, dass das Bruttoinlandsprodukt 1946 erst rund 60 Prozent von 1913 oder 1937 erreichte.3 Die Lebensmittelknappheit der breiten Masse, die mit 600 bis 800 Kilokalorien pro Person und Tag auskommen musste, führte zur Unterernährung der Bevölkerung.
1950 war die wirtschaftliche Situation durch die Kriegsereignisse immer noch trist. Nicht zuletzt durch den Verlust von Millionen Männern, die ihr Leben für einen gewalttätigen und sinnlosen Krieg gegeben hatten und nun beim Wiederaufbau in den von Krieg betroffenen Ländern fehlten. Dadurch musste ein beträchtlicher Teil der Arbeits- und Versorgungslast von den Frauen getragen werden. Erschwert wurde der Wiederaufbau durch die zerstörten Infrastrukturen und Industriebetriebe, die vornehmlich militärische Produkte erzeugten. Baumaschinen wie etwa ein Kran oder eine Mischmaschine waren nicht verfügbar. Die Ziegelindustrie musste neu aufgebaut werden und konnte den damaligen Bedarf nur sehr verzögert erfüllen. Deshalb wurden aus den Unmengen an Bauschutt von den zerbombten Gebäuden, brauchbare Ziegel herausgearbeitet, mit Maurerhämmern vom Mörtel befreit und wiederverwendet. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Menschen nach dem Krieg waren größer als das Elend, das sie zu bewältigen hatten. Getragen vom unerschütterlichen Glauben, dass sie das alles schaffen werden, packten sie an, wo immer „Not am Mann“ war. So stellten mehrere Nachbarn unentgeltlich ihre Bediensteten für den Wiederaufbau des Bauernhofes von Ludwig und Johanna ab und halfen dadurch mit, dass die Neuankömmlinge am Ende des Jahres wieder ein Dach über dem Kopf hatten. Johanna war nicht nur mit Kindererziehung und Hausarbeit beschäftigt, sondern auch als Kostgeberin für die helfenden Hände verantwortlich.
In derselben Gemeinde wie Ludwig und seine Familie waren kurz zuvor auch Karl und Anni gelandet. Die kinderlose Anni hatte den Hausbrand mitbekommen und sich sofort angeboten, sich um den sechs Wochen alten Martin zu kümmern. Für Martins Eltern war das gerade in der Zeit des Wiederaufbaues eine große Hilfe, zumal ein Baby mehr Aufmerksamkeit als laufende Kinder benötigt. Diese Obsorge wiederholte sich häufig, wodurch eine intensive und langjährige Freundschaft entstand. Der Zusammenbruch der Monarchie brachte es mit sich, dass der 1909 im böhmischen Pardubice geborene Karl nach Wien kam und dort seine Anni kennenlernte und ehelichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es die beiden nach Oberösterreich. Anni hatte den Beruf einer Schneiderin erlernt, war eine gepflegte, attraktive Frau und immer gut angezogen. Mit ihrer vornehmen Art versuchte sie eine Exklusivität zu vermitteln, die man eher Menschen am ehemaligen Kaiserhof zubilligen würde. Mit ihrer gewählten Sprache und ihrem vornehmen Gang unterstrich sie dieses Erscheinungsbild. Deshalb sagte sie auch immer, dass ihr Karl als Elektriker nicht zur Arbeit, sondern in den Dienst gehe. Von ihrer Eleganz blieb offenbar auch ihr Hausarzt nicht unberührt, der sie auch dann besuchte, wenn sie nicht krank war. Karl war von mittlerer Größe, sehr sympathisch und nicht arrogant.
Die ersten Jahre nach der Übersiedlung in die fruchtbare Niederung des Donauraumes waren für Ludwig und Johanna so etwas wie eine Herkulesaufgabe. Einerseits galt es die verwahrlosten Gründe wieder in einen ertragreichen Zustand zu bringen und andererseits die erforderlichen Bauarbeiten am Bauernhaus fertigzustellen. Für die Kinder blieb dadurch wenig Zeit. Andreas und Gabriele beschäftigten sich mit sich selbst, Martin schlief ohne Betreuung fest im Kinderwagen, sodass seine Mutter öfter Nachschau hielt, um sicherzugehen, dass es ihm gut ging. Obwohl das Leben am Land zu dieser Zeit höchst ungefährlich war, wurde Martin im Kinderwagen vom Haushund Strolchi „bewacht“. Er war von mittlerer Größe, kräftig gebaut und ließ nur Familienangehörige zum Kinderwagen. Hundemarken gab es nicht und sein Stammbaum war nicht belegbar. Aber auch ohne entsprechende Hundeschule wusste Strolchi, was an einem Bauernhof zu tun ist. Allerdings hatte er keine Freude mit uniformierten Personen. Der Briefträger Matthias war ein Mann wie zu Zeiten der Habsburger Monarchie. Er hatte einen großen Schnurrbart, einen aufrechten Gang und er trug seine Uniform, als würde er als Postbeamter über die gesamte Staatsgewalt verfügen. Was ja auch verständlich war, er überbrachte schließlich nicht nur Bescheide von Behörden, sondern wickelte auch den gesamten Geldverkehr ab, und Respekt gegenüber Uniformträgern hatten die Menschen so kurz nach dem NS-Regime irgendwie immer noch. Banken gab es ausschließlich in größeren Städten, Girokonten oder eBanking sollte es erst Jahrzehnte später geben. Wenn Briefträger Matthias zum Haus kam und Strolchi sah, beschimpfte er ihn als blöden oder hässlichen Hund. Gewiss, einen Preis für Reinrassigkeit und Schönheit hätte er nicht gewonnen, aber das wusste der treue Vierbeiner ja nicht. Als der Postbeamte eines Tages auch noch mit einer Fußbewegung andeutete, der Hund solle verschwinden, riss Strolchi die Geduld und er biss den Uniformträger in den Fuß. Das war ein Eklat. Wie kann ein dahergelaufener Hund einen hochangesehenen Beamten beißen? Ludwig und Johanna hatten große Mühe, Matthias zu beruhigen, wobei er weniger an seinen physischen Schmerzen litt als an der Verletzung seiner Autorität als Staatsbeamter.
Im zweiten Lebensjahr begann Martin zu laufen und war nur schwer unter Kontrolle zu halten. Krabbelstuben oder Kindergarten gab es nicht. Spielzeuge auch nicht und wenn, dann mussten sie aus Holz selbst gemacht werden. Vielfach diente einfach ein umgedrehter Radlbock, ein Schiebekarren mit Querlatten zum Transport von sperrigen Gütern wie Gras oder Heu, auf dem Martin saß und dessen frei laufendes Rad er drehte. Ein Stück Holz wurde als Auto umfunktioniert, das von den Kindern im Sandhaufen bewegt wurde. Unter den Christbäumen lagen keine Geschenke, sondern nur die Hoffnung auf bessere Zeiten und trotzdem strahlten die Kinderaugen im Glanz der Kerzenlichter.
Eines Tages entschwand Martin der Obhut von Krauterl Tante (die in den Krautbottich gefallene Tante aus Linz) und ging durch die offene Tür in den Pferdestall. Er näherte sich dem Pferd Bubi von hinten und hielt sich an dessen beiden Hinterbeinen fest. Ein Schlag mit einem seiner Beine hätte das junge Leben von Martin abrupt beendet. Aber Bubi blieb ruhig, als wüsste er, dass ihm keine Gefahr droht und er den Kleinen schützen muss. Die Krauterl Tante fiel beinahe in Ohnmacht, als sie Martin im Pferdestall entdeckte, und hatte keine Ahnung, wie sie Martin vom Pferd unbeschadet trennen sollte, ohne es zu erschrecken. Noch nie zuvor hatte sie eine so schwierige Entscheidung zu treffen gehabt. Mit dem Mut der Verzweiflung, jetzt ja keinen Fehler zu machen, ging sie mit ruhiger Ansprache in den Stall und brachte Martin wieder sicher heraus. Es war, als fiele ihr ein Stein vom Herzen. Nach einiger Zeit, als die Selbstvorwürfe über ihre unzureichende Aufsicht über Martin vergangen waren, war sie stolz über ihren Mut.
Wochen später waren Johanna und Hans, der mitgereiste Nachbarjunge vom Truppenübungsplatz, bei der Heuernte. Hans lud das Heu mit der Gabel auf und Johanna verteilte es geschickt, sodass eine hohe Heufuhre entstand. Martin spielte im Schatten eines großen Obstbaumes. Da der Weg nach Hause lang war, entschieden sich die beiden mit Martin auf dem Heuwagen Platz zu nehmen. Auf halbem Weg blieben plötzlich die Pferde stehen. Als nach dem dritten „Wia“ (Aufforderung an die Pferde zum Weitergehen) Bubi und Fritz immer noch standen, schauten sie hinunter und sahen, dass Martin von der Heufuhre gefallen war, zwischen den Pferden lag und sie deshalb stehen geblieben waren. Geschockt stieg Hans hinunter und holte den jungen Mitfahrer wieder an Bord. Dank der gutmütigen Pferde war nichts passiert. Bubi und Fritz waren offenbar deshalb gute Pferde, weil sie auch gut behandelt wurden. Wenn sie Ludwig im Stall abhängte, war ihr erster Weg zum Küchenfenster, wo sie von Johanna mit Würfelzucker verwöhnt wurden. 1953 gingen die beiden in den Ruhestand, da ab diesem Zeitpunkt ein Steyrer Traktor mit 30 Pferdestärken ihre Aufgaben übernahm.
3 https://www.mediathek.at/staatsvertrag/wiederaufbau/nachkriegswirtschaft/
Maschinen erobern die Landwirtschaft
Mit dem Traktor und seinen Einsatzmöglichkeiten änderte sich viel in der Landwirtschaft. Neben der höheren Leistung hatte diese Zugmaschine auch eine hydraulische Hebemöglichkeit und über die Zapfwelle mit ihrer Drehbewegung konnten Maschinen in Schwung gebracht werden. Damit konnten nunmehr Pflüge mit mehreren Pflugscharen und Eggen gehoben werden und man benötigte keine Räder mehr zum Wenden oder für den Transport. Darüber hinaus war das eiserne Pferd stärker und schneller. Je nach Motorleistung war ein Traktor bei der Feldarbeit um das 5- bis 10-Fache schneller als Pferde im Doppelgespann. Ein Traktor, vornehmlich aus der Werkstätte im oberösterreichischen Steyr, war zu dieser Zeit Ausdruck der Modernität und vielfach auch ein Prestigeobjekt. Häufig fuhren die Landwirte damit auch am Sonntag zur Kirche.
Auch Ludwig wollte dazugehören und kaufte 1953 einen Steyr Traktor mit 30 Pferdestärken (PS) und zwei Zylindern, während die meisten anderen Bauern im Ort sich mit einer 15-PS-Variante und einem Zylinder begnügten. Die neue Zugmaschine hatte noch keinen elektrischen Starter und musste daher mit einer Handkurbel gestartet werden. Das war schon ein Kraftakt samt Geschicklichkeit beim Start eines Dieselmotors. Denn der selbstzündende Motor benötigte eine sehr hohe Verdichtung im Zylinder und konnte ohne Dekompressor, der die Luft entweichen lässt und den Widerstand aussetzt, händisch nicht in Schwung gebracht werden. Erst bei entsprechender Umdrehung und dem Schließen des Entlüftungsventils entstand die erforderliche Kompression und der Motor sprang an. Bei sehr kalten Tagen im Winter musste der Selbstzündmechanismus im Zylinder durch ein „Brandl“ (einen Brandbeschleuniger) unterstützt werden. Die Inbetriebnahme der Traktoren der ersten Generation erforderte starke und geschickte Menschen, die vornehmlich aus der Männerwelt kamen. Erst später wurden die landwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer Batterie und einem elektrischen Starter serienmäßig ausgestattet. Da in den fünfziger Jahren noch kein Frostschutzmittel im Handel erhältlich war, musste in der kalten Jahreszeit das Kühlwasser der Traktoren nach Stillstand abgelassen werden. Im Alter von 12 Jahren vergaß Martin nach dem Einparken den Kühlwasserhahn zu öffnen. Als nach Tagen die Zugmaschine wieder in Betrieb gehen und Kühlwasser eingefüllt werden sollte, stellte sich das Unglück heraus. Das Wasser war gefroren und hatte den Motorblock gesprengt, wodurch Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangt war und eine Inbetriebnahme nicht möglich gewesen wäre. Martin war ziemlich zerknirscht, obwohl ihm seine Eltern infolge seiner jugendlichen Unerfahrenheit keine Vorwürfe machten.
Mit der Anschaffung dieser Zugmaschine war es nicht getan. Es mussten ein neuer Pflug und eine neue Egge angeschafft werden. Auch die Pferdeanhänger mit einer Deichsel und einer langen Wagenstange konnten nicht mehr benutzt werden. Daher kaufte Ludwig gebrauchte Achsen mit Rädern von demolierten Militärfahrzeugen und baute diese mit ebenen Bodenflächen und Bordwänden zu funktionsfähigen Traktoranhängern um.
Traktor und Anhänger waren die Universalgeräte in der Landwirtschaft und beschleunigten die Arbeitsprozesse gewaltig. Bei der Einbringung des täglichen Grünfutters für die Rinder und Schweine oder bei der Heuernte wurden nach der händischen Mahd zwei Zeilen mit dem Erntegut geschaffen, damit der Traktor samt Anhänger in der Mitte fahren konnte und die Landarbeiter links und rechts davon den Anhänger beladen konnten. Martin fuhr schon als 6-Jähriger mit dem Traktor so weit nach vorne, dass der Anhänger wieder im Bereich des Ladegutes zu stehen kam und das Heu oder das Getreide im kurzen Weg mit der Gabel aufgeladen werden konnte. Wegen seiner kurzen Beine musste er sich mit der Schulter am Ende des Fahrersitzes abstützen, um den langen Kupplungsweg durchtreten und den ersten Gang einlegen zu können. In dieser waagrechten Position verlor er den Überblick und sah nicht, was rundherum passierte. Erst als er die Kupplung wieder ausließ, er sich von der horizontalen in die vertikale Position brachte und der Traktor einen Sprung nach vorne machte, konnte er wieder steuernd eingreifen. Im Laufe der Jahre bekam Martin nicht nur längere Beine, sondern auch mehr Übung und wurde zum unverzichtbaren „Nachvornefahrer“, zum angesehenen Maschinisten, wie sein Vater Ludwig einer war.
Jahrhunderthochwasser 1954
Das Eferdinger Becken umfasst im Wesentlichen die Gemeinden Feldkirchen, Goldwörth, Walding und Ottensheim nördlich der Donau sowie Aschach, Pupping, Eferding, Alkoven und Wilhering südlich des Donaustroms. Seit Jahrtausenden wurde dieses Gebiet westlich von der Landeshauptstadt Linz vom längsten Strom Europas in unterschiedlicher Höhe überschwemmt. Daran hat sich die betroffene Landbevölkerung gewöhnt, da der Ertragsdruck in der Landwirtschaft früher noch nicht so hoch war wie heute. Die Donau hat durch ihre Hochwässer natürliche Retentionsräume in Form von großen und langen Gräben geschaffen, die kleinere Hochwässer auffingen und mit ihren Brackwässern und durch den Bewuchs von Stauden und Bäumen wichtige Rückzugsräume der dortigen Fauna bildeten. Durch das ebene Gelände im Eferdinger Becken verminderte sich die Fließgeschwindigkeit des Stromes und lagerte Sedimente in Form von Schlamm ab. Es entstanden äußerst fruchtbare Böden wie im Machland, Marchfeld und wie das in der Bibel als Paradies beschriebene Zwischenstromland, das Euphrat und Tigris im heutigen Irak eingrenzen. Im Jahr 1954 gab es im Eferdinger Becken entlang der Donau das Jahrhunderthochwasser. Tausende Hektar Wiesen und Ackerland wurden bis 3 m hoch überschwemmt.

Viele Familien wurden mit Schiffen von den Häusern abtransportiert, da ohne Strom und Trinkwasser selbst ein Wohnen im Obergeschoß nicht möglich war. Die Bauern schleppten ihre Rinder, Schweine und das Federvieh auf den Heuboden in der Annahme, dass sie dort sicher waren. Das war kein einfaches Unterfangen, denn welches Tier geht schon freiwillig aus dem Stall und dann noch über einen behelfsmäßig angelegten Aufgang in eine ihm unbekannte Umgebung. Hier waren Mensch und Tier in einem noch nie da gewesenen Ausmaß gefordert. Martin war mit seinen Geschwistern im Obergeschoß eingeschlossen, sah, wie das Wasser durch die Scheune in den Hof und von dort mit hoher Geschwindigkeit über die Hofausfahrt wieder hinausrann. Nur mehr zwei Stufen der Stiege ins Obergeschoß ragten aus dem Wasser. Der Vierjährige wollte unbedingt in das Wasser, weil er fälschlicherweise überzeugt war, schwimmen zu können. Dieses Bedürfnis erhöhte sich beträchtlich, als er seine Lederhose davonschwimmen sah. Ludwig blieb mit seinem Bediensteten Hans im Haus, um die Tiere zu versorgen. Damit dies möglich war, mussten sie ein Loch in die Feuermauer, die aus Brandschutzgründen das Wohn- vom Wirtschaftsgebäude trennte, machen, um zu den Haustieren zu gelangen. Johanna wurde mit ihren Kindern von der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Boot abgeholt und in die Nachbargemeinde gebracht, wo sie am höhergelegenen Ortsteil Tabor bei Bekannten Unterschlupf und Versorgung für die nächsten Tage erhielten.
Für Ludwig und Johanna war diese Überschwemmung mit 1,76 cm Wasserstandshöhe im Erdgeschoß nach dem zerbombten Haus, dem kurzen Intermezzo auf dem Truppenübungsplatz und dem Brandanschlag vor vier Jahren erneut ein „Keulenschlag“, der auch vitale Menschen depressiv werden lässt. Aber sie machten sich nach Abfluss des restlichen Wassers unverzüglich an die Arbeit. Das gesamte Haus musste rechtzeitig vom Schlamm befreit werden, da dieser nach seiner Austrocknung hart wie Beton wird. Ebenso waren die Wohnungsräume durch offene Fenster zu belüften und auf diese Weise zu trocknen, da es elektrische Trocknungsgeräte noch nicht gab. Die Fenster und Türen mussten ausgehängt werden, damit sie mit Wasser gewaschen und in der Sonne getrocknet werden konnten. In den Häusern und auf den umliegenden Wiesen und Feldern existierte ein fremder Geruch des fauligen Schlamms. In den zahlreichen kleinen Vertiefungen befanden sich Fischen, die den Abfluss des Hochwassers verpasst hatten und im Brackwasser verfaulten. Die Wiesen mussten umgeackert und mittels Grassamen neu angelegt werden, da die Graswurzeln keine Chance gegen den oft 10 cm dicken Schlamm hatten. Ebenso wurde auch auf den Feldern der Schlamm mit dem Pflug eingearbeitet, damit sie bald wieder befahrbar waren und bebaut werden konnten.
Auch das geliebte Motorrad, Ludwigs einziges Fortbewegungsmittel, stand bis über den Lenker im Wasser und war instandsetzungsbedürftig. Vorsorglich hatte er zwar seine 1.000er Panter (1.000 Ccm Hubraum) auf die Hobelbank in der Werkstätte gestellt im Glauben, da könnte es vom Hochwasser unbeschadet bleiben. Dem war aber leider nicht so und er hatte viel zu tun, um den Einzylinder mit langem Hubraum mit nur etwa 60 Umdrehungen pro Minute im Standlauf4 wieder in Fahrt zu bringen. Aber wie immer schaffte er auch diese Herausforderung mit viel Geduld und Ausdauer.
4 Die heutigen Bikes haben die 25-fache Umdrehungsgeschwindigkeit.
Die bescheidenen Bildungsmöglichkeiten
Im Jahr 1953 wurde in der 500-Seelen Gemeinde von Ludwig und Johanna eine neue Volksschule gebaut. Den Pflichtschulbesuch konnte man in Österreich bis in den 60er Jahren mit 8 Jahren Volksschule absolvieren. Erst später wurde mit dem polytechnischen Lehrgang die allgemeine Schulpflicht auf 9 Jahre verlängert und in der Folge der verpflichtende Besuch einer Hauptschule (als Sekundarstufe) nach dem vierten Volksschuljahr eingeführt. Wer eine Hauptschule besuchen wollte, musste am frühen Morgen mit dem Postautobus in den 6 km entfernten Nachbarort fahren und kam erst abends mit diesem wieder zurück.
Martin hatte eine große Freude, als er mit sechs Jahren in die Schule gehen und endlich lesen, schreiben und rechnen lernen durfte. So etwas wie einen Kindergarten gab es nicht und daher auch keine Vorkenntnisse für den Schulbeginn. Freudig erregt und angespannt machte sich Martin auf den Weg zum 300 m entfernten Schulgebäude. Die lederne Schultasche mit der hölzernen Federschachtel am Rücken marschierte er, entsprechend dem damaligen Rechtsgehgebot, am rechten Straßenrand der Schotterstraße im großen Bogen um den Mesnergarten, um zur Schulstraße zu gelangen. Normalerweise nahm er immer die Abkürzung durch den Mesnergarten, aber der erste Schultag war für ihn etwas Besonderes. So als würde er schon auf dem Weg zur Schule von den Lehrern für sein Verhalten benotet. Das Schulgebäude hatte zwei Schulklassen im Erdgeschoß und eine Schulklasse im ersten Stock, wo sich auch die Wohnung des Schuldirektors befand. Trotz der drei Schulklassen gab es nur zwei Lehrpersonen: eine junge Lehrerin und einen Lehrer, der gleichzeitig Schuldirektor war. Eine Hauptschulpflicht gab es im elften Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht. Außerdem waren die meisten Eltern der schulpflichtigen Kinder Landwirte oder bei solchen beschäftigt und sahen keine Veranlassung, ihren Kindern einen höheren Schulabschluss, als sie ihn selbst hatten, zu ermöglichen, da sie ja auch ohne diesen durchs Leben kamen.
Diese Einstellung führte dazu, dass drei von vier Schülern die 8-jährige Volksschule bis zu ihrem Ende besuchten. Mit zwei Lehrpersonen in zwei Klassen. Wie ging das?, werden sich heute viele fragen, die lediglich den Präsenzunterricht von einem Jahrgang in einer Klasse mit einer Lehrperson oder dem Teamteaching mit zwei Pädagogen sowie das Homeschooling kennen. Die junge Lehrerin unterrichtete in ihrer Klasse die Jahrgänge 1 bis 3 und der Direktor brachte den Schülern der Jahrgänge 4 bis 8 das Grundwissen bei. Die Lehrerin unterteilte die Jahrgänge in die Abteilung 1 mit den Schulanfängern und in die Abteilung 2 mit den Jahrgängen 2 und 3. Der Schuldirektor unterteilte wiederum seine Jahrgänge in die Abteilung 1 mit den Jahrgängen 4 und 5 und in die Abteilung 2 mit den Jahrgängen 6 bis 8. Während die Pädagogen die Schüler einer Abteilung unterrichteten, wurde den Schülern der anderen eine Aufgabe gestellt und umgekehrt. Das bedeutete, dass die Jahrgänge 2 und 3 sowie 4 und 5 zwei Jahre und die Jahrgänge 7 bis 8 drei Jahre lang im Wesentlichen dasselbe präsentiert bekamen. Der Unterrichtsstoff war wenig, jedoch die geistige Verankerung durch das mehrmalige Wiederholen dauerhaft. Wettrechnen war eine sehr beliebte Methode des Direktors, um kognitive Fähigkeiten und logisches Denken bei den Schülern herauszufinden, und beeinflusste auch die Mathematikbenotung. Dabei stellte er verbal eine Rechenaufgabe und wer sie am schnellsten gelöst hatte, lief mit dem Ergebnis zu ihm und bekam ein Hakerl oder eine Eins. Martin musste sich in dieser Disziplin nur selten geschlagen geben.
Die pädagogischen und didaktischen Methoden von damals unterscheiden sich erheblich von den heutigen. Jede Woche wurden zwei Schüler verpflichtet für den Klassendienst: Die Tafel musste gelöscht werden und im Winter waren Holzspäne zum Anzünden des Klassenofens zu hacken, Brennholz in die Klasse zu tragen und die Aschenlade war zu leeren. Vor Unterrichtsbeginn mussten täglich die „Klassendienstler“ in Ermangelung von Fließwasser frisches Wasser von einer Handwasserpumpe in einem Lavoir bereitstellen. Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, musste nach Schulschluss mindestens eine Stunde in der Klasse nachsitzen und irgendetwas abschreiben oder das Einmaleins auswendig lernen. Kleinere disziplinäre Vergehen wie Schwätzen oder Abschreiben ahndete der Direktor meist durch Schläge mit dem Lineal auf die Finger oder durch Ziehen an den Haaren.
Der Schuldirektor hatte in Geschichte nie über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und wenn die schrecklichen Kriegsereignisse trotzdem thematisiert wurden, beendete er die Diskussion mit dem Hinweis, dass die Schüler keine Ahnung davon hätten. Das war zwar richtig, aber kein Grund, nicht mehr darüber zu erfahren. Vielleicht war seine Zurückhaltung sogar besser, da den Schülern eine sehr subjektive Sichtweise vermittelt worden wäre. Augenscheinlicher wurde seine frühere politische Einstellung beim Turnunterricht. Geräteturnen war wegen der fehlenden Geräte nicht möglich. Statt Kastenspringen hüpften die Schüler laufend über ihre vorderen Kollegen, die einen „Bock“ machten. Begonnen wurde aber jede Turnstunde der Buben mit dem Antreten in einer Reihe und der Größe nach. Mit „Habt acht!“ und „Rechts um!“ ging es im Laufschritt rund um die Tische im Klassenzimmer. Dabei mussten die Schüler über den Haselnussstab, den der Direktor in einer Höhe von 50 bis 60 cm hielt, springen. Wer das nicht schaffte, bekam den „Herrn von Haselnuss“ zu spüren. Nur alle zwei Jahre gab es am provisorischen Fußballfeld eine Leichtathletik-Turnstunde, die Martin besonders liebte. Körperliche Ertüchtigung eigneten sich die Buben ohnedies auch in der einstündigen Mittagspause auf der „Blutwiese“ an, einer Wiese in Schulnähe, wo die Halbwüchsigen durch unblutige Raufereien ihre Rangordnung herstellten. Rangordnungen in Gesellschaften sind auch heute noch festzustellen. Allerdings weniger in Form von körperlicher Kraft, sondern die eher durch Bildungs- und Vermögensunterschiede, die vornehmlich durch Markenklamotten, Smartphones u. dgl. dokumentiert werden.