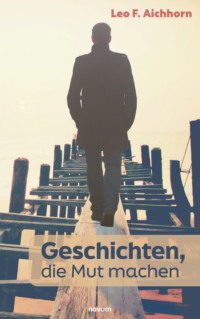Kitabı oku: «Geschichten, die Mut machen», sayfa 4
Kinderarbeit infolge Landflucht
Mit Beginn der 60er Jahre im 20. Jahrhundert erhielt die maschinelle Entwicklung in der Landwirtschaft eine noch nie da gewesene Dynamik. Die Traktoren wurden größer und bekamen drei oder vier Zylinder, die ersten Mähdrescher und Ladegeräte wurden auf Bauernmärkte mit Volksfestcharakter präsentiert und veränderten die landwirtschaftliche Arbeit enorm. Die Mähdrescher trennten schon am Feld die Getreidekörner vom Stroh. Die Ladegeräte transportierten das Heu, das Stroh oder die schweren Blätter von Zuckerrüben mittels einer „Pick-up-Vorrichtung“ und eines Förderbands auf den nachgezogenen Traktoranhänger. Vereinzelt waren schon Melkmaschinen im Einsatz und entleerten die Euter der Milchkühe ohne Handarbeit. Melklehrer wurden mit einem Schlag arbeitslos.

Die menschliche Arbeitskraft wurde zwar nicht zur Gänze, aber im hohen Maße durch halbautomatische Maschinen entbehrlich. Die Abwanderung der Landarbeiter in den produzierenden Sektor wurde insbesondere durch die starke Industrialisierung vorangetrieben. Der Glaube an das eigene Land und nicht zuletzt der Wiederaufbauplan ERP (European Recovery Programm – „Marshall-Plan“) der USA schafften ein Wirtschaftswunder namens „Golden Age“ in Europa. Nachdem sich die Kriegsindustrie in eine Technologie- und Konsumgüterindustrie umgewandelt hatte, tausende Autos von den Fließbändern rollten und die Fabrikarbeiter allein mit ihrem Urlaubsgeld in den Süden fahren konnten, war das Arbeiten in der schlecht bezahlten Landwirtschaft für die meisten keine Alternative mehr. Arbeiteten zu Beginn der 50er Jahre noch 33 Prozent5 der Erwerbstätigen im primären Sektor, so waren es knapp 60 Jahre später nur mehr 4,3 Prozent6, die Freude an der landwirtschaftlichen Arbeit fanden. Ohne die Industrialisierung der Landwirtschaft wäre die Industrielle Revolution nicht möglich gewesen, da nicht genug Hände und Köpfe für die Fabriken und Dienstleistungsbetriebe zur Verfügung gestanden hätten.
Dieser Strukturwandel stellte die Landwirte vor kaum bewältigbare Herausforderungen. Auch die aus dem Mühlviertel stammende Magd Manuela und der aus Mittersill angereiste Knecht Heinz verließen 1960 den Hof von Ludwig und Johanna, obwohl sie sich hier wohlgefühlt hatten. Manuela war groß, für eine Frau unheimlich kräftig, und hatte riesigen Spaß, wenn sie den wohl kernigen, aber kleineren Dienstbotenkollegen Heinz ihre überlegene Stärke etwa beim händischen Lufteinpumpen von Anhängerreifen zeigen konnte. Manuela war schon zuvor der Liebe ihres Lebens begegnet und gründete mit dem etwas älteren Herrn aus der übernächsten Gemeinde eine Familie. Auch für Heinz war es ein „herzlicher Abschied“, da auch er zu seiner Angebeteten zog und künftig sein Geld in einem Industrieunternehmen verdiente. Dieser personelle Abgang konnte nicht allein durch den maschinellen Einsatz kompensiert werden. Im selben Jahre beendete der adoptierte Sohn Andreas seine 8-jährige Pflichtschulzeit und trat als Landwirtschaftslehrling in den Dienst seiner Eltern. Für arbeitsintensive Zeiten wie etwa im Frühling das Vereinzelnen der zahlreich aufgegangenen Zuckerrüben- und Zichoriepflänzchen (Einkornsamen wurden erst später gezüchtet), das Aufklauben von maschinell freigelegten Zuckerrüben, Kartoffeln und dem von den Bäumen heruntergefallenen Mostobst im Herbst wurden Hausfrauen aus dem Ort als Tagelöhnerinnen engagiert. Später verstärkte noch Gabriele mit ihren Händen den Familienbetrieb, bevor sie und ihr älterer Bruder Andreas sich nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten umsehen mussten.
Große Erwartung hatten Ludwig und Johanna auf Martin gesetzt, der als ältester gemeinsamer Sohn als Hoferbe vorgesehen war und daher nicht früh genug mit der verantwortungsvollen Aufgabe eines Landwirtes vertraut werden konnte. Vor allem aber auch seine Geschicklichkeit beim Traktorfahren war Ursache für das nicht selten vorzeitige Ende des Schultages, wenn Johanna vormittags in die Schule ging und dem Direktor eröffnete, dass Martin zum Pflügen oder Eggen benötigt wird. Diesem Begehren kam der damalige Schuldirektor nicht ungerne nach, wurde doch sein Entgegenkommen am sonntägigen Stammtisch meist mit einem oder mehreren Gläsern Rotwein honoriert. Auch beim „Saustechen“ dachte man an die guten Beziehungen zur Schuldirektion und legte ein schönes Stück Fleisch für sie zur Seite. Die Frau des Schuldirektors, von allen Menschen in der Gemeinde als Frau Direktor angesprochen, nahm sich als Tochter eines Fleischhauers der weiteren Verarbeitung gerne an. An den Tagen ohne vorzeitiges Ende des Unterrichts wurde Martin zu Hause die Schultasche abgenommen und ihm die Tasche mit einem gewässerten Most, eingehüllt in ein nasskaltes Tuch zur Kühlung, ausgehändigt. Damit wurde er aufs Feld geschickt. Dort musste er mitarbeiten bis abends und fiel nicht selten erschöpft ins Bett.
Martin hatte oft nicht einmal Zeit, seine Hausaufgaben zu machen. Durch seinen leichten Schlaf stand er oft zu einer Zeit auf, wo noch Gäste anwesend waren, und legte sich wieder in das Bett. Nicht selten stand er um 2 oder 3 Uhr früh auf und machte bei Kerzenlicht seine Hausaufgaben. Erst danach konnte er wieder einschlafen. Schon mit sechs Jahren wurde Martin Ministrant und führte mit dem Pfarrer den liturgischen Dialog in lateinischer Sprache. Des Öfteren wurde er kurz vor 07:00 Uhr geweckt, wenn der Mesner zur Mutter lief und Martin als Ministrant für die tägliche Messe verlangte. Erst das 2. Vatikanische Konzil, das 1965 endete und u. a. den Priestern die Hinwendung zu den Kirchenbesuchern und den Dialog mit ihnen erlaubte, ermöglichte auch die Messfeier in der jeweiligen Landessprache. Damit wurden die Ministranten vom „kleinen Latinum“ befreit und der überwiegende Teil der Kirchenbesucher verstand erstmals, was hier eigentlich gebetet wurde. Ein ähnlicher Vorgang wie die Übersetzung der Bibel vom Lateinischen ins Deutsche durch Martin Luther. Für Martin kam diese Änderung zu spät, da er 1964 nach acht Jahren Kirchendienst ausscheiden musste. Andererseits beherrschte er die lateinischen Texte im Zwiegespräch mit dem Priester längst perfekt. An Wochentagen gab es nur stille Messen ohne Orgelmusik oder gesangliche Begleitung. Entsprechend der gotischen Architektur war es an Tagen mit geringem Sonnenschein in der Kirche sehr finster und die wenigen, meist älteren Frauen mit ihren dunklen Kleidern waren kaum sichtbar – und hörbar schon gar nicht. Es hatte etwas Gespenstisches. Um 07:30 Uhr war die Messe aus und Martin lief nach Hause, um sich vor dem um 08:00 Uhr beginnenden Schulunterricht noch schnell am Frühstückstisch zu laben.
Ministrant zu sein bedeutete nicht nur eine liturgische Verpflichtung bei einer Messfeier, sondern auch einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten anzugehören und für Gott und die Kirche etwas Positives zu leisten. Und alternative Gemeinschaften für Kinder und Jugendliche gab es in der kleinen Gemeinde ohnehin nicht. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten traten Martin und viele seiner Freunde der Katholischen Jungschar bei. Spielerisch und singend lernten sie die religiösen Werte kennen und wurden ermuntert, nach diesen Wertvorstellungen zu leben. Unvergesslich für Martin blieben ihre Aktivitäten, die von der Diözese Linz veranstaltet wurden. Einige Tage auf einer alten Burg im oberösterreichischen Kremstal wurden für alle 8- bis 10-Jährigen zum unvergesslichen Erlebnis. Die geisterhaften Nächte zwischen den Burgmauern, die nächtlichen und angsteinflößenden Entdeckungsmärsche durch den Wald sowie der Badeausflug über den bewaldeten Berg in die 12° Celsius kalte Steyr waren weitreichende Lernprozesse und unvergessliche Erlebnisse. Ebenso die Österreichische Jugend-Olympiade in der Steiermark, an der Martin mit seinem Freund Joachim teilnehmen durfte. Mehr als 2.000 Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren aus allen Teilen des Landes nahmen an den sportlichen Wettkämpfen mit großem Eifer teil. Die Jugendlichen schliefen in Zelten, wo sie sich auch von ihrem sportlichen Wettbewerben erholten. Martin und Joachim konnten sich mangels eines Trainers und mangels verfügbarer Trainingsgeräte nur für den 60 m-Lauf und im Schlagball vorbereiten, wo sie nicht so schlecht abschnitten. Im Schwimmen war Martin durch sein Donautraining ziemlich gut, als er auf dem dortigen Schwimmteich neben einer Ringelnatter seine Distanz bewältigte und schneller als sie war. Wie hoch dabei der Angstfaktor war, wurde nie erforscht.
Wenn allerdings saisonale Schwerstarbeit am Programm stand und mit den üblichen Personalressourcen nicht das Auslangen gefunden wurde, erwies sich die Großfamilie von Johanna als Glücksfall. Ihr älterer Bruder Edi und ihr jüngerer Bruder Hans halfen an Wochenenden, wenn der große Misthaufen auf die Felder auszubringen oder das Heu auf den Heuboden zu bringen war. Der Eisenbahner und der gelernte Glasermeister waren höchst motiviert und vermittelten das Gefühl, alles im Vorbeigehen erledigen zu können. Auch wenn ihr Gefühl mit der praktischen Umsetzung selten in Einklang zu bringen war. Der Eisenbahner war eher der Schlaue und etwas Schlitzohrige und hatte großen Spaß, wenn sich sein jüngerer Bruder ärgerte. So kam es schon manchmal vor, dass Edi beim Aufladen von Schweine- und Kuhmist zu schwungvoll war und sein Bruder „irrtümlich“ etwas Mist im Gesicht abbekam. Wobei dieser wütend schimpfte und sich der Missetäter heuchlerisch entschuldigte. Ähnlich war es beim Abladen von Heu von einer hohen Fuhre, wo Edi nicht immer die Einzugsvorrichtung des Heugebläses, sondern seinen Bruder am Kopf traf.
Hans war schon frühzeitig von seiner Frau, einer Wirtin am Stadtrand von Linz, geschieden und hatte keine Familie. Sein früherer Bezug zum Gasthaus qualifizierte ihn, bei Bällen und Hochzeiten im Obergeschoß den Getränkeausschank zu bedienen. Edi, der Eisenbahner, war ein guter Schriftführer und notierte die Getränke der Kellnerinnen für die spätere Abrechnung. Beide machten einen hervorragenden Job und delektierten sich auch am frisch gezapften Bier. Es wurde sehr spät und die beiden waren froh, dass sie im Wohnzimmer ihrer Schwester schlafen konnten, denn am Montag um 05:45 Uhr mussten sie den Postbus erreichen. Als Hans am frühen Morgen in die Küche zum Frühstücken ging und seinen Schwager Ludwig und seine Geschwister traf, konnten sich diese nicht mehr halten vor lauter Lachen. Das war für ihn unverständlich und machte ihn wütend. Damit entstand eine wechselhafte Steigerung von Wut auf der einen und Lachen auf der anderen Seite. Erst als sich Hans in den Spiegel sah, verstand er, warum die anderen einen Lachkrampf bekamen. Er war im Gesicht schwarz von Ruß, der aus dem Kaminloch kam und ihn aussehen ließ wie einen Rauchfangkehrer. Sein Schwager hatte am Tanzboden einen weiteren Ofen in Betrieb genommen und dazu das freistehende Ofenrohr im Wohnzimmer abmontiert. Durch das offene Kaminloch blies der Wind den Ruß in den Raum und schwärzte Hans so sehr, als hätte er alle Kamine in der Gemeinde gereinigt. Als sich das Gelächter legte und sich Hans beruhigt hatte, versuchte er seine Schuhe anzuziehen. Edi machte ihn aufmerksam, dass er die falschen Schuhe anhabe, nämlich jene von seinem Schwager Ludwig. Da unter der Sitzbank mehrere Schuhe standen, war Hans irritiert und zog seine eigenen Schuhe wieder aus und schlüpfte erst recht in jene von Ludwig. Als ihm auch dieser Versuch ausgeredet wurde, griff er intuitiv erneut, aber höchst verunsichert zu seinen Schuhen. Seine Verwirrung war perfekt. Dieses Spiel an unwahren Behauptungen und verständnislosen Entgegnungen dauerte an, und Hans wusste am Ende wirklich nicht mehr, welche Schuhe nun tatsächlich seine waren. Bis Johanna die Komödie mit klaren Worten beendete und ihre Brüder aufbrachen, um den Postbus gerade noch zu erreichen.
Ein besonderer Helfer in Zeiten mit Arbeitsspitzen und an Wochenenden zur Unterstützung der jugendlichen Kinder bei der Stallarbeit war Poschko. Poschko war ein groß gewachsener Mann aus Serbien, der im Zuge des Zweiten Weltkriegs in die Gemeinde von Ludwig und Johanna kam und dort eine Kriegerwitwe mit zwei Kindern kennen und lieben lernte. In seine Heimat wollte er nicht mehr zurückkehren. Seine Herkunft war ziemlich dubios, da er keinen Pass hatte und weder sein Geburtsdatum noch seinen Geburtsort kannte. Der damalige Gemeindesekretär schätzte sein Alter und stellte ihm eine Geburtsurkunde aus, damit er später eine österreichische Staatsbürgerschaft erhalten konnte. Einen Arbeitsplatz fand er in einem Ziegelwerk in der Nachbargemeinde, den der Führerscheinlose mit dem Fahrrad leicht erreichen konnte. Da niemand in seiner Umgebung Serbokroatisch sprach und er sich in Deutsch sehr schlecht verständigen konnte, war die Kommunikation mit ihm schwierig. Niemand wusste so richtig, ob seine auch nach Jahrzehnten noch schlechten Deutschkenntnisse an seiner geringen Lernleistung oder an seiner mangelnden Lernwilligkeit lagen. Ungeachtet dieses Mangels war Poschko ein Mann, der wie seine Partnerin gerne als Tagelöhnerin in seiner Freizeit bereitwillig am Bauernhof von Ludwig und Johanna anpackte. Als offensichtliche Motivation dafür konnte seine Liebe zu Schnaps, Zigarren und kräftigem Essen angesehen werden. Das ihm von Johanna heimlich zugesteckte Geld nahm er natürlich auch gerne entgegen.
An Wochenenden klopfte er bereits um 04:30 Uhr mit einer Stange an das Schlafzimmerfenster von Andreas und Martin, damit ihm geöffnet wurde. Da Andreas meist tief schlief und seinen Unterstützer nicht hörte, öffnete ihm meist Martin die Tür. Noch bevor er die Stallarbeit begann, verlangte er Schnaps und Zigarren mit der Begründung: „So viel schlegte Magen, muss ma Stampal trinken, elpa zwei!“ Diese Versorgungswünsche waren verständlich und mit 1/8 Liter Schnaps oder Weinbrand und mehreren Zigarren leicht erfüllt, da der Stallgeruch schon schwer zu ertragen war. An Samstagen waren auch die Schweineställe zu entmisten. Auch jener vom etwa 250 kg schweren Eber, der für die Zucht gehalten wurde, was sich im Poschko-Deutsch so anhörte: „Muss ma Hutschivater seine Aport putzen!“ Poschko wurde von seinen Bekannten wegen seiner sprachlichen Eigenheiten und seiner humorvollen Einstellung gleichermaßen geliebt und geschätzt. Nur wenige Ereignisse konnten ihn aus der Reserve locken. An einem Herbsttag brachte er Martin mit seinem Fahrrad auf die Weide, um das Vieh heimzutreiben. Die Kühe kannten zwar den Weg nach Hause, machten jedoch immer eine Abkürzung durch Nachbars Garten, wo leckeres Obst am Boden lag. Um Ärger zu vermeiden, versuchte der Serbe mit seinem Fahrrad die junge Kuh Berta zurück auf die Straße zu drängen. Davon unbeeindruckt stieg Berta mit ihrem Fuß in das Hinterrad und verbog die Felge derart, dass man mit dem Fahrrad nicht mehr fahren konnte. Poschko schimpfte, verfluchte das blöde Tier und schulterte seinen Drahtesel, um diesen nach Hause zu bringen. Er hatte sich noch gar nicht beruhigt, als es einen lauten Knall gab und nun auch die Luft draußen war. Damit war der ruhige Serbe am Ende seiner Geduld angelangt, war doch sein einziges und wichtigstes Fortbewegungsmittel unbrauchbar geworden. Er beruhigte sich erst wieder, als ihm Ludwig sein Fahrrad zur vorübergehenden Nutzung anbot. Als Poschko am Folgetag damit von der Arbeit wieder heimfahren wollte, wurde er von einem Gendarm wegen des defekten Lichts aufgehalten und mit 5 Schilling bestraft. Dafür zeigte er absolut kein Verständnis, da es ja nicht sein, sondern das Fahrrad vom Kirchenwirt war und dieser seiner Meinung nach dafür zahlen sollte. Seine Aufregung war groß und legte sich erst, als ihm Johanna einen Schnaps reichte und den Betrag refundierte.
5 Institut für Wirtschaftsforschung: Die Wertschöpfung der österreichischen Land- und Forstwirtschaft in den Jahren 1937 und 1949 bis 1956. In: Beilage Nr. 47, XXX. Jahrgang, Nr. 6, Juli 1957
6 Bundesanstalt für Agrarwirtschaft: http://www.agraroekonomik.at/index.php?id=allgdaten
Jugendliche brauchen Freunde
Freunde, mit denen man Erfahrungen sammeln und sich austauschen kann, sind in allen Altersgruppen unverzichtbar. Ganz besonders für jene, die sich noch nicht oder nicht mehr am Arbeitsplatz austauschen können. Bei Kindern und Jugendlichen ist dies besonders wichtig, da sie wegen ihrer geringen Erfahrungen ihre Persönlichkeit noch entwickeln müssen. Daraus leitet sich der landläufige Spruch ab: „Sag mir, mit wem du zusammen bist und ich sage dir, wer du bist!“ Freundschaften entstehen meist zwischen Menschen mit ähnlichem Alter, gleichen Ansichten und Interessen. Vor dem Handy-Zeitalter war auch die räumliche Nähe ein Kriterium. Die Pubertierenden hatten zu Beginn der 60er Jahre keine Möglichkeit der sexuellen Aufklärung. Familiengespräche wurden mit der Bemerkung: „Schindeln am Dach“ gestoppt, wenn die Themen der Erwachsenen in Richtung Sexualität abzugleiten drohten. Sexuelle Aufklärung stand zu diesen Zeiten an keinem Unterrichtsplan einer Pflichtschule und war kein Thema in den Massenmedien. Erst Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre änderte sich das durch Oswald Kolle, den Aufklärer der deutschen Nation. Seine Beiträge in den Zeitschriften wie Quick und Neue Revue sowie seine Filme „Dein Kind, das unbekannte Wesen“ oder „Das Wunder der Liebe“ kamen für Martin und Pauli zu spät. So wurde Martin im Alter von 12 Jahren von einem älteren Jugendlichen informiert, dass sich auch mit Masturbation der Überschuss an Testosteron abbauen lässt.
Ähnlich ging es Pauli, dem zweitältesten Sohn einer achtköpfigen Arbeiterfamilie, die im alten Schulgebäude wohnte. In diesem, an den Pfarrhof angrenzenden Haus, war zuletzt noch das Postamt untergebracht. Geschlafen haben Eltern, Kinder und Großmutter in einem großen Raum, was selten störungsfrei ablief. Als „Waschküche“ diente vor dem Haus, und damit im freien Friedhofsgelände, ein händisch zu bedienender Brunnen. Dieser Brunnen lieferte auch das Trinkwasser aus dem dortigen Grundwasser. Weder die Behörde noch die sich versorgende Familie hatten Bedenken bezüglich der Genießbarkeit dieses unverzichtbaren Lebensmittels, zumal eine Überprüfung des Trinkwassers gesetzlich noch nicht geregelt war. Pauli hatte mit Fritz einen um zwei Jahre älteren Bruder, der geistig behindert war. Er konnte sich nicht verständigen, nahm als 15-Jähriger immer noch Steine in den Mund und lief planlos durch die Gegend. Für seine jüngeren Geschwister war er manchmal störend und peinlich, wurde aber von allen Kindern mehr oder weniger so akzeptiert, wie er war. Irgendwie gehörte er zu ihnen.
Für Pauli war es ein Bedürfnis sich vom engen Korsett der Familie innerhalb der Friedhofsmauern zu befreien und zu den umliegenden Bauern zu gehen, um an dem aktionsreicheren Leben in einer Landwirtschaft teilhaben zu können. Martin und Pauli begegneten sich beinahe täglich und es entwickelte sich eine dauerhafte Freundschaft. Gerne gingen beide oder Pauli allein zum Nachbarhof, wo Rupert mit seiner Frau Josefine und ihren drei Kindern Bertl, Gusti und Greti den Betrieb führten. Rupert musste den Bauernhof unvorhergesehen übernehmen, da sein Cousin als vorheriger Bauer und Sympathisant der Nationalsozialisten seine Zwangsarbeiter offenbar schlecht behandelte und nach Kriegsende von diesen mit einer Schaufel erschlagen wurde. Rupert war alles andere als radikal und für die jungen Buben so etwas wie ein Großvater, von dem die Jungs viel lernen konnten. Von März bis November ging er barfuß und selbst am etwa 40 Grad heißen Misthaufen verweigerte er Schuhe oder Gummistiefel, wenn der Dünger aufgeladen und auf die Felder auszubringen war. An Sonntagen ging er gerne in die Au und zeigte mit großer Erfahrung den Buben, wo die Vögel ihre Nester hatten oder wie man Fische im Bach mit der Hand fangen kann. In der großen Bauernstube von Rupert und seiner Familie waren die Buben gerne gesehen und durften sich am Jausenbrot bedienen, wann immer sie wollten. Zu dieser Zeit backten die Bäuerinnen ihr Schwarzbrot selbst und daher schmeckte das Brot beim Nachbarn anders und „besser“. Den Buben fiel auf, das Rupert stets die Rinde vom Brot trennte, was die beiden gerade wegen der Kruste gerne aßen. Erst später fanden sie heraus, dass seine wenigen Zähne der Grund dafür waren. Da sich Rupert nach dem Essen gerne eine Zigarette gönnte, hatte er auch nichts dagegen, wenn Pauli und Martin ebenfalls rauchten. Eine Solidaritätsbekundung der besonderen Art.
Da die Eltern von Martin durch die Land- und Gastwirtschaft sieben Tage in der Woche zwischen 15 und 19 Stunden arbeiteten, hatte sie keine Zeit für die Erziehung ihrer Kinder. Pauli und Martin waren gerne im Auwald, fischten im Bach und brieten sich die Barben an einer selbst gegrabenen Feuerstelle. Retteten einem Frosch das Leben, der zuvor von einer Ringelnatter geschluckt wurde, indem sie diese mit einem Messer öffneten. Bei einem Streifzug durch einen ausgetrockneten Wassergraben entdeckten sie ein für sie unbekanntes Kriegsrelikt und nahmen es mit. Am Heimweg trafen sie auf einen alten Mann aus dem Nachbardorf, der mit seinem Ziehwagen Grünfutter nach Hause brachte. Sie warfen mehrmals das Kriegsrelikt auf seinen Wagen, von dem es mehrmals wieder runterfiel. Zu Hause angekommen fiel der Vater von Martin fast in Ohnmacht, als er das Kriegsrelikt als Panzerfaust identifizierte. Glücklicher Weise ist nichts passiert, sonst wären alle drei Personen gestorben und die Kühe ohne Grünfutter gewesen.
Ein 10-Jähriger von damals hatte bis dato noch keinen nackten Menschen gesehen. Martin bekam Schamgefühle und errötete, als er mit acht Jahren vom Garten aus zufällig sah, wie sein kleiner Bruder Fritz von der Mutter am Fensterbrett gestillt wurde. Nacktsein oder sich so zu zeigen, war zu dieser Zeit höchst unmoralisch. Dennoch existierte am anderen Ende der Gemeinde in Donaunähe eine FKK-Siedlung, die Martin und Pauli nicht verborgen geblieben war. Im Sommerbetrieb schlichen sich die beiden an das Gelände heran, um die eine oder andere nackte Frau zu sehen. Das war immer ein gefährliches Unterfangen, denn meist wurden die unerwünschten Beobachter entdeckt und von den wütenden Männern durch den Auwald gejagt. Dabei hatten sie meist das Gefühl, als müssten sie um ihr Leben laufen.
Beliebte Gruppenspiele mit weiteren Schulfreunden waren neben der Errichtung von Schneemännern im Winter das Fang- und das Versteckspiel. Bei ersterem musste der Davonlaufende schneller und wendiger sein als der nachlaufende Fänger. Schnelligkeit und Geschicklichkeit waren wichtige Kriterien, um erfolgreich zu sein. Unbewusst trainierten die Jugendlichen damit ihren Körper, was für ihre Entwicklung bzw. ihr späteres Leben wichtig war. Beim Versteckspiel musste der Erstgefundene, nachdem er mit geschlossenen Augen an einem bestimmten Platz bis 30 zu zählen hatte, die anderen suchen gehen. Wenn jemand ungesehen seinen Zählplatz erreichte, konnte er sich mit den Worten: „eins, zwei, drei, ich bin frei!“ freischlagen. Martin und Pauli liebten dieses Spiel auf einem Bauernhof, wenn sie sich mit einem Mädchen ihres Alters am Heuboden verstecken konnten. Um so wenig wie möglich gesehen zu werden, musste man sich natürlich eng zusammenkuscheln. Es ergaben sich die ersten Möglichkeiten, ein Mädchen zu berühren, zu küssen und auf seine Reaktion zu warten. Denn es sollte ja noch mehr geben als das bloße Aneinanderpressen der beiden Lippenpaare. Weniger angenehm war ein Versteckspiel von Martin mit seinem Freund Ferdinand in der Wohnung seiner Eltern. Der übermütige Martin lief von der Küche in das Wohnzimmer und hüpfte auf das dortige Sofa, das ihn mit seinen Federn an die Wand warf. Martin war einige Zeit nicht ansprechbar und bekam auf der linken Stirnhälfte eine riesige Beule. Aber den Eltern sagte er nichts davon, weil er Angst hatte, auch noch beschimpft zu werden. Und aufgefallen ist es ihnen auch nicht. Mit Ferdinand, der um eineinhalb Jahre älter war als Martin, sprang er auch gerne in den Bachtümpel, der in der Nähe seines Elternhauses war und einen einfachen Übergang hatte. Viele Stunden verbrachten die beiden in der natürlichen Umgebung. Durch den Besuch des Stiftsgymnasiums von Ferdinand schwächten sich die gemeinsamen Jugendaktivitäten leider ab.
Ein besonderes Ereignis für Kinder und Jugendliche war der jährliche „Leonhardikirtag“, der am 6. November eines Jahres zu Ehren des heiligen Leonhard im Nachbarort abgehalten wurde. Zuvor allerdings musste Martin mit seinen Ministrantenkollegen den Pfarrer und die betende Prozession in den 3 km entfernten Ort begleiten und in der dortigen Kirche eine Messe zu Ehren des Heiligen aus dem 7. Jahrhundert mitfeiern. Die liturgischen Notwendigkeiten und den damit verbundenen Fußweg nahmen die Kinder und Jugendlichen aus dem Nachbarort gerne in Kauf, wenn sie an die vielen und seltenen Angebote dachten. Im Ortszentrum und den angrenzenden Wiesen standen einfache Karusselle und Ringelspiele, die die Kinder gerne nutzten, um in den Genuss der Fliehkraft zu gelangen. Schießbuden wurden gestürmt, um eine Rose für ein sympathisches Mädchen zu erlangen. Für die jugendlichen „Schleckermäuler“ gab es Schokolade in vielfältiger Art und Form, „Negerbrot“ (einfache Milchschokolade mit Haselnüssen), Lebkuchenherzen zum Verschenken an die Liebste, Schaumrollen und vieles mehr. Auch Strickwaren und Kleidungsstücke konnte man erwerben. Was Martin und seine Freunde jedoch am meisten interessierte, waren Revolver, die mit Stoppeln oder Kapseln geladen wurden. Die Stoppeln waren aus gepressten Sägespänen, gefüllt mit Zündplättchen und entsprechenden Oxidationsmitteln, die beim Abfeuern einen großen Knall wie eine echte Faustfeuerwaffe machten. Der aufgesetzte Stoppel flog 1 bis 2 m weit, was beim Einsatz zu berücksichtigen war. Der Kapselrevolver wurde bestückt mit einer kleinen Papierrolle, auf der die Knallkörper in Tropfenform eingeschlossen waren und erst durch einen Schlagbolzen explodierten und dadurch zu hören waren. Die jungen Knaben kratzten ihr Taschengeld zusammen, um sich mit „Waffe und Munition“ längerfristig einzudecken. Denn Cowboy- und Indianerspiele ohne Waffen waren angesichts der Karl May-Impressionen undenkbar.
Eine besondere Reizfigur für alle Jugendlichen im Ort war der Bauhilfsarbeiter August, der mit seiner Steffi in einem alten Haus eines Bauern wohnte. Bei ihm gewann man den Eindruck, dass seine Gedächtnisleistung mit seinen schnellen Aktivitäten nicht Schritt halten konnte. Steffi hingegen war eine äußerst gutgläubige Frau. In ihrer Wohnumgebung war ein Graben, der sich schon bei leichten Überflutungen der Donau mit Wasser füllte. Die Geschwindigkeit des Anstiegs war und ist ein wichtiger Indikator über die Höhe bzw. Gefährlichkeit des Hochwassers. August fühlte sich wie ein Mitarbeiter des hydrografischen Dienstes, wenn er den Wasserstand beobachtete und seine Einschätzung der übrigen Bevölkerung gerne und mit bestimmender Gewissheit mitteilte. Dazu steckte er einen Holzstock am Wasserrand in die Erde und beobachtete diesen in Abständen von etwa von einer Stunde. Wenn sich das Wasser vom Stock entfernte, bedeutete das einen Rückgang des Hochwassers. Wenn jedoch der Stock im Wasser stand, war das ein Alarmzeichen für ein Ansteigen des Hochwassers. Martin und Pauli beobachteten ihn und in einem unbemerkten Augenblick zogen sie den hölzernen Messpegel heraus und setzten diesen ins Wasser. Als August seinen Kontrollgang machte und seinen Messstab tief im Wasser sah, schlug er Alarm und rannte zu seiner Steffi, um die Evakuierungsarbeiten im und ums Haus zu beginnen. Er war wie verrückt, denn, wenn das Hochwasser in dieser Geschwindigkeit weitersteigt, steht nach seiner Expertise das Erdgeschoß innerhalt von wenigen Stunden unter Wasser. Erst als die beiden begannen, das an der Hausmauer aufgeschichtete Holz auf den Dachboden zu bringen, wurden sie von Martin und Pauli aufgeklärt, dass sich „Unbekannte“ einen Spaß erlaubten und den Messstab versetzten. August war wütend, jedoch wiederum froh, dass er und Steffi die Evakuierungsmaßnahmen beenden konnten.
Ein andermal machte August bei jenem Bauern, der ihm seine „Villa“ zu einer Anerkennungsmiete überließ, Vorbereitungen für das Sprengen der Obstbaumstöcke. Der Bauer hatte die Obstbäume in seinem Garten umgeschnitten, weil er aus dem Obstgarten ein Feld machen wollte. Deshalb mussten die Baumstöcke mit ihren starken und weitverzweigten Wurzeln aus der Erde geschafft werden, um den Garten umpflügen zu können. Am einfachsten gelingt so ein Vorhaben durch eine Sprengung – und August war ein Experte dafür. Gegen Abend bohrte er die 20 Wurzelstöcke an, füllte die Löcher mit Schwarzpulver und verband die explosive Masse mit einer Zündschnur. Pauli und Martin waren interessierte Zuschauer dieses nicht alltäglichen Ereignisses. Da es nach Ende der Arbeit bereits finster war und bei einer Sprengung allfällige Schäden nicht eruierbar gewesen wären, entschied er sich, die Sprengung am nächsten Tag vorzunehmen. Pauli und Martin nahm er die Verpflichtung ab, den geladenen Baumstöcken nicht zu nahe zu kommen, was beide einmütig versprachen und sie entfernten sich. Doch ihre Versuchung war stärker als ihr Versprechen und als August kaum zuhause beim Abendmahl saß, explodierten mehrere Baumstöcke mit ungeheuerlichem Lärm. Nachbarn, die den lauten Knall hörten, liefen zur vermutlichen Lärmquelle, um nach den Rechten zu sehen. Schreiend lief August durch das explosive Gelände und schrie: „Wo sind diese A…löcher, ich bringe sie um!“ Im gesicherten Versteck beobachteten Pauli und Martin diese Erregung und hatten sichtlichen Spaß daran.
Die Freundschaft zwischen Pauli und Martin bekam auch durch den Griff zum Glimmstängel eine neue Qualität. In einer unversperrten Lade des elterlichen Gasthauses von Martin befanden sich die Zigaretten zum Verkauf. Die gängigsten Marken waren damals Austria 2 und Austria 3, hergestellt in der Tabakfabrik Linz. Sie waren ohne Filter und hatten eine ovale Form und passten sich den Lippen ergonomisch gut an. Die in der Umgangssprache 2er und 3er genannten Zigaretten wurden auch einzeln verkauft und die offenen Schachteln luden die Jungraucher förmlich ein, sich daran zu bedienen. Meist gingen sie, um beim Rauchen im Alter von 12 Jahren nicht gesehen zu werden, in die Au oder in eine wenig frequentierte Hütte. Wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs waren und ihnen Menschen begegneten, steckten sie die Glimmstängel vorübergehend in das offene Rohr des Fahrradlenkers. Eines Tages, als Martin mit Pauli im oberen Geschoß der Holzhütte seiner Eltern aus einem großen, offenen Mostfass die Rauchwolken steigen ließen, wurden sie von Ludwig entdeckt. Pauli musste sofort nach Hause gehen und Martin wurde von seinem Vater so stark geschlagen, dass er drei Tage lang nicht schmerzfrei sitzen konnte und beim Esstisch mehr stand, als saß. Aufgehört zu Rauchen hatte er deshalb nicht, er wurde nur vorsichtiger. Vom Glimmstängel getrennt hat sich Martin erst mit 16 Jahren, als er das gesetzliche Mindestalter erreichte. Ohne Beratungshilfe, sondern aus eigener Vernunft. Er hat eingesehen, dass ihn der Tabakgenuss längerfristig krank machen würde und ihn in seiner konditionellen Entwicklung stark behinderte. Offensichtlich zählt die eigene Erkenntnis über den Sinn bzw. Unsinn von Maßnahmen zum wichtigsten Motivationsfaktor bei einer Zielerreichung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.