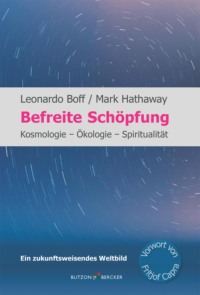Kitabı oku: «Befreite Schöpfung», sayfa 4
Teil I: Erkundung der Hindernisse
2. Ein pathologisches System entlarven
In Einklang mit dem Tao
ist der Himmel klar und rein,
die Erde ist in ruhiger Heiterkeit und ganz,
der Geist wird mit Kraft erneuert,
Flussbette werden wieder gefüllt,
die Myriaden von Kreaturen der Welt gedeihen und leben in Fröhlichkeit,
Anführer sind auf Frieden bedacht,
und ihre Länder werden in Gerechtigkeit regiert.
Wenn die Menschheit in das Tao eingreift,
wird der Himmel trüb,
die Erde wird ausgebeutet,
der Geist erschlafft,
Ströme trocknen aus,
das Gleichgewicht gerät aus den Fugen,
Kreaturen werden ausgelöscht …
(Tao Te King § 39)
Wenn Herrscher im Glanz leben und Spekulanten gedeihen,
während Bauern ihr Land verlieren und die Kornspeicher sich leeren;
wenn Regierungen Geld für Prunk und Waffen ausgeben;
wenn die Oberschicht extravagant und verantwortungslos ist,
nachsichtig mit sich selbst, und mehr besitzt, als sie jemals benutzen kann,
während die Armen nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
All das ist Raub und Chaos,
es hat mit dem Tao nichts gemein.
(Tao Te King § 53)
Ein erster Schritt auf dem Weg hin zu einer Welt, in der Leben, Schönheit und Würde wirklich gedeihen können, besteht darin, die jetzige Wirklichkeit unseres Planeten zu verstehen. Wie wir bereits gesehen haben, leben wir in einer Zeit, in der die Ökosysteme der Erde in raschem Tempo zerstört werden, wobei eine kleine Minderheit der Menschheit ihr Monopol auf den weltweiten Wohlstand behauptet. Inzwischen vollziehen sich tiefgreifende und rasche Veränderungen in der Organisationsweise der Gesellschaft. In vieler Hinsicht stehen wir vor einem Scheideweg. Technische Durchbrüche auf den Gebieten der Kommunikation, der Computertechnik und der Gentechnik vergrößern die Macht des Menschen wie niemals zuvor. In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Welt auf allen Ebenen dem Diktat des „Marktes“ und des Profitstrebens unterworfen. In politischer Hinsicht entwickeln sich die transnationalen Konzerne zu den beherrschenden Mächten der Welt. Dabei erhalten sie Rückendeckung von der militärischen Macht der Länder, die ihren Interessen zu Diensten sind. In kultureller Hinsicht setzen die Massenmedien die Werte und Sehnsüchte des Konsumismus weltweit durch.
Vielen gilt diese Art von „Globalisierung“ als unvermeidlich. Und in der Tat versichern uns diejenigen, die als Sprachrohr der beherrschenden Mächte fungieren, dass sich dies so verhält. Es gibt keine Alternative.
Aber was wäre nun, wenn die Krisen der Armut und der ökologischen Zerstörung, mit denen wir es zu tun haben, nicht einfach nur zufällige Nebeneffekte oder „Kinderkrankheiten“ unseres wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Systems sind? Was wäre, wenn sie nicht einfach durch einige kleinere Reparaturarbeiten zu beheben sind? Wenn eine innere Erkrankung das Wesen dieser Krisen ausmacht? Wären wir dann nicht gezwungen, den Weg, auf dem wir uns befinden, neu zu überdenken und nach Alternativen zu suchen? Stünden wir dann nicht vor der Herausforderung, in neuer, kreativer Weise unser Denken und Handeln darauf auszurichten, zu verändern, was bisher als unvermeidlich galt?
Tatsächlich sind wir davon überzeugt, dass dem System selbst, das zurzeit unsere Welt beherrscht und ausbeutet, eine tief liegende Erkrankung innewohnt. In diesem Kapitel werden wir versuchen, dieses pathologische Phänomen aufzudecken. Dabei verfolgen wir nicht die Absicht, unsere Leser ohnmächtig oder überfahren zurückzulassen. Ganz im Gegenteil, der erste Schritt zur Genesung ist es, zu akzeptieren, dass wir krank sind, und diese Krankheit zu verstehen. In gewissem Sinne leben wir alle in einer Art kollektivem Wahn, in dem das, was sowohl unlogisch als auch zerstörerisch ist, als normal und unvermeidlich gilt. Natürlich mag es für diejenigen, die am meisten an dieser Erkrankung zu leiden haben, völlig klar sein, dass wir es mit einer grundsätzlichen Störung zu tun haben: für die Kreaturen, deren Lebensraum zerstört wird, und für die große Mehrheit der Menschheit, die an den Rändern unserer neuen globalen Wirtschaft lebt. Andererseits mag es für diejenigen, die (wenigstens kurzfristig) von den Vorteilen des Systems profitieren, weniger klar sein, dass wir es mit einer Krankheit zu tun haben. Für alle aber wirft eine gründlichere Analyse des Systems Erkenntnisse ab, die uns allen helfen können, die herrschende (Un-)Ordnung10 herauszufordern und Alternativen ins Auge zu fassen.
Worin besteht nun die Erkrankung unserer Welt? Ein erster Schritt besteht darin, die Symptome dieser Krankheit, die unseren Planeten heimsucht, näher zu betrachten – eine Krankheit, die in der Art und Weise ihren Ursprung hat, wie die Gesellschaft zurzeit organisiert ist. Konkret werden wir sowohl die Probleme von Armut und Ungleichheit als auch die ökologischen Probleme näher betrachten, die daraus resultieren, dass wir durch Raubbau und Verschmutzung über die Grenzen der Erde „hinausschießen“.
Krankheitssymptome
Armut und Ungleichheit
Ein erstes Krankheitssymptom ist die größer werdende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Viele mögen dagegen einwenden, dass finanziell gesehen die Menschheit heute reicher ist als jemals zuvor in ihrer Geschichte. Wir leben in einer Welt voller Wunder, die sich unsere Vorfahren vor einem Jahrhundert kaum vorstellen konnten: schnelles Reisen und rasche Kommunikation, eine hoch entwickelte Medizin, Maschinen, die Arbeit einsparen, und komfortabler Luxus. Einigen Schätzungen zufolge gibt es zurzeit eine größere Vielfalt an Konsumgütern als an lebenden Arten. Insgesamt produzieren die Menschen jetzt fast fünfmal so viel pro Kopf als vor hundert Jahren. (Little 2000)
Doch dieses schier unglaubliche Wachstum von Wohlstand hat nicht zur Ausrottung oder wenigstens zu einer deutlichen Verringerung der menschlichen Armut geführt. Tatsächlich blieb der Anteil der Menschen, die in Armut leben, während der letzten fünfzig Jahre relativ konstant. (Korten 1995). Einen echten Fortschritt gab es im Hinblick auf die Kindersterblichkeit, die Verlängerung der Lebenserwartung, der Alphabetisierungsrate und verbessertem Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung. Dennoch lebt fast ein Drittel der Weltbevölkerung immer noch von einem US-Dollar am Tag. Wenn man genauer hinsieht und insbesondere das Wegbrechen traditioneller Kulturen, Lebensweisen und der diese tragenden Ökosysteme betrachtet, dann gelangt man zur Feststellung, dass sich die tatsächliche Lebensqualität von vielen der Armen dieser Welt verschlechtert hat.
Inzwischen hat sich der Gegensatz zwischen Arm und Reich zu einer tiefen Kluft ausgeweitet. Relativ gesehen sind Asien, Afrika und Lateinamerika tatsächlich ärmer als wir vor hundert Jahren. Weltweit hat sich die Disparität der Einkommen zwischen Reichen und Armen verdoppelt. Schlimmer noch: Immer noch werden große Mengen an Reichtum von den ärmeren in die reicheren Länder transferiert. Für jeden Dollar an Entwicklungshilfe fließen drei als Schuldendienst in den Norden zurück. Der Nettotransfer von Reichtum ist sogar noch größer, wenn man die unfairen „Terms of trade“ (d. h. das Austauschverhältnis von Import- und Exportprodukten; d. Übers.) betrachtet, die die armen Länder zu niedrigen Löhnen und niedrigen Warenpreisen zwingen.
Wenn man den Wohlstand betrachtet, dann ist die Größenordnung der Ungleichheit sogar noch schockierender. Die drei reichsten Menschen der Welt verfügen über ein Vermögen, das das Bruttosozialprodukt der 48 ärmsten Länder zusammengenommen übersteigt. Wie wir bereits angemerkt haben, verfügen die Milliardäre zusammen über ein Vermögen von 2,4 Billionen US-Dollar; das ist mehr als das jährliche Einkommen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. Im Vergleich dazu betrügen die Gesamtkosten für eine Grundschulbildung, eine medizinische Grundversorgung, angemessene Ernährung, sauberes Trinkwasser und Kanalisation für all diejenigen, die dies alles bislang nicht haben, bloß 40 Milliarden US-Dollar im Jahr, das heißt weniger als 2 % des Vermögens der weltweit Reichsten. (UNDP-Bericht 1998) Vor Kurzem wurden die zusätzlichen Kosten für die Millennium-Ziele der Entwicklungspolitik – die über die bereits angeführten Ziele hinaus noch die Eindämmung von HIV/Aids und der Malaria und die Erhaltung der Umwelt umfassen – von der Weltbank auf 40 bis 60 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) rechnet dagegen hoch, dass im Jahr 2007 weltweit jede Woche (!) 25 Milliarden US-Dollar für militärische Zwecke ausgegeben wurden.
Der unmittelbare Eindruck, der sich aufdrängt, wenn man diese Tatsachen bedenkt, ist, dass die Armut innerhalb der menschlichen Gesellschaft grundsätzlich nicht auf einen Mangel an Reichtum oder Ressourcen zurückzuführen ist, sondern eher auf die beschämende Verteilung der Reichtümer der Welt. Gandhi sagte: „Die Erde hat genug, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, aber nicht genug, um die Gier derjenigen zu stillen, die einem unvernünftigen Konsum nachjagen.“
Ein zweiter Gedanke, der einem in den Sinn kommt, ist: Während die Armut an sich unsagbares Leid hervorruft, wird dieses durch die Ungleichheit noch verschlimmert. Dies gilt besonders für die heutige Welt, in der selbst die ärmsten Menschen mit Radio, Fernsehen und Werbung konfrontiert sind. Je mehr die Massenmedien das Bild eines „Konsumparadieses“ für wenige verbreiten, umso stärker wachsen Entfremdung und Verzweiflung unter den Armen. Die Suggestion der Medien untergräbt auch die traditionellen Ressourcen des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Kultur, Familie, Tradition). Während die ökologische Verwüstung ihren Lauf nimmt, schwindet auch der materielle und spirituelle Halt, den traditionelle Lebensweisen sowie die Schönheit der Natur geboten haben.
Raubbau an der Erde
Das zweite Leitsymptom der Erkrankung ist die rasch voranschreitende Ausplünderung der Reichtümer der Erde, darunter sauberes Trinkwasser, saubere Luft, fruchtbares Ackerland und eine reichhaltige Vielfalt von Lebenszusammenhängen. Dieselbe Gier, die die Armut von Menschen verursacht, lässt auch die Erde selbst verarmen. Der Konsum der Menschen beansprucht einen immer größeren Teil der natürlichen Reichtümer der Erde. Dabei handelt es sich um einen Reichtum, dessen Wert nicht in Geld ausgedrückt werden kann, weil er die Basis des Lebens selbst ist. In einer eher technischen Sprache heißt das, dass wir Zeugen der Erschöpfung der „Ressourcen“ der Erde sind. Unsere Welt tritt gerade in eine Periode des „Niedergangs“ ein, in der die Menschheit die allen gemeinsamen Güter der Erde schneller verschlingt, als diese sich erneuern können.11
Dieser Prozess des „Niedergangs“ bedroht unsere Fähigkeit, die Nahrungsmittelproduktion aufrechtzuerhalten. Die moderne Agrarwirtschaft benutzt Chemikalien, um das Wachstum der Pflanzen zu fördern und die Erträge kurzfristig zu vergrößern, doch dabei gehen Nährstoffe verloren, die nicht rechtzeitig ersetzt werden können. Dies führt zur Verschlechterung der Böden und der Qualität der Nahrungsmittel. Der Boden wird einfach als „Wachstumsmedium“ behandelt und nicht als ein komplexes Ökosystem, in dem jedes Gramm Erde eine Milliarde Bakterien, eine Million Pilze und Zehntausende von Protozoen enthalten kann. „Der Boden bringt Leben hervor, weil er selbst lebendig ist.“ (Suzuki/McConnell 1997, 80) Es dauert fünfhundert Jahre, bis eine 2,5 cm hohe Schicht von Ackerboden entsteht, und dennoch verlieren wir 23 Milliarden Tonnen Boden jedes Jahr. Das heißt, dass wir in den letzten zwanzig Jahren fruchtbaren Boden in der Größenordnung verloren haben, wie sie dem Ackerland Frankreichs und Chinas zusammengenommen entspricht. Jedes Jahr benutzen oder zerstören wir 40 % von den 100 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens, den die Ökosysteme der Erde schaffen.
Die extensive Bewässerung führt inzwischen zu einer weit verbreiteten Versalzung, und der Maschineneinsatz auf Randflächen hat weitere Bodenerosion zur Folge. Nimmt man dazu noch die Auswirkungen des Klimawandels, dann führen all diese Faktoren zu einem Verlust bebaubaren Landes und dessen Verwandlung in Wüste: Zwischen 1972 und 1991 ging mehr Ackerland an die Wüste verloren als die Fläche, die in China und Nigeria zusammengenommen bestellt wurde. Man schätzt, dass nun 65 % des einst bebaubaren Landes bereits Wüste sind.
Die in biologischer Hinsicht reichhaltigsten Ökosysteme an Land, die Wälder, werden ebenfalls zerstört. Im Lauf der letzen zwanzig Jahre war von der Entwaldung eine Fläche betroffen, die größer ist als die Vereinigten Staaten östlich des Mississippi. Mehr als die Hälfte der Waldbestände, die 1950 noch existierten, sind nun abgeholzt. Es geschieht auch einiges an Wiederaufforstung. Doch diese neu gepflanzten Wälder sind oftmals nicht viel mehr als Baumplantagen, die eine weitaus geringere Vielfalt und Dichte lebendiger Arten beherbergen als die alten Wälder, die sie ersetzen sollen. Es überrascht daher nicht, dass Hunderttausende von Pflanzen- und Tierarten für immer verschwunden sind und weitere tausendmal schneller aussterben als jemals zuvor seit dem Verschwinden der Dinosaurier.
Auch die Ozeane, die 99 % des Lebensraums auf unserem Planeten ausmachen und in denen 90 % aller Arten leben, sind tiefgreifenden Veränderungen unterzogen. Mindestens ein Drittel des CO2 und 80 % der Wärme, die durch den Klimawandel entsteht, werden von den Ozeanen absorbiert. Dies wiederum ändert den Säuregehalt, die Eisdecke, das Volumen und den Salzgehalt der Meere und kann möglicherweise Meeresströme verändern, die einen großen Einfluss auf das Klima haben. Ein Viertel aller Korallenriffe – die Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt im Meer – wurde bereits zerstört, und gut die Hälfte der noch existierenden sind gefährdet. Die tiefgreifenden chemischen Veränderungen in den Ozeanen können wahrscheinlich auch das Plankton gefährden, das eine Hauptnahrungsquelle für andere Meerestiere darstellt und auch die wichtigste Lunge des Planeten ist, da es ganze 50 % des Sauerstoffs produziert. (Mitchell 2009)
Grundwasser, das sich über Millionen von Jahren in riesigen grundwasserführenden Schichten angesammelt hat, wurde im Lauf des letzten Jahrhunderts rasch verbraucht, und wahrscheinlich wird sich die Rate der Entnahme im nächsten Vierteljahrhundert um weitere 25 % erhöhen. Viele Menschen sehen sich jetzt schon mit chronischem Wassermangel konfrontiert, und diese Probleme werden sich in vielen Regionen der Welt im Lauf des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich verschärfen. Erdöl und Kohle, die im Laufe von 500 Millionen Jahren entstanden sind, könnten zur Mitte des nächsten Jahrhunderts völlig erschöpft sein (und der Kohlenstoff, den die Erde so sorgfältig in sich eingeschlossen hat, um ihre Atmosphäre stabil zu halten, wird wieder freigesetzt). Wir sind bereits sehr nah am „Peak oil“, das heißt dem Fördermaximum von Erdöl, und die Nachfrage wird sehr bald das Angebot übertreffen. Dazu kommt, dass viele wichtige metallische Rohstoffe wie Eisen, Bauxit, Zink, Phosphat und Chrom im Lauf dieses Jahrhunderts nahezu völlig erschöpft sein werden.
Jede Minute eines jeden Tages
– verlieren wir – meist durch Brandrodung ‒ eine Fläche an tropischem Regenwald, die fünfzig Fußballfeldern gleichkommt;
– verwandeln wir einen halben Quadratkilometer Land in Wüste und
– verbrennen so viele fossile Brennstoffe, dass die Erde zehntausend Minuten bräuchte, um diese wieder mithilfe des Sonnenlichts zu produzieren. (Ayers 1999 b)
Es wird geschätzt, dass bereits jetzt die reichsten 20 % der Menschheit mehr als 100 % dessen verbrauchen, was die Erde nachhaltig hervorbringt, während die verbleibenden 80 % weitere 30 % davon verbrauchen (und dabei handelt es sich um eher vorsichtige Schätzungen). Mit anderen Worten: Wir sprengen jetzt schon die Grenzen der Erde. Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein relativ kleiner Teil der Menschheit für diese Situation verantwortlich ist. Der übermäßige Konsum der Wenigen lässt die gesamte planetarische Lebensgemeinschaft verarmen. Einige Ökologen schätzen, dass in den fünfundzwanzig Jahren zwischen 1970 und 1995 ein Drittel des „natürlichen Kapitals“ der Erde verloren ging (Sampat 1999). Und die Ausbeutungsrate hat sich seither weiterhin beschleunigt. Es ist klar, dass eine solche Ausplünderung des Reichtums unseres Planeten nicht ohne ernsthafte, lebensbedrohende Folgen für uns alle weitergehen kann.
Die Vergiftung des Lebens
Das dritte Krankheitssymptom könnte die größte Bedrohung für uns alle darstellen. Da wir einen stetig wachsenden Berg von Abfall produzieren, überschreiten wir die Kapazitäten der natürlichen „Senken“ des Planeten, Schadstoffe zu absorbieren, unschädlich zu machen und wieder dem natürlichen Kreislauf zuzuführen. Noch schlimmer: Wir bringen chemische und nukleare Schadstoffe in die Umwelt ein, die langfristig bleiben, und wir verändern die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre selbst. Diese Probleme der Tragfähigkeit des Planeten untergraben die Gesundheit aller Lebewesen und deren Lebensräume in ernsthafter Weise. Dazu folgende Beispiele:
– Siebzigtausend vom Menschen produzierte Chemikalien wurden in die Luft, das Wasser und den Boden freigesetzt, die meisten davon in den letzten fünfzig Jahren, und jedes Jahr werden etwa tausend neue Chemikalien erzeugt. Die jährliche Produktion synthetischer organischer Stoffe hat von sieben Millionen Tonnen im Jahr 1950 auf fast eine Milliarde Tonnen heute zugenommen (Karliner 1997). Davon wurden 80 % niemals auf ihre Toxizität hin getestet. (Goldsmith 1998). Jede Minute sterben fünfzig Menschen an Vergiftung durch Pestizide (Ayers 1999 b), und jeden Tag werden eine Million Tonnen gefährliche Abfälle produziert (Meadows et al. 1992).
– Weiterhin wird Atommüll produziert, ohne dass man sichere Lagerstätten dafür hat. Teilweise bleibt dieser Müll 250.000 Jahre lang radioaktiv. In der ganzen Welt gibt es mehr als 1800 Tonnen Plutonium. Dieses Element ist so giftig, dass bereits eine Millionstel Unze davon für einen Menschen tödlich sein kann. Bloß acht Kilogramm davon genügen, um eine Bombe daraus herzustellen, die dieselbe Zerstörungskraft wie die von Hiroshima hat.
– Wir haben riesige Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt, und zwar dreimal so viel, wie die natürlichen Kreisläufe normalerweise absorbieren können. Dadurch wurde ein gefährlicher Kreislauf globaler Erwärmung und Destabilisierung des Klimas in Gang gesetzt. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass dies die stärkste Veränderung des Erdklimas seit dem Beginn des Eozäns vor etwa 55 Millionen Jahren ist (Lovelock 2008). Gleichzeitig haben wir durch die Zerstörung der Wälder und der maritimen Ökosysteme die Fähigkeit der Erde, Kohlendioxid aus der Luft zu binden, ernsthaft vermindert. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist nun höher als jemals zuvor in den letzten 160.000 Jahren, und die weltweite Durchschnittstemperatur ist bereits um 5 Grad Celsius angestiegen. Bei den derzeitigen Emissionsraten wird sich der CO2-Gehalt in den nächsten fünfzig Jahren verdoppeln, und die globale Durchschnittstemperatur wird um weitere 2 bis 5 Grad Celsius ansteigen. (IPPC, Intergovernmental Panel on Climate Change). As Folge davon wird das Wetter chaotischer werden, und Verwüstungen durch Stürme werden zunehmen. Die Zahl der Menschen, die von wetterbedingten Katastrophen betroffen waren, stieg von 100 Millionen im Zeitraum von 1981 bis 1985 auf 250 Millionen im Zeitraum von 2001 bis 2005 (Worldwatch 2007).
Die Probleme der Tragfähigkeit stellen eine besondere Herausforderung aufgrund ihrer langfristig andauernden Auswirkungen dar. Selbst wenn wir die Produktion giftiger Chemikalien morgen einstellen würden, selbst wenn wir alle Atomanlagen sofort abschalten würden, selbst wenn wir aufhören würden, Treibhausgase wie Methan und CO2 zu emittieren, blieben die schädlichen Folgen Jahrhunderte und Jahrtausende lang bestehen, im Fall des Atommülls sogar hunderte Millionen Jahre lang. Doch die Produktion vieler dieser Substanzen wächst weiterhin, in manchen Fällen sogar beschleunigt. James Lovelock (2008) bemerkt sogar, dass einige der Veränderungen, die wir verursacht haben, irreversibel zu werden drohen. Wenn wir zum Beispiel die Treibhausgase nicht bald reduzieren, könnten wir einen Umschlagpunkt erreichen, vom dem ab sich das Klima für unseren Planeten dauerhaft erwärmen könnte.
Manchmal mögen wir die Zusammenhänge zwischen den Problemen der Tragfähigkeit, der Erschöpfung von Ressourcen, der Armut und Ungleichheit nicht unmittelbar sehen. Insbesondere kann es schwierig sein, die Zusammengehörigkeit von ökologischen und sozialen Dimensionen der Krise zu erfassen. Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die Massenmedien die Themen oftmals so darstellen, als ob eine Art Konkurrenz zwischen menschlichen Bedürfnissen und dem Schutz der Ökologie bestünde. Sollen wir zum Beispiel einen alten Wald erhalten oder ihn abholzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen? Sollen wir einen Fluss, in dessen natürlichen Verlauf bislang nicht eingegriffen wurde, schützen, oder ein Bergwerk bauen, um eine schlechte Wirtschaftslage zu verbessern? Sollen wir Chemikalien und Gentechnik einsetzen, um die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen? Sollen wir einen neuen Staudamm bauen, um Energie für die industrielle Entwicklung bereitzustellen?
Fast immer jedoch, wenn wir einen Schritt zurücktreten und einen weiteren Blickwinkel zulassen, stellt sich diese Vorstellung, dass wir entweder die Armut bekämpfen oder die Ökosysteme schützen können, keineswegs aber beides zugleich, als eine Lüge heraus, die gebetsmühlenartig von jenen wiederholt wird, die die Erde und den ärmsten, verwundbarsten Teil der Menschheit zugleich ausbeuten. Um dies deutlicher zu sehen, wollen wir die sechs wesentlichen Charakteristika unserer derzeitigen Welt(un-)ordnung, wie sie vom Kapitalismus des industriellen Wachstums geschaffen wird, näher untersuchen:
– Die Verschreibung an ein grenzenloses Wachstum
– Ein verzerrtes Verständnis von Entwicklung
– Wachsende Unterwerfung unter die Herrschaft der Konzerne
– Verschuldung und Spekulation als die Hauptquellen des Profits
– Die Tendenz, Wissen zu monopolisieren und eine weltweite Einheitskultur durchzusetzen
– Der Rückgriff auf Macht im Sinne von Beherrschung, wozu militärische Macht und Gewalt gehören.
Krebsartiges Wachstum
„In gewissem Sinne ist der gemeinsame Glaube ans Wachstum gerechtfertigt, weil Wachstum ein wesentliches Charakteristikum des Lebens ist […]. Was an den heutigen Anschauungen über wirtschaftliches und technologisches Wachstum jedoch falsch ist, das ist das Fehlen jeglicher Qualifizierung. Allgemein wird angenommen, alles Wachstum sei gut, ohne zu erkennen, dass es in einer endlichen Umwelt ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Wachstum und Niedergang geben muss. Während einige Dinge wachsen, müssen andere abnehmen, damit ihre Bestandteile wieder freigesetzt und neu verwendet werden können. Der größte Teil des wirtschaftlichen Denkens unserer Zeit beruht auf der Idee des undifferenzierten Wachstums. Auf den Gedanken, dass Wachstum hinderlich, ungesund oder krankhaft sein kann, kommt man gar nicht. Wir brauchen daher dringend eine Differenzierung und Qualifizierung des Wachstumsbegriffs.“ (Capra 2004, 233–234)
Heute ist Wachstum gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Gesundheit geworden. Wenn das Wachstum stagniert oder, schlimmer noch, wenn die Wirtschaft „schrumpft“, dann befinden wir uns in der Rezession, und darauf folgen mit Sicherheit Arbeitslosigkeit und andere soziale Missstände. Nur wenige von uns stellen die alte Weisheit infrage, die die Notwendigkeit einer sich immer weiter ausdehnenden Ökonomie behauptet.
Doch wirtschaftliches Wachstum im herkömmlichen Sinn bedeutet den Verbrauch von mehr natürlichen Ressourcen und die Produktion von mehr gefährlichen Nebenprodukten wie chemische und nukleare Abfälle. Dabei unterliegen, wie wir bereits gesehen haben, viele wesentliche Rohstoffe für eine wachsende Wirtschaft einem rasch fortschreitenden Prozess der Erschöpfung. Obwohl einige „Optimisten“ davon ausgehen, dass man hierfür synthetische Ersatzstoffe finden wird, gibt es wenige oder kaum Anzeichen dafür, dass diese Hoffnung begründet wäre.
Die Crux dieser Angelegenheit besteht darin, dass der Planet, auf dem wir leben, endlich ist. Es gibt nur eine bestimmte Menge an sauberer Luft, trinkbarem Wasser und fruchtbarem Boden. Auch die Menge an verfügbarer Energie ist begrenzt (sie wird durch die Sonne erneuert, aber in einem festgelegten Maß). Da alle Ökonomien und alle Menschen Anspruch auf diese begrenzten wesentlichen Voraussetzungen erheben, liegt es klar zutage, dass es Grenzen des Wachstums gibt.
Warum aber beharren die meisten Wirtschaftswissenschaftler weiterhin darauf, dass ein grenzenloses, undifferenziertes Wachstum der Wirtschaft sowohl nötig als auch gut sei? Teilweise ist dieser Glaube auf eine Verwechslung von Wachstum und Entwicklung zurückzuführen. Herman Daly stellt klar: „Wachsen heißt an Größe zunehmen durch Einverleibung oder Hinzufügung von Material, während entwickeln meint, die Möglichkeiten zu erweitern oder zu verwirklichen, in einen reichhaltigeren, großartigeren, besseren Zustand zu bringen.“ (1996, 2) Unsere Wirtschaft muss in diesem qualitativen Sinne, aber nicht unbedingt quantitativ wachsen. Tatsächlich „entwickelt sich unser Planet im Lauf der Zeit, ohne zu wachsen. Unsere Wirtschaft, ein Subsystem dieser endlichen, nicht-wachsenden Erde, muss ein ähnliches Entwicklungsmuster übernehmen“ (1996, 2).
In früherer Zeit, als die Menschen eine relativ kleine Population auf der Erde darstellten und unsere Techniken relativ einfach waren, waren wir oftmals in der Lage, so zu handeln, als sei die Erde ein grenzenloses Rohmateriallager. Es ist wahr: Das Römische Reich, die Bewohner der Osterinsel, die Zivilisation der Maya im Tieflanddschungel und andere Kulturen richteten für die lokalen Ökosysteme schwere Schäden an und verursachten damit oftmals den Zusammenbruch ihrer eigenen Gesellschaften. Doch die Gesundheit des umfassenden globalen Ökosystems war niemals ernsthaft bedroht, und die lokalen Ökosysteme waren in der Lage, im Lauf der Zeit zu gesunden.
Heute hat die menschliche Population rasch zugenommen, und der Konsum der Menschen ist sogar noch weitaus schneller gewachsen. Von dem, was Daly eine Ökonomie der „leeren Welt“ nannte, sind wir zu dem übergegangen, was er als Ökonomie der „vollen Welt“ bezeichnet.
„Das wirtschaftliche Wachstum hat die Welt mit uns und unseren Dingen angefüllt, aber sie hat sie im Vergleich dazu der Dinge entleert, die vor uns da gewesen sind – was nun uns und unseren Dingen einverleibt ist, nämlich das natürliche System, welches das Leben erhält und das wir seit Kurzem in später Anerkennung seiner Nützlichkeit und Knappheit ‚natürliches Kapital‘ nennen. Eine weitere Expansion der ökologischen Nische des Menschen steigert nun oftmals die Kosten für die Umwelt schneller, als sie die Vorteile der Produktion vermehrt, und leitet damit eine neue Ära des antiökonomischen Wachstums ein […] eines Wachstums, das eher zur Verarmung als zur Bereicherung führt, da es unter dem Strich mehr kostet, als es wert ist. Dieses antiökonomische Wachstum macht es schwerer und nicht etwa leichter, die Armut zu besiegen und die Biosphäre zu schützen.“ (Daly 1996, 218)
Ein nicht nachhaltiger Pfad
Wir haben bereits eine Weise erwähnt, wie man die Wirtschaft der „vollen Welt“ verstehen kann: das Nettoprimärprodukt (NPP). Die Menschen verbrauchen nun über 40 % der Energie, die mittels Fotosynthese an Land erzeugt wird; 3 % werden direkt verbraucht, während der Rest schlicht verschwendet oder zerstört wird (durch Verstädterung, Entwaldung, Verschwendung von Feldfrüchten etc.) Der Anteil des verbrauchten NPP steigt noch weiter an, wenn wir die zerstörerischen Auswirkungen von Verschmutzung, globaler Erwärmung und Ausdünnung der Ozonschicht mit einbeziehen. (Meadwos et. al. 1992) Bei den derzeitigen Wachstumsraten werden wir um das Jahr 2030 80 % des NPP zu Lande für uns beanspruchen. (Korten 1995)
Ein anderer Zugang, um die Grenzen des Wachstums zu begreifen, ist die Vorstellung vom „ökologischen Fußabdruck“, wie sie William Rees und Mathias Wackernagel aus Britisch Kolumbien entwickelt haben. Ein ökologischer Fußabdruck basiert auf der Berechnung der Landfläche, die nötig ist, um die Lebensmittel, das Holz, das Papier und die Energie für einen Durchschnittsbewohner einer bestimmten Region oder eines Landes zu produzieren.
Während wir einen sehr kleinen Teil von 12 % der Landfläche der Erde nichtmenschlichen Arten überlassen (diese Größenordnung scheint schon fast auf skandalöse Weise gering zu sein), stehen jedem Menschen für seinen Unterhalt zurzeit 1,7 Hektar (bzw. 1,8 Hektar, wenn man auch die Meeresressourcen mit einbezieht) zur Verfügung. Doch der durchschnittliche Fußabdruck pro Person beträgt bereits 2,3 Hektar.12 Mit anderen Worten: Wir verbrauchen bereits 30 % mehr als das, was langfristig aufrechterhalten werden kann, und zwar vor allem aufgrund unseres Verbrauchs nichterneuerbarer Ressourcen. Wenn wir einen Anteil von 33 % des Landes anderen Lebewesen überließen – was eher der Vernunft entspräche ‒, dann hätte jede Person weniger als 1,3 Hektar zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir in diesem Fall 75 % mehr konsumieren als das, was dem Kriterium der Nachhaltigkeit entspräche.
Oberflächlich betrachtet, könnte man daraus den Schluss ziehen, dass die Weltbevölkerung um mindestens ein Drittel reduziert werden müsste. Natürlich spielen die bloßen Zahlen eine Rolle, aber sie enthalten nicht die ganze Geschichte. Der Durchschnittsbewohner von Bangla Desh zum Beispiel hat einen ökologischen Fußabdruck von 0,6 Hektar, ein Peruaner braucht 1,3 Hektar. Die reichsten Nationen der Erde andererseits brauchen irgendetwas zwischen 5,4 Hektar (Österreich) und 12,2 Hektar (USA). Wenn jeder Erdenbewohner so viel bräuchte wie ein Bewohner des Nordens im Durchschnitt, dann würden wir mit etwa 7 Hektar pro Person ungefähr drei bis vier weitere mit der Erde vergleichbare Planeten benötigen, um unser Dasein zu erhalten. Es ist also klar, dass der übermäßige Konsum im Norden eine der Hauptursachen der ökologischen Bedrohung ist.