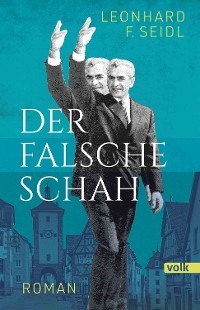Kitabı oku: «Der falsche Schah», sayfa 2
Der Einmarsch des Kaisers
Der Schah und König lebten sozusagen nebeneinander her, auf zwei Kontinenten. Der eine in Asien, in einem Land, das damals noch Persien hieß und vor allem wegen des Öls interessant war für die Politiker im Westen. Der andere in Deutschland mit einem Vater, vulgo Hieronimus König, den sein Kübelwagen im Ersten Weltkrieg sogar bis nach Riga zur Antra kutschiert hatte. Ein fesches lettisches Mädel, die Haare so braun wie der Boden im Wald von Grünwald. Sachen hat der König mit ihr erlebt – aber auch mit ihrem Bruder, weshalb er zwei Wochen später noch nicht richtig hatschen hat können. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Der Vater war also genau da gewesen, wo der Lügenbaron Münchhausen einige Jahre gelebt hat, was wir als wegweisendes Indiz für die Lebensgeschichte vom Bartholomäus König werten könnten, aber derselbe würde uns da vehement widersprechen, wenn er könnte, weil er sich nie als Lügner empfunden hat. Außer vielleicht, wenn man Lügen als eine Kunst begreifen tät.
Würde man hier schon zum zweiten großen Weltkrieg oder in dessen nähere Umgebung vorspulen, dann bekämen wir nochmal eine höchst interessante Lage, weil der Vater vom Schah den Hitler ganz pfundig gefunden hat, was die Engländer und Russen weniger pfundig gefunden haben. Da sind wir, bis auf leider wieder mehr werdende, unverbesserliche Ausnahmen, heute schon auf der Seite der Engländer und Russen. Ganz im Gegensatz zum Vater vom König. Aber dazu später mehr, bevor ich euch zu sehr verwirre. Weil, so eine Geschichte ist ja wie ein Vier-Gänge-Menü: Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise, die auch der Höhepunkt ist, und die Nachspeise, auf die manchmal noch der Schnaps folgt. Und der Höhepunkt wird sich in der Nacht im Schlafzimmer von der dritten Frau vom Schah abspielen, der berühmten Farah Diba, im Hotel Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber, an die sie übrigens heute noch zurückdenkt. Obwohl oder gerade weil der König und nicht der Schah bei ihr genächtigt hat.
Auf alle Fälle ist der Vater vom Schah 1921 mit seiner Kosakenhorde in Teheran einmarschiert. Und wie durch Zufall, aber an Zufälle glaubte der Bartholomäus auch damals, als zweijähriger Bub, nicht, hat er sich genau am selben Tag Vaters Stahlhelm aus dem Ersten Weltkrieg aufgesetzt. Und kaum hat er ihn aufgehabt, hat er die Hendlbrust rausgestreckt – er war nämlich unterwegs, wie ihn Mutter Natur geschaffen hat – und hat die spindeldürren Haxen in die Luft gestochen, wie es sich gehört. Wo er das wieder hergehabt hat, frag mich nicht, vielleicht aus seinen deutschen Genen.
Er marschiert also wie eine Eins durch das Wohnzimmer – gut, bis auf dass der Helm ihn eher zu einem Deserteur als zu einem Soldaten gemacht hat, weil der immer verrutscht ist und ihm die Sicht auf die Frontlinie, also die imaginierte, verdeckt hat. Und da hat er gespürt, der Klein-König, dass ihm was fehlt. Und zwar die Waffe. Weil: Ein Soldat braucht eine Waffe, sonst ist er ja kein Soldat. Also hat er sich den Holzschemel vor den Schrank geschoben und sich die Luger vom Vati, die der immer noch geölt hat – vielleicht hat er geahnt, dass wieder ein Krieg kommen wird –, geschnappt und schon hat das Marschieren noch besser hingehauen, dass sogar der Kaiser in seinem niederländischen Exil gesagt hätte: Servus! Bloß hat das damals keinen mehr interessiert, ob der Wilhelm Servus sagt oder nicht, weil der davor schon so viel Schmarrn erzählt hatte.
Der König-Stempf marschiert so durchs Wohnzimmer mit der Luger in der Hand. Schwungvoll, zackig. Da löst sich ein Schuss und trifft den Kaiser zwischen die Augen.
Ihr fragt euch jetzt sicher, wie das gehen kann, wenn der Kaiser doch in den Niederlanden im Exil saß. Es war nämlich so: Der Vater vom König war immer noch ein Kaisertreuer, weswegen er auch so gegen die Roten gehetzt hat, weil die nach seiner Meinung ja Schuld waren am verlorenen Krieg. Außerdem hat er sich nie wieder so gut gefühlt wie damals im Krieg. So kurz vor dem Sterben, da fühlt man sich eben so richtig lebendig. Nicht einmal im Bett mit der Mutti hat er sich so vital gefühlt, obwohl der Orgasmus ja im Französischen auch „der kleine Tod“ genannt wird. Daran hat die Mutti wiederum nicht einmal denken wollen und weil der Vati sowieso einen Brass auf die Franzosen gehabt hat seit dem Krieg, hätt sie es schon dreimal nicht aussprechen dürfen, weil: sonst hätt es Krieg gegeben im Schlafzimmer. Tja. Wie es der Exil-Kaiser mit französischen Lehnwörtern gehalten hat, ist mir nicht bekannt, auf jeden Fall hat der König-Vater immer noch ein Bild von seinem vergötterten Wilhelm in der Stube hängen gehabt.
Der Bartholomäus ist vom Schuss dermaßen erschrocken, dass er es auf einmal ganz pressant – auch so ein sprachliches Überbleibsel der Franzosen auf bayerischem Hoheitsgebiet – gehabt und sich gedacht hat, wenn er jetzt nicht gleich aufs Töpfchen geht, dann gibt’s eine Sturzflut. Und nachdem die Mutter den Boden gewohnheitsmäßig zweimal wöchentlich gebohnert hat, wär diese Flut nicht ganz so schnell aufgesaugt worden – was der Bartholomäus natürlich nicht gedacht hat, weil er zwar schon ein gescheites Bürscherl war, aber so gescheit auch wieder nicht. Es war wieder einmal mehr so ein Gefühl, wie wenn er eben dringend … Also hat er sich den Stahlhelm vom Vati geschnappt, vor sich hingestellt und hineingepieselt und schon ist es ihm wieder besser gegangen, auch wenn das komische Gefühl dadurch nicht ganz weggegangen ist.
Der letzte Tropfen ist gerade so in den Stahlhelm hineingetröpfelt, da hört er die Schritte vom Vati, draußen vor der Tür. Er rennt davon, in sein Kinderzimmer, hört: „Ja, was is denn da los!“ Und ein Platschen.
Das war das erste und das letzte Mal, dass der König Senior den Boden gewichst hat, sofern man das in dem Fall überhaupt sagen kann, weil so emanzipiert waren die Mannsbilder damals noch nicht und der Vati vom Bartholomäus schon dreimal nicht. Der hat seinen Spross lieber angeplärrt: „Du Esel! Was hast du dir dabei gedacht?“
Auf zur Folterkammer
Der Regen drischt am Feuerkessel hinter dem Marktplatz auf den König ein. Trotzdem zeigt er Haltung und stolpert nicht über das Kopfsteinpflaster. Schreitet bergab durch das enge Rosmaringässchen, in dem er auf einmal einen unbändigen Hunger auf Kartoffeln kriegt; mit Rosmarin. Wie sie seine Mutter kocht, wie keine andere – wo ihn seine Mutter beim Essen schimpft und straft wie keine andere. Wenn auch nur der kleinste Rosmarinzweig neben dem Teller oder gar auf dem Boden landet … Wär er ohne sie jetzt da? Vorwärtsgetrieben von zwei iranischen SAVAK-Geheimagenten, die nicht wissen, ob sie ihn wie einen Betrüger oder ihren verehrten Schah von Persien behandeln sollen. Berüchtigt wegen ihrer Foltermethoden. Die selbst ihr royaler Dienstherr offiziell nicht kennt, damit er nicht dafür belangt werden kann.
Und das ist jetzt der gravierende Unterschied zwischen dem Schah und dem König. Der König kennt die Foltermethoden, wissentlich, und das würde er auch jederzeit zugeben. Ob das in der Situation, in der er steckt, einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber du vielleicht.
Stumm stolpern sie hinter ihm her, die Agenten, über das bucklige Kopfsteinpflaster, weil sie es eben nicht so gut kennen wie der König. Was ihm sehr zupasskommt, weil ein Schah nicht zu stolpern hat. Er bleibt sogar einmal kurz stehen, während sie die Mauer aus grauem Stein passieren, aus der sich nur manchmal ein grünes Pflanzerl den Weg in die Freiheit bahnt, dreht sich um, nimmt die Sonnenbrille ab und sagt mit tiefer Stimme: „Bewahren Sie Contenance, meine Herren, wir sind hier zu Gast.“
Die Steinfassaden der Häuser verengen das Gässchen, als würden sich weitere Wolken vor die Sonne schieben. Die Tropfen schlagen trotzdem noch auf den König ein, dem der Regen das Genick entlang unter Anzug, Hemd und Unterhemd läuft. Seine Schultern werden nass und schwer. Er hat das Gefühl, von den Fassaden erdrückt zu werden. Nur der Rundbogen der Tür des roten Fachwerkhauses und die steinern umrahmten Fenster lassen ihn stellenweise aufatmen. An diesem Nachmittag mit abnehmendem Licht weisen die iranischen Agenten dem König den Weg nach rechts in die Kirchgasse, schon ein bisserl vorsichtiger nach der Rüge vom Chef. Genau in dem Moment biegt auch ein junger Schutzmann ums Eck. Und zwar exakt der, der ihn gestern Abend vorm Hotel Eisenhut abgeklopft und durchsucht hat, bevor er zur Farah Diba rein ist. Der Schandi ist einen Kopf kürzer, also ungefähr so groß wie der kleinere der zwei Agenten, schießt ums Eck und rennt mit seinem kantigen Schädel genau in dem König seinen Krawattenknoten. Und zuckt dermaßen zusammen, dass der König meint: Jetzt fällt er gleich um. Der Schutzmann sagt aber dann nur mechanisch: „Grüß Gott.“ Und lässt den König stehen.
In der Kirchgasse weitet sich die Straße. Die Jakobskirche vor ihnen. Der Blick durch das Tor stadtauswärts: der graue Himmel. Vögel. Freiheit! Eine letzte Möglichkeit zur Flucht. Um des Überlebens willen.
Als hätt der Größere dem König seine Gedanken geahnt, packt er ihn unauffällig am Arm, schiebt ihn weiter. Über die Straße. Sein Griff: eisern. Der Applaus der Rothenburger: vergangen. Gestern, beschirmt vom Bürgermeister Ledertheil. Farah Diba neben ihm. In der weltbekannten Kirche hat Dekan Kirchenrat Kelber den berühmten Riemenschneider Heilig-Blut-Altar erklärt. Ja, Blut wird fließen. Auch heute: Königs Blut. Ob die Abendmahlszene aus einem Holz geschnitzt sei, hat Farah Diba wissen wollen. Oh, Farah.
In der abschüssigen Klostergasse legen die Agenten einen Zahn zu. Der Große vor dem König, der Stempf hinter ihm. Auf dem rechten Gehweg, wie es sich gehört, nur nicht auffallen. Die wenigen Passanten, die ihnen im Regenwetter entgegenkommen, verstecken sich unter ihrem Schirm.
Wenn der König nach dem winzigen Birnbaum, der dort drüben am Haus sprießt, jetzt rechts abbiegen würde, wäre er in wenigen Minuten zuhause, bei seiner Anna. Tät erfahren, ob Aurelia wieder frei oder ob ein Anwalt informiert worden ist. Es geht bergab, das Regenwasser fließt mit. Die riesige, hohe Mauer vom Klostergarten neben ihnen.
Eine schwarze Katze huscht über der Straße, der Große kickt nach ihr wie nach einem Ball, dass sie laut „Zzzzzzzsccccht“, zwei Meter vor ihm im Dreck landet, sich aufrappelt und davonrennt.
König muss daran denken, wie sich heute Morgen die Farah Diba an ihn geschmiegt hat, während sie auf das windschiefe Fachwerkhäuserl in der Burggasse zugehen; weil es sich mit dem Rücken an den Sandsteinbau nebenan lehnt und mit der anderen Seite an die Burgmauer. Eingewuchert von giftigem Efeu. Mit einem nackerten Stein-Jesus an der Fassade, der auf einem Sockel, frierend, die Hände vor der Brust verschränkt. Immerhin geschützt von einem Dacherl mit einem kleinen Kreuz darauf. Ob irgendwer den König vor den zwei SAVAK-Geheimagenten schützen wird?
Kurz vor der Burgmauer überholt ihn der Kleine, der Lehrling. Sie schauen alle zwei ja eigentlich gleich aus; schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, schwarze Schuhe, schwarze Haare, schwarze Sonnenbrille. Nur das Hemd ist jeweils weiß, wie beim König auch. Noch. Blutspritzer würde man darauf sofort erkennen. Unterscheiden kann der König die beiden bis jetzt nur anhand ihrer Körpergröße. Aber auch das wird sich ändern. Weil, die Brutalität eines Menschen – zu was wer fähig ist – zeigt sich erst, wenn er das tun soll, was ihm befohlen wird und mit dem er meint, einer Sache zu dienen.
Der Kleine hält unter einer Lampe, die aus der Mauer des Burghotels hervorsticht und in der früher eine Kerze gelodert hat. Er schlägt dreimal mit dem eisernen Klopfer gegen die massive, schnörkelvoll verzierte Tür. Über dem Klopfer eine Burg. Die Tür öffnet sich: Die Folterkammer erwartet ihn.
Ausrufung des Kaisers
Der Bartholomäus kann von Glück sagen, dass er kein Esel war und vor allem kein Esel in Persien. Weil, der Vater von seinem Bruder im Geburtstage, der hat nämlich ganz schön aufgedreht da drüben in seinem Teil des asiatischen Kontinents. Viel mehr als sein Vater daheim, der nach dem großen Krieg erst einmal wieder Land gewinnen hat müssen unter den Füßen. Aber wie es halt so ist, wenn einem schon ganz viel gehört, Land, Gold und Geld, dann möchte man immer mehr haben. Der Vati hätte in diesem Zusammenhang den Bertold Auerbach zitiert: „Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte.“ Und die Mutter hätte genickt, weil die gar nicht genug Ordnung hat haben können, auch in Zufriedenheitsdingen.
So oder so hat der Bartholomäus froh sein können, dass er kein Esel in Persien war, vor allem nicht zu jener Zeit und vor allem nicht der Esel. Es war nämlich so, dass der Vati vom Schah ganz schön zintig geworden ist, wenn irgendwer auch nur einen Zeh auf seinen Grund gesetzt hat. Selbst wenn es nur ein Eselzeh war. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Esel auch Zehen haben.
Auf alle Fälle ist der Esel, weil er eben ein Esel war, einfach auf den Grund und Boden vom Schah gelaufen, der früher mal einem Bauern gehört hat. Genauer gesagt dem Bauern, dem auch der Esel gehört hat; es war ganz einfach, auf den Grund vom Schah zu laufen, weil der damals so viel davon gehabt hat. Sein Besitzer, der lumpige Bauer, hat sogar noch versucht, ihn davon abzuhalten, aber störrisch, wie Esel nun mal sind – und das hat die Spezies mit dem Schah und dem Bartholomäus gemein –, ist er einfach weitergelaufen. Der Bauer hat gezogen und geschnauft wie eine asthmatische Bergziege, aber vergebens. Der Esel hat in die erste Distel gebissen, die ihm vor sein Maul gekommen ist, und hat sie genüsslich verschlungen. Wobei man sich da schon fragt, wie die Esel das machen, weil, wenn der Bartholomäus in eine Distel gebissen hätte, da mag man gar nicht dran denken, so weh tut der Gedanke schon. Es wäre sicherlich das erste und letzte Mal gewesen, dass er in diese Ausformung der Flora gebissen hätte. So, wie es auch für den Esel seine letzte Distel war.
Denn der Schah war dermaßen stinkig, dass er die ganzen Bauern der Region, nicht nur den Besitzer von dem Esel, die übrigens eine Eselin war – namens Maneli, was „Bleib bei mir“ heißt –, zusammengetrommelt hat, als Publikum. Und wer nicht gekommen ist, musste ihm hinterher zur Strafe einen Esel abliefern. Dazu musst du wissen, dass die meisten noch nicht einmal einen einzigen Esel hatten und schon damals bitterarm waren, eingeweichtes Stroh und Dattelkerne gegessen haben, die vorher noch einmal vom Schah abgelutscht worden waren; was man als Ehre bezeichnen hätte können, auch wenn sich von Ehre niemand was kaufen kann und vom Schladderadatz vom Schah, der eh schon wieder eingetrocknet war, bis die Kerne bei den Bauern ankamen, schon gleich dreimal nicht.
Und dann stehen da also die ganzen Bauern um die Maneli herum. Daneben der Besitzer, der eine ganz besondere Beziehung zu ihr gehabt hat, weil er schon über sechzig Jahre alt und Zeit seines Lebens Junggeselle gewesen war. Auf alle Fälle fieberte er mit, ob jetzt tatsächlich das passieren würde, was der Schah angekündigt hat. Und es passiert: Ein Schuss fällt, die Maneli kurz darauf, die Distel vom Schah noch in ihrem Enddarm. Beißt sie ins Gras.
1925, der kleine Schah und der Bartholomäus sind noch immer richtige Rotzlöffel, zieht die Familie König nach Rothenburg ob der Tauber. Die Eltern sind froh, der Bartholomäus ist traurig. Ich glaube sogar, mit dem Umzug, mit dem Abschied vom Glashaus, ist so was wie eine Grundmelancholie im König angelegt worden. Weil er jeden Tag im Glashaus, in den Filmstudios gewesen ist. Und die Else war so etwas wie seine Ersatzmutter geworden, bei der er sich wohler gefühlt hat als bei seiner leiblichen Mutter. Die hat ihn ein Kind sein lassen, im Dreck spielen, auf Bäume klettern, von wo aus er dann die Filmaufnahmen beobachten hat können. Und einmal hat er sogar mitspielen dürfen, im Stummfilm Der Brunnen des Wahnsinns. Vielleicht ist er dir aufgefallen, neben der Beari, der Oberpriesterin, wenn du den Film gesehen hast.
Der Schwermut im König ist geblieben, obwohl er sich in Rothenburg sofort daheim gefühlt hat. Nicht wegen der Menschen oder seiner Eltern – bei denen hat er sich eh nie daheim gefühlt, weil, was ist das für ein Zuhause, wo du als Kind keinen Saustall machen darfst, wo in deinem Hirn doch ein ständiger Saustall herrscht, weil du erst einmal die Welt ordnen musst. Und dann sollst du auch noch dein eigenes Zimmer mit den Spielsachen ordnen – das der König doch tatsächlich gehabt hat, was zu der Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war. Aber das Glashaus hat ihm gefehlt, das er immer noch so genannt hat, obwohl es der Hagel zerdeppert hatte wie der Vater die Vase, das Erbstück, der Mutter. Damals war nicht nur eine Unordnung im Haus, sondern auch eine Wut in der Mutter, dass der Vater sofort zum Wirt und nach drei Tagen erst wieder zurückgekommen ist mit einem Blick, als hätte er den Jesus eigenhändig ans Kreuz genagelt. Zum Glück hat er das nicht gemacht; weil, zwei linke Hände. Und es hat schon gereicht, dass er ein blaues Auge gehabt hat und die Mutter eine wehe rechte Hand. Nein, zuhause hat sich der König in Rothenburg ob der Tauber gefühlt, weil die ganze Stadt eine mittelalterliche Filmkulisse war.
Durch den Umzug hat die Mutter die ersten Wochen ganz vergessen, dem König die Haare zu schneiden, weshalb der Vater gesagt hat: „Schaust ja aus wie ein Sandler.“ Er hätte auch sagen können, dass er ausschaut wie der Jesus, aber dann wäre es ja keine Beleidigung mehr gewesen. Also für den Vater, für die Mutter schon.
Der König hat sich eigentlich ganz gut gefallen mit den Haaren, die noch nicht einmal richtig lang waren. Weil er damit ein bisschen ausgeschaut hat wie der Oskar Marion in seiner Ritterrüstung. Als Burgli, der Hauptmann in florentinischen Diensten in dem Film Monna Vanna, der auch im Glashaus in Grünwald gedreht worden ist. Aber an diesem Tag hat die Mutter keinen Radi gekannt. Die Schere erschien dem Bartholomäus riesengroß, als bekäme sie sonst die Hecke im Garten vor die Klingen, und der Kamm, der rupfte wie der Pfarrer, als er den Bartholomäus in der Schule beim Mädl-Ärgern erwischt und geschopft hatte. Der König kam sich vor wie das Unkraut, das aus dem Gemüsebeet hinter dem neuen Haus in Rothenburg gezogen wurde – was die Mutter jeden Tag gemacht hat, weil auch in einem Beet natürlich Ordnung herrschen musste. Wenn sie damit fertig war, hat sie sich die erdigen Hände in der hölzernen Regentonne gewaschen, an der Gartenschürze abgetrocknet und gesagt: „So!“
Auch jetzt wartete der Bartholomäus darauf, dass die Mutter endlich „So!“ sagen würde, wie die Haare in seine Augen flogen, faserig an seinem Mund pappten und ihn im Genick juckten. Aber da konnte er lange darauf warten. Weil für die Mutter die Haare vieeeel zu lang waren, schnippelte sie eine Ewigkeit daran herum. Nahm immer wieder mit dem Kamm die Haare auf, um die korrekte Länge abzumessen.
Die Tränen drückten sich aus seinem Bauch, über seinen Hals und die Nase bis in die Augen. Bis, ja, bis der Mutter auf einmal die Haare ausfielen, sie ebenso Haare ließ, mit jedem Schnitt um seinen Kopf herum ein wenig mehr, und sie irgendwann nur noch mit einer Glatze vor dem Spiegel stand. Das Erstaunen drückte die Tränen dorthin zurück, wo sie hergekommen waren, und sein Bauch entkrampfte sich wieder. Und während seine Haare weiter fielen, wuchsen ihr Haare auf dem Kinn, um die Lippen herum, auf den Zähnen, den Backen, bis sie irgendwann wie ein alter Barbier aussah. Der Mutter schien es nicht aufzufallen, sie schnippelte munter weiter an Bartholomäus’ Haaren herum. Und diese Veränderung der Realität, seiner Realität, schenkte seinem Geist eine derartige Freiheit, dass der kleine, über die Maßen gescheite Bub auf einmal darüber nachdachte, ob die Mutter sich die Haare auch selber schnitt. Nicht zuletzt, weil er mitbekommen hatte, dass der Geldsäckel der Familie dieser Tage nicht gerade prall gefüllt war. Und dann dachte er darüber nach, ob sie dazu all jenen, und nur jenen, die Haare schnitt, die sich nicht selbst die Haare kürzten, wie ihm. Und da merkte er, dass sich ein Widerspruch auftat, wobei er es natürlich nicht Widerspruch nannte, sondern wieder einmal viel mehr fühlte, dass da irgendwas nicht stimmig war – wie damals, als er in den Soldaten-Stahlhelm des Vaters gepieselt hatte. Weil, wenn sie sich die Haare selbst schnitt, dann gehörte sie doch zu denen, denen sie die Haare mit der Schere bearbeiten musste … Falls ich mich jetzt nicht verhauen habe, wisst ihr vielleicht, was ich meine.
„So!“, sagte die Mutter. Womit der Bartholomäus auch den Knoten in seinem Kopf über das Friseusen-Paradoxon stehen ließ. Sie kämmte seine nahezu nicht mehr vorhandenen Haare, schüttelte das Handtuch aus, ja, tatsächlich, sie schüttelte es aus und verteilte die Haare dadurch kreuz und quer im Bad, um den Bartholomäus herum. Ihn steckte sie mit dem Kopf unter den Wasserhahn, noch bevor sie die Temperatur geprüft hatte, weshalb ihm wegen des eisernen Griffes der Mutter nichts anderes übrigblieb, als die Zähne zusammenzubeißen, weil sich das Wasser erst eiskalt und dann brühend heiß über seinen kahlen Schädel ergoss. Die Aula-Seife aus Rothenburg schmirgelte, wieder heiß, dann kalt, dann auch noch brennender Schaum in seinen Augen. Nur kurz rubbelte die Mutter den immer noch wehen Kinderkopf, dann überließ sie ihn sich selbst und seinem Schmerz. Denn die Haare mussten zusammengekehrt, das Waschbecken gereinigt und zuletzt noch der Spiegel abgewischt werden. Der Besen schlug gegen das Schäufelchen, die Haare türmten sich darauf und die Mutter trug sie nach draußen zur Tonne im Hof.
Da erst sah Bartholomäus, was sie ihm angetan hatte. Er erkannte sich nicht wieder! Er war ein anderer Mensch geworden! Jetzt schossen die Tränen aus seinen Augen. Flossen über sein Gesicht. Das bin ja gar nicht mehr ich!
Vor dem Fenster war der Himmel gerade noch wolkenverhangen gewesen. Doch jetzt schob sich ein Sonnenstrahl durch, fiel auf den sauber geputzten Badezimmerspiegel und von dort aus in Bartholomäus’ Gesicht. Wäre er nicht geblendet gewesen, hätte er sich noch weiter in sein Elend versenken können. Aber er war eben geblendet, was ihm wiederum ermöglichte, Abstand von seinem Schrecken und damit dem Schmerz der Entfremdung zu gewinnen. Und Raum für all die Bilder aus seiner Realität, die sich nun zu einem Ganzen fügten: seine glatzköpfige, bärtige Mutter und er, der nicht mehr er war.
Was für ein Kraft entstand aus dieser Kombination, aus dieser Erkenntnis: eine Mutter, deren zwanghafte Ordnung durch einen Bart und eine Schere zunichte gemacht worden war und damit auch ihre Macht über ihn. Die ihre Herrschaft nicht nur durch Schere und Kamm ausgeübt hatte, sondern durch den alltäglichen Zwang, penible, preußische Ordnung zu halten, obwohl sie doch aus Oberbayern stammten und jetzt in Franken lebten. Ja, es steckte eine enorme Kraft in dieser Erkenntnis, eine Art Freiheit, die durch die Veränderung des Äußeren, ja, des Menschen Bartholomäus König entstanden war.
Ab jenem Tag trug der Barholomäus diese Kraft in sich und ich traue mich zu behaupten, dass er an diesem Tag zum König wurde, der im Laufe seines Lebens danach strebte, dieses Sein zu perfektionieren.
Der gleichaltrige Schah-Sohn, zu dem der König zu Fuß mindestens 800 Stunden und wahrscheinlich noch viel länger unterwegs gewesen wäre, bereitete sich indes auf die Feierlichkeiten zur Ausrufung seines Vaters zum Schah von Persien vor. Auch er saß vor einem Spiegel, seine Augenbrauen wurden mit einem Faden gezupft, was ihm ebenfalls die Tränen in die Augen trieb, aber er wusste: Würde auch nur eine davon aus seinen Augen rollen, durfte er sich der scharfen Rüge seiner Kinderpflegerin gewiss sein.
Während sich der König nach seinem Initiationsritus noch in seiner Erleuchtung sonnte, ging die Tür zum Bad auf. „Mutti, i hob die Stell! Direktor werd i!“, rief König Senior in urwüchsigem Altbairisch, das er vor seinen Mitmenschen zukünftig, als der Herr Direktor, tunlichst zu verbergen suchte. Genau wie König Junior seine Fähigkeit zur Mimikry.
„Der junge Herr wird uns noch vor manches Rätsel stellen“, fällt mir da spontan ein. Also genau das, was Generalfeldmarschall Moltke auch über Kaiser Wilhelm II. gesagt hat.