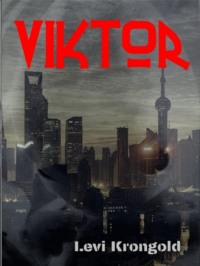Kitabı oku: «Viktor», sayfa 3
Der Platz vor de. »Fleur«, ein in die Jahre gekommenes kleines französisches Restaurant, war genauso runtergekommen wie alle anderen Gebäude auch. Ich befand mich im Botanikerviertel, einer Promeniermeile aus besseren Zeiten, ganz in der Nähe des Botanischen Gartens und des kleinen Kanals, der die Metropole im Norden teilt. Einige imposante restaurierte Jugendstilbrücken führen zur anderen Seite des Viertels. Dahinter liegt heute das ehemalige Studentenviertel, aufgrund der Nähe der Universität so benannt und der Tatsache, dass dort wegen der damals schon heruntergekommenen Bausubstanz billige Wohnungen zu haben waren. Inzwischen wohnten dort in enger Nachbarschaft mit imposanten Büroneubauten vor allem Sozialhilfeempfänger in städtischen Sozialwohnungen, die ihnen zugewiesen worden waren. Die ganze Gegend weist eine mindestens doppelte Dichte an Überwachungskameras aus, wie der restliche Teil der Stadt zusammengenommen. Allerdings gibt es auch hier die höchste Kriminalitätsrate der gesamten Stadt. Hier und da kreisen plötzlich Polizeidrohnen über den Plätzen, scannen alles mit Infrarotkameras, um kurz darauf blitzartig wieder zu verschwinden. Nicht gerade ein Ort, wo man gerne nachts alleine rumsteht, so wie ich jetzt. Ich hatte kaum eine Minute unschlüssig auf dem Platz gestanden, als schon eine dieser Drohnen über mir kreiste. Ich setzte mit meinem Arm-Pad meinen Code ab, worauf sie sich entfernte. Wie sollte ich Frau Montenièr hier finden? Ich schaute mich um, ob irgendwo eine ausgeflippte Person die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog oder in einer Ecke oder am Fuß einer Brücke eine zusammengekauerte Gestalt hockte. Fehlanzeige. Zweimal verfolgte ich eine Person, die die Gesuchte hätte sein können, sich jedoch als Prostituierte herausstellte. Die hätte aber ebensowenig hier sein dürfen. Immerhin wies diese Tatsache darauf hin, dass die staatliche Überwachung der Plätze doch nicht so lückenlos sein konnte, wie allgemein angenommen. Eine Überlegung, die die ganze Angelegenheit in ein anderes Licht rückte. Vielleicht war gar nichts Geheimnisvolles am Verschwinden der Frau, sondern die Überwachung war nur einfach lückenhaft. Dieser Gedanke beruhigte mich insofern, als die Wahrscheinlichkeit, unliebsamen Kontakt mit einer Terrorgruppe zu bekommen, etwas geringer erschien. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Ich hatte die Nase voll, war frustriert und müde und hungrig, deshalb beschloss ich, in. »Fleur« zu gehen, um dort etwas zu mir zu nehmen.
Trotz des antiquierten Eindrucks, den das kleine Restaurant machte, öffnete sich die Tür erst, nachdem Chip und Iris gescannt waren. Drinnen umfing mich gedämpftes Lampenlicht, in dem einige wenige Holztische zu sehen waren, die in kleinen mit riesigen Tonvasen und künstlichen kalkweißen Mauern dekorierten Nischen untergebracht waren. Überall hingen Sträuße getrockneten Lavendels an den Wänden und von der Decke allerlei antikes landwirtschaftliches Gerät, welches zweckentfremdet dort angeschraubt war.
Es dauerte eine Weile bis ein runtergekommener Wirt mit Baskenmütze und schmierigem Hemd nach meinen Wünschen fragte.
»Was Kleines, bitte!«, forderte ich müde. Er stieß einen kurzen Lacher aus.
»Das findest du eher draußen!« Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass er die Nutten auf dem Platz meinte. Ich lächelte verlegen.
»Ich möchte speisen, was Kleines.«
»Mon dieu, Sie befinden sich in einem französischen Restaurant, da ist alles klein, wissen Sie?«
Ich lächelte zurück. »Lassen Sie mich raten, nur die Preise sind groß?«
Er lachte kurz auf, wobei sich sein fast zahnloser Mund unter einem kleinen Schnäuzer öffnete, aus dem ein so derartig pestilenzartiger Tabakgeruch entströmte, dass ich kurz den Atem anhalten musste. Dann klopfte er mir herzhaft auf die Schulter, drehte sich um, um eine Karaffe mit einer roten Flüssigkeit auf einer Anrichte hinter sich zu ergreifen und mir wortlos auf den Tisch zu stellen.
Ich schaute ihn fragend an. »Was ist das?«
»Rotwein!«, gab er wie selbstverständlich zurück, wobei sein Blick einen stillen Triumpf ausdrückte, als er meine Überraschung bemerkte. Alkoholhaltige Getränke sind seit Langem nicht mehr legal zu bekommen!
Danach reichte er mir das Pad mit der Speisekarte. »Wenn ich etwas empfehlen dürfte, das Lamm muss noch weg«, lachte er, um danach wieder mit enthusiastischem Blick beide Hände an die Lippen zu führen. »Es ist süperb. Aber diese Trottel hier können das nicht richtig schätzen, deshalb hebe ich es für Gäste wie Sie auf.«
»Richtiges Fleisch?«, fragte ich überrascht.
Er verzog beleidigt das Gesicht. »Aber natürlich, was halten Sie von mir?«
Ich war erstaunt. Richtiges Fleisch hatte ich schon lange nicht mehr gegessen.
»Sie sind nicht von hier?«, fragte er beiläufig.
»Nicht aus diesem Viertel.«
Er nickte. »Also das Lamm?«
Ich gab mich geschlagen, weil ich mich viel zu erschöpft fühlte, es noch in einem anderen Lokal zu versuchen.
Nachdem ich die Lippenstiftspuren an dem Glas auf meinem Tisch mittels einer Ecke des Tischtuches beseitigt hatte und mich bediente, stellte ich fest, dass der Wein ausgezeichnet schmeckte.
Es dauerte allerdings gut zwei komplette Baguettebrote, die der Wirt mir reichte, um mir die Wartezeit zu verkürzen und über 30 Minuten, bis er mit einer kleinen Steingutschale zurückkehrte, in der eine winzige Portion würzig duftenden Lammfleisches neben einigen winzigen Bratkartoffelwürfeln und Bohnen ‚übersichtlich‘ dekoriert war. Darüber lag ein Rosmarinzweig, dessen Ende in einer Knoblauch-Kräuter- Paste unterging.
Ich schaute ihn fassungslos an, als er diese in der Geste eines Fünfsterne-Chefkochs vor mir plazierte.
»Fehlt etwas?«, fragte er mit gespieltem Erstaunen.
Ich zögerte. »Die Lupe?«
Er brach in ein wieherndes Gelächter aus, schlug mir wiederum mehrfach auf die Schulter und entfernte sich dann kopfschüttelnd und laut lachend.
Wider Erwarten schmeckte das Lamm köstlich, ich möchte sogar sagen, es war wohl das beste, was ich jemals gegessen hatte. Dies und die Tatsache, dass der Wein ein Übriges dazugab, verbesserte meine Stimmung erheblich. Einer plötzlichen Eingebung folgend, beschloss ich, den Wirt ins Vertrauen zu ziehen und nach Frau Montenièr zu fragen. Vielleicht kannte er sie ja zufällig?
Als er mir das Terminal reichte, um abzurechnen und ich mich überschwänglich einschließlich eines reichlichen Trinkgeldes bedankte, zeigte ich ihm das Bild von Frau Montenièr.
»Kennen Sie diese Frau vielleicht? Ich sollte mich mit ihr hier treffen.«
Er stutzte einen Moment, schaute erst das Bild, dann mich an, während sich seine Miene schlagartig verdüsterte. Dann kratze er sich geräuschvoll am Hinterkopf, wobei er seine Baskenmütze bis nach vorne in die Stirn schob. »Ne, nie gesehen!«, antwortete er schroff. »Sind Sie 'nen Bulle?«
»Nein, ein Bekannter«, log ich. Er schaute mich grimmig an und schnaubte scharf durch die Nase aus. »Ein Bekannter«, echote er, dann rief er in Richtung Küche. »Claude, hilf dem Herrn doch mal in den Mantel, der Herr möchte gehen!«
Verblüfft schaute ich zur Küchentür hinüber, aus der ein Bulle von einem Koch trat. Dessen Kittel war noch schmutziger als der Fußboden, doch sein kantiges Gesicht ließ erkennen, dass er sich nicht nur als Hilfskoch betätigte, sondern mindestens eine langjährige Karriere als Boxchampion hinter sich haben musste.
Auf ein Kopfnicken in meine Richtung durch den Chef des Hauses setzte sich dieser wortlos in meine Richtung in Bewegung.
»Entschuldigen Sie, vielleicht ist das ein Missverständnis?«, versuchte ich es.
»Hau ab!«, brummte der Riese.
»Aber, ich bitte Sie...«, weiter kam ich nicht, dann gingen bei mir die Lichter aus.
Ich wachte einige Zeit später durchnässt vom Regen mit teuflisch schmerzendem Kopf auf dem Straßenpflaster einer Seitenstraße liegend auf.
Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich erheben konnte, weil mir schwindelte und höllisch übel war.
Als ich es schließlich geschafft hatte, mich an einer Hauswand aufzurichten, musste ich mich übergeben. Benommen blieb ich stehen, mich mit dem Arm an der Wand abstützend, bis ich wieder einigermaßen klar sehen konnte. Ich muss hier weg! Wo sind diese verdammten Polizeidrohnen, wenn man sie braucht? Benommen torkelte ich einige Schritte weit. Ich musste ein AuTaX rufen! Allerdings stellte ich fest, dass mein Arm-Pad und mein Touch-Phone fehlten und auch mein Chip verschwunden war.
Wie sollte ich jetzt mit jemandem Kontakt aufnehmen? Verzweifelt hielt ich mich an einer Laterne fest, um nicht wieder umzufallen.
Verdammte Scheiße!
Was danach kam, ist nur noch bruchstückhaft in meiner Erinnerung. Irgendwann fragte ein Frauengesicht. »Was ist mit ihm?«
»Komm da weg, Suzanne, komm da weg«, hörte ich wie aus weiter Ferne eine schroffe Männerstimme befehlen. Dann vernahm ich ein Dröhnen, später meinte ich, blinkende Lichter wahrzunehmen, bis ich schließlich in einem mäßig verdunkelten Raum aufwachte.
Dieser stellte sich als Krankenzimmer in einer Überwachungseinheit heraus. Ein Infusionsschlauch schien zu meinem linken Handgelenk zu führen, ich konnte ihn allerdings nur aus einem Auge sehen, dass linke war monströs zugeschwollen. Neben meinem Bett flimmerte ein Monitor, der jedoch stumm geschaltet war und irgendeine Soap Opera im Programm hatte.
Wenig später kam eine uniformierte Frau von der Sicherheit in Begleitung eines Krankenpflegers und erkundigte sich nach meinen Identitätsausweisen und meinem Befinden, in dieser Reihenfolge. Ich stellte fest, dass mir das Sprechen schwerfiel, deswegen sagte ich nur. »Raskovnik, bitte benachrichtigen Sie Raskovnik von der Abteilung III der Personenschutzbehörde.«
Es dauerte eine geraume Weile, während der ich mich bemühte, wieder Anschluss an die Geschehnisse zu bekommen, um meine jetzige Lage richtig einzuschätzen. Das Erste, woran ich mich erinnerte, war ein zahnloser Mund, dem ekelerregender Tabakgeruch entströmte und an ein schrilles Gelächter, in das sich eine weibliche Stimme mischte, die immerz. »Was ist mit ihm?«, ausrief. Ich konnte mich nur nicht besinnen, in welchem Zusammenhang diese Erinnerungsfetzen standen. Wenig später allerdings, nachdem sich die SecurityDame in Begleitung eines Mediziners vor meinem Krankenbett einfand, wurde ich auf unangenehme Weise an die Zusammenhänge erinnert.
»Ich bin Dr. Ramso, Herr Kollege Krongold, können Sie mich verstehen?«, ließ er sich neben mir vernehmen.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«, versuchte ich mühsam zu artikulieren. Er lachte. »Das war in der Tat etwas mühsam. Wissen Sie, dass Sie kurz davor standen, in einer Arrestzelle zu landen?«
Ich verneinte, denn mein Unterkiefergelenk schmerzte zu sehr, um es mit unnötigen Worten zu foltern.
»Erst durch den Iris- und Daumenscan konnten wir Ihre Identität ermitteln. Wo sind denn ihre Identitätsnachweise geblieben? Sind Sie ausgeraubt worden?«
»Scheint so«, flüsterte ich.
»Sie haben offenbar ganz schön was abbekommen«, fuhr er fröhlich fort. »aber keine Angst, es ist zum Glück nichts gebrochen. Wir erwarten keine bleibenden Schäden. Allerdings haben sie einige unschöne blaue Flecken im Gesicht.«
Ich betastete meinen Kopf, an dem ich nun ein dickes Mullpflaster über dem linken Auge feststellen konnte. Je mehr ich wieder zu mir kam, desto mehr schmerzende Stellen stellte ich stöhnend überall am Körper fest.
»Möchten Sie ein Schmerzmittel haben?«, fragte er nach.
Als ich nickte, ordnete er etwas dem im Hintergrund wartenden Krankenpfleger an, der sich daraufhin rasch entfernte.
»Gut, Herr Kollege, ich lasse Sie jetzt mit der netten Dame von der Sicherheit alleine, die hat noch einige Fragen an Sie, nicht wahr?«
Die Dame von der Sicherheit, eine Polizistin in Zivil, stellte sich als Frau Meyerring vor. Sie hatte einen unangenehm nach saurem Schweiß riechenden Körpergeruch, was wohl auch von ihrem erheblichen Übergewicht herrührte. Das maskenhaft geschminkte Gesicht mit den nach oben ausgezogenen tätowierten Augenbrauen und dem Permanent Make-up der Augenlider und der schmalen Lippen passten insgesamt zum negativen Eindruck, den sie auf mich machte.
»Herr, ähem, Krongold, richtig?«
Ich nickte.
»Ich muss Ihnen einige Fragen stellen.«
Diesmal verzichtete ich auf das Nicken. Sie fuhr allerdings auch bereits mit der Fragerei fort.
»Sie haben uns gebeten, einen gewissen Raskovnik in Ihrem Amt zu benachrichtigen?«
Wieder nickte ich brav.
»Nun«, hüstelte sie und sah mich streng an. »Ein solcher Herr ist dort nicht bekannt.«
Hä? Ich glaubte mich verhört zu haben.
»Tut mir leid. Er ist im Personalverzeichnis ihrer Dienststelle nicht aufgeführt.«
»Nicht meine Abteilung, Referat Gefährdung und Sicherheit«, korrigierte ich sie.
»Ja, ja, das haben wir schon verstanden, nein, auch dort ist er nicht aufgeführt.«
»Ich bitte Sie, ich treffe ihn jeden Tag in der Cafeteria!«, entgegnete ich entrüstet, was ich sofort bereute, da es in meinem Kopf unangenehm zu brummen begann.
»Tut mir leid, aber könnten Sie den Namen falsch ausgesprochen haben?«
»Raskovnik, nein absolut nicht! Ich habe sogar eine Nachricht in der Eingangsbox, warten Sie!« Ich war gerade im Begriff mein Handgelenks-Pad zu aktivieren, als mir einfiel, dass es nicht da war. In diesem Zusammenhang fielen mir plötzlichen wieder mein Auftrag und andere Dinge ein, das französische Restaurant, der Wirt und irgend so ein bulliger Boxer, der mich wohl ins Jenseits befördern wollte.
Erschöpft ließ ich mich wieder zurück sinken. »Könnte ich bitte eine Schmerztablette bekommen?«
Die Securitydame klingelte nach dem Pfleger, der wohl schon vor der Tür gestanden haben musste, dem Tempo nach zu urteilen, mit dem er gleich ins Zimmer stürmte.
Ich dachte über ihre Worte nach, während ich den Becher mit Wasser leerte, den er mir hinhielt, um die Tablette zu schlukken. Natürlich, durchzuckte es mich. »Er ist ein ‚Grauer‘!«
»Ein bitte was?«
»Ein Grauer, er ist nicht offiziell aufgeführt. Ein Geheimdienstler!«
Der Art, wie sie versuchte, ihre Augenbrauen hochzuziehen, was wegen einer Botoxliftung offenbar nur unvollständig gelingen mochte, entnahm ich, dass sie mir nicht glaubte.
Sie räusperte sich vernehmlich. »Wir werden das nachprüfen. Was wollten Sie denn nachts in diesem Viertel, Herr Krongold?«
Die Art, wie sie meinen Namen aussprach, als habe sie auf etwas Saures gebissen missfiel mir eindeutig. Dennoch beschloss ich, es mit einer wahrheitsgemäßen Antwort zu versuchen.
»Ich wollte etwas essen!«
»Nachdem Sie sich bereits etwas aus dem Nutri-Shop nach Hause bestellt hatten?«
»Woher...?«
»Wir haben Nachforschungen angestellt!«, antwortete sie triumphierend, als habe sie gerade einen berufsmäßigen Lügner überführt und erwartete deshalb eine Beförderung.
»Sie glauben mir nicht?«
»Sagen wir es einmal so, vielleicht fällt Ihnen noch eine bessere Antwort ein!«
Ich wurde langsam ungeduldig, was sich unangenehm auf meine Kopfschmerzen auswirkte.
Erschöpft ließ ich mich in mein Kopfkissen zurücksinken.
»Ich arbeite an einem Fall und habe versucht eine Klientin dort ausfindig zu machen«, versuchte ich es nochmals mit der Wahrheit.
»Eine Klientin? Dort? Nachts? Nach Dienstschluss?«, fragte sie, jedes Wort wie einen Pfeil auf mich abschießend.
»Ja!«, antwortete ich pampig.
»Finden Sie das nicht auch ein bisschen ... seltsam?«
Zugegeben, wenn ich es mir recht überlege, fand ich es auch ungewöhnlich, wenn nicht sogar eigentlich völlig meschugge. Wie hatte ich mich nur auf einen derartigen Quatsch einlassen können?
»Raskovnik hat mich darum gebeten ...«, versuchte ich eine Rechtfertigung, merkte aber, kaum dass ich die Worte ausgesprochen hatte, dass ich einen kapitalen strategischen Fehler gemacht hatte.
»Raskovnik? Ja? Der, wie sagten Sie noch, ‚Graue‘?« Sie sah mich mit demselben schrägen Blick an, den man geflissentlich aufsetzt, wenn man am Verstand seines Gegenübers ernsthaft zweifelt, dies jedoch aus taktischen Gründen nicht offen aussprechen möchte.
Wie um diesen Blick noch verbal zu unterstreichen setzte sie noch nach. »Raskovnik, den es in Ihrem Amt nicht zu geben scheint.«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Sie sind Psychiater, nicht wahr?«, fuhr sie gnadenlos fort.
»Wie Sie wissen.«
»Sie sind mit der Untersuchung der geistigen Zurechnungsfähigkeit von Menschen beschäftigt, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sein könnten, nicht wahr?«
Ich zog es vor, nicht zu reagieren, sondern starrte statt dessen trotzig auf den Monitor an der Wand.
»Wann war denn ihr letzter Gesundheits-Check up, ihre letzte Personaluntersuchung?«
»Was soll das heißen?«, fuhr ich hoch.
»Wann?«, wiederholte sie und ihr Blick bekam etwas Lauerndes.
»Soweit ich mich erinnere vor einem Jahr ...«, versuchte ich mich zu erinnern.
»Vor 13 Monaten«, korrigierte sie mich.
»Wenn Sie es wissen, warum fragen Sie dann?«
»Ich stelle hier die Fragen!«, herrschte sie mich an.
»Wou«, entgegnete ich. »ich liebe dominante Frauen!«
»Die Scherze werden Ihnen gleich vergehen, Herr Krongold! Wann war ihre letzte Impfung gegen das Zoga Virus?«
»Sagen Sie es mir?«
»Es hätte vor zwei Monaten sein sollen. Warum sind Sie nicht hingegangen?«
Ehrlich gesagt, mochte ich dieses Impfgedöns nicht besonders. Es regte sich, aller medizinischen Einsicht zum Trotz, bei mir immer Widerstand, wenn etwas zwangsweise durchgeführt wurde. Natürlich kannte ich die Statistiken zu Genüge. Eine hundertprozentige Sicherheit, nicht an diesem heimtückischen Virus zu erkranken, gab es nicht, aber eine Durchimpfung der Bevölkerung um die 80 Prozent garantierte zumindest, dass Epidemien, wie die vor einigen Jahren in Südamerika, wenn es auch nur der brasilianische Dschungel war, nicht mehr vorkommen würden.
Damals waren mehr als zwei Millionen Menschen von der Seuche befallen, litten an diesen Symptomen, die ein Absterben der Hirnsubstanz zur Ursache hatten, sowie völliger geistiger Verblödung, schließlich Ausfall aller vegetativen Zentren im Körper und grauenhafter qualvoller Tod infolge stetigen Verfalls des Nervensystems. Damals wurde befürchtet, dass die Seuche sich explosionsartig über die ganze Welt ausbreiten würde, was nur dadurch verhindert werden konnte, dass man die gesamte brasilianische Bevölkerung durch den glücklicherweise eilig erzeugten Impfstoff immunisierte und entsprechende Impfzentren an Bahnhöfen und Flughäfen einrichtete. Ein Riesengeschäft für den Pharmakonzern.
Seither herrschte staatlich angeordneter Impfzwang in fast allen Ländern der Erde. Bürger aus Ländern, die nicht mitmachen konnten, erhielten keine Reiseerlaubnis oder wurden teils mittels drakonischer Strafen zur Impfung gezwungen. Obwohl die Datenlage über die Ausbreitung der Seuche, die punktuell immer wieder an verschiedenen Punkten auftrat, mehr als dürftig war, galten die Impfgegner als staatsgefährdend und wurden mit Entzug der Bürgerrechte bestraft. So konnte Kritik erst gar nicht in größerem Maße entstehen. Dummerweise hielt die Impfung lediglich maximal zwei Jahre und musste dann aufgefrischt werden.
Ich selbst hatte zwar in meinem Studium und meiner späteren Klinikzeit noch nie einen am Zoga-Virus Erkrankten gesehen, konnte aber alle Aspekte der Erkrankung theoretisch runterbeten. Und die Symptome waren alles andere als angenehm. Ich hätte also bereits der ersten Aufforderung zur Auffrischimpfung nachkommen sollen, hatte es aber bewusst oder unbewusst ‚vergessen‘, bis heute.
»Sie wissen, dass Ihnen dies nicht nur den Job kosten könnte?«
»Ich werde es nachholen«, seufzte ich ergeben.
»Worauf Sie sich verlassen können!«, zischte sie. »Was wollten Sie also wirklich in dem Viertel?«
Mir war klar, dass ich mit der Wahrheit nicht weiterkam. Aber welche Ausrede fiel mir ein, die die Dicke zufrieden stellen konnte?
Statt dessen sprach sie weiter. »Ich sag Ihnen, was Sie dort wollten! Sie wollten mit einem terroristischen Netzwerk Kontakt aufnehmen..!«
»Ich bitte Sie, das ist absurd!« Meine Empörung war echt.
»Wie erklären Sie es dann, dass mit dem Guthaben Ihres Kontos offenbar Waffen und Munition angeschafft wurden!«
»Wie bitte?«, fuhr ich hoch, was mein Kopf mir trotz der Schmerztablette sehr übel nahm.
»Wir haben den Weg Ihrer Quians durch das Netz verfolgt, obwohl versucht wurde, es durch vielfältige Umbuchungen über Deckadressen zu waschen. Es landete, Sie dürfen raten wo..!«
Ich war viel zu schockiert, um antworten zu können.
»Im Sudan, bei einer Rebellengruppe.«
»Das ist nicht Ihr Ernst!«, stotterte ich fassungslos.
Sie war aufgesprungen und schrie mich an. »Es ist mein verdammter Ernst! Und wenn Sie Bürschchen mir weiter solche Märchen auftischen wollen, dann werden Sie mich kennenlernen!«
Damit entschwand sie aus dem Raum und der Knall der zufliegenden Tür schoss mir fast ein Loch ins Hirn.
Ich kann nicht behaupten, dass mich diese Szene kalt gelassen hätte. Eine dumpfe Vorahnung von den übelsten Komplikationen keimte in mir auf, die sich später nur zu sehr bestätigen sollten. Vorerst tanzte vor meinen inneren Augen nur ein überdimensionale. »0 Quians« einen wilden Tango auf meinem geistigen Display. Wenn sich tatsächlich jemand meiner Chips bedient hatte, um Geld von meinem Konto abzuheben, dann musste er seltsamerweise auch den Übermittlungsschlüssel außer Kraft gesetzt haben, was bei der heutigen Technologie, die auf der Quantensicherung und einem Gen-Code beruht, eigentlich komplett unmöglich wäre. Und dass ich selbst in einem umnachteten Zustand Geld an Rebellengruppen im Sudan überwiesen haben sollte, war komplett ausgeschlossen. In was für eine Schweinerei war ich da hineingeraten? Aber es sollte noch dicker kommen, viel dicker!
Später, nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit die Zimmerdecke angestarrt hatte, meldete sich der Screen mit einer Videonachricht. Eine Krankenschwester kündigte den Impftermin an, ich solle mich bereit halten. In der Zwischenzeit sollte ich die Kontaktdaten von meinem Rechtsanwalt herausfinden, um eine juristische Vertretung für meinen Fall zu beauftragen. Fü. »meinen Fall«? Jetzt war ich von einem medizinischen Fall schon zu einem juristischen Fall upgegradet worden? Das war wohl ein schlechter Scherz!
War es nicht.
Es half auch nicht, dass ich an die Vernunft meines Gegenübers in Form eines weiteren und wohl ranghöheren Sicherheitsbeamten, der mich noch vor der angedrohten Nachimpfung aufsuchte, appellierte. So meine Argumentation: Wieso sollte ich mich einer sudanesischen Rebellentruppe anvertraut haben und mich als Belohnung anschließend verprügeln lassen?
Er antwortete mit einer traurig ernsten Miene, die jedoch nicht mir galt, sondern offenbar Bestandteil seines Gesichtes war, ‚Das sei zwar alles sehr unschön, er müsse nun einmal von den Fakten ausgehen und die sprächen eindeutig gegen mich‘.
Welche Fakten bitte?
Erstens, so zählte er an seinen Fingern auf, sei ich unmotiviert nach meiner beruflichen Tätigkeit angeblich zufällig in diese berüchtigte Gegend gekommen, um angeblich zu speisen, obwohl ich nachweislich bereits Essen für den Abend geordert hatte. Noch dazu, weil, zweitens, ein angeblicher Geheimdienstmitarbeiter, der nachweislich nicht existierte, mich dazu aufgefordert habe. Drittens sei mit dem Geld, und zwar nicht nur dem Guthaben auf meinem Konto, sondern bis zur Ausschöpfung des gesamten Überziehungsrahmens, über verschleierte Umwege Geld an Rebellen zwecks deren Bewaffnung geflossen. Und das eindeutig mit meinem Gen-Code und unter Verwendung des modernsten Sicherheitsschlüssels, so dass eine unbeabsichtigte oder durch Dritte verbrecherisch durchgeführte Transaktion undenkbar sei. Viertens weise meine Impfverweigerung darauf hin, dass ich das Gemeinwohl nicht sehr ernst nehme und möglicherweise sogar sabotieren wolle. Das seien die Fakten. Warum und weshalb es zu den anschließenden Verletzungen bei mir gekommen sei, sei trotz meiner engagierten Aussage, die überprüft werde, in den Bereich der Spekulation einzuordnen und leider ohne jeglichen Belang.
Angesichts dieser erdrückenden Beweislage zog ich es beinahe vor, die Waffen zu strecken. Es fiel mir schwer, ihm nicht eine gewisse Logik in seiner Sichtweise zu bescheinigen.
»Halt, Moment mal! Warum fragen Sie nicht unseren Dienststellenleiter, der wird ihnen wohl alles erläutern können!«, hoffte ich ihn überzeugen zu können.
»Das haben wir bereits veranlasst, obwohl derzeit nur sein Vertreter Herr Dr. Eschner zu erreichen ist. Er gab an, dass er sich ihr Verhalten auch nicht erklären könne und einen Mitarbeiter namens Raskovnik kenne er auch nicht.«
An dieser Stelle fiel mir der Unterkiefer runter. Dieser Kotzbrocken! Dieser Widerling, dieser, dieser...! Erschöpft ließ ich mich auf mein Kissen zurücksinken. De. »Oberwachtmeister« verabschiedete sich traurig, nachdem er mir mitgeteilt hatte, ich müsse verstehen, dass ich zur Zeit unter Haft stehe und das Krankenzimmer nicht verlassen dürfe, bis ein Richter über mein weiteres Schicksal entschieden habe.
Er notierte eifrig den Namen meines Anwaltes in sein Pad und verließ das Zimmer, nicht ohne mir einen Blick zuzuwerfen, mit dem man üblicherweise nur seinen todkranken Dackel beerdigt.
In meinem Kopf spielten die Gedanken ‚Fang mich‘. Man sollte doch besser auf sein Bauchgefühl hören. Das hatte mich eindeutig vor dem ganzen Fall gewarnt! Ich dachte über meine momentanen Möglichkeiten nach und konnte sie ohne große statistische Überlegungen überschlagsmäßig als null bezeichnen. Das Bild von Frau Montenièr fiel mir wieder ein bzw. ihre Augen. Genau diese Augen waren es wohl, die mich in das ganze Schlamassel gerissen hatten, neben meinen übermäßigen Gefühlen der Rachsucht gegenüber Dr. Dr. habil Arschloch Eschner.
Buddha hat wohl doch recht gehabt vor über zweieinhalbtausend Jahren, dass nur die Beherrschung der Leidenschaften und üblen menschlichen Neigungen ins Land der Glückseligkeit führt. Da klopfte ganz zaghaft die leise Stimme einer Erinnerung an mein gestauchtes Hirn. »Geh da weg, Suzanne!«, tönte ein feines Stimmchen in meinem Ohr. Wie hieß die Montenièr noch mit Vornamen?
Suzanne?
Suzanne!
Sollte das ein Zufall sein?
Ein Gedanke begann von verschiedenen Enden meiner Hirnwindungen ein eigenartiges Netz zu spinnen, dessen Fäden ich noch nicht genau sortieren konnte. Leider unterbrach das Geräusch einer sich öffnenden Tür die Suche nach einem Sinn gerade in dem Moment, als ich das Gefühl hatte, kurz vor einer Erleuchtung zu stehen.
Herein kam die Kollegin aus der Seuchenabteilung unseres Amtes mit dem Injektionsapparat in der Hand und beide riefen wir synchron die Worte. »Sie hier?« aus.
»Was machen Sie hier?«, fragte sie verblüfft und bemüht, nicht allzu entsetzt auszusehen.
»Ich bin Terrorist, Impfverweigerer und Häftling...«, grinste ich sie bösartig an. Ihre Gesichtszüge gefroren einen Moment, als sie versuchte, die Situation zu erfassen. Humor war wohl nicht ihre Stärke. Allerdings war der meine auch mehr von Verzweiflung geprägt als von echter Freude.
»Und Sie?«
Ihre Hand zitterte leicht, doch sie versuchte ihre Anspannung tapfer zu verbergen.
»Ich, ich habe Notdienst heute.«
Ach ja, die armen Kollegen von der Seuchenabteilung mussten ja tatsächlich ärztlichen Notdienst schieben. Das hieß allerdings, dass jetzt sowohl nach Dienstschluss als auch Wochenende sein musste. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich weder die genaue Uhrzeit noch den Wochentag wusste, den die Welt außerhalb dieses Zimmers beging. Immerhin zeigte mein wiedererwachtes Interesse an Ort und Zeit meinem geschulten Geist an, dass ich langsam aus der Agonie aufzutauchen begann und wieder am aktuellen Leben Anteil nehmen wollte. Sie trat zögerlich an mich heran, als fürchte sie, gleich Opfer eines tödlichen Überfalls meinerseits werden zu können.
»War nur ein Scherz, Frau Kollegin. Ich hab einfach den Impftermin verschwitzt. Zu viel unerledigte Akten, wissen Sie?«, beruhigte ich sie. Das mit den unerledigten Akten schien sie zu kennen, denn ein Lächeln schlich sich in ihr Gesicht.
»Ach so, und ich dachte schon...«
»Nein, nein, aber ehrlich gesagt, genau das wirft man mir hier vor.«
Sie zögerte wieder, etwas unsicher geworden.
»Haben Sie denn die Impfcharge schon individualisiert?«, fragte ich sie, um sie ein wenig abzulenken.
»Oh, ja, natürlich, sonst wäre sie ja nutzlos.«
Die Zeiten der ungezielten Massenimpfungen waren ein für allemal vorbei, als sich endlich herausstellte, dass die bis daher vertuschten Impfzwischenfälle meist an einer ungünstigen Genkombination beim Impfling mit dem Impfstoff lagen. Das Immunsystem reagiert nämlich sehr individuell auf den Impfschaden, der durch eine Impfung immer gesetzt wird. Bei ungünstigem Zusammenwirken bestimmter Gen-Typen mit dem abgetöteten Impferreger kommt es eben mitunter zu individuellen Überreaktionen mit einer Schädigung des Impflings, teilweise mit tödlichen oder auch lebenslangen Nebenwirkungen. Daher wurde der Zoga-Impfstoff mittels Gen-Check individualisiert, bevor er verabreicht wurde. Das heißt, bestimmte Komponenten wurden weggelassen oder verändert. Die Zahl der schwersten Nebenwirkungen konnte auf diese Weise deutlich reduziert werden und die Industrie war nicht mehr genötigt, ungünstige Impfreaktionen zu verheimlichen. Anhand des Gen-Codes, der auf jedem Chip hinterlegt war, war dieses Verfahren inzwischen reine Routine.
»Woher haben Sie denn meinen Gen-Code, mein Chip ist mir leider entwendet worden?«, fragte ich daher vorsichtshalber. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich denke, dies wurde bereits aufgrund Ihrer Daten vorgenommen. Dr. Eschner hat ihn persönlich freigegeben.«
Ich zuckte zusammen. »Eschner?«