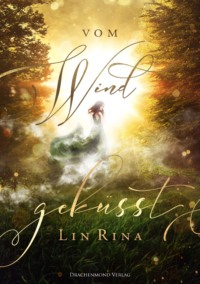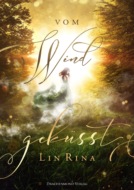Kitabı oku: «Vom Wind geküsst», sayfa 6
»Danke«, sagte ich leise und schaffte es sogar, ein wenig zu lächeln.
»Willst du mir nicht sagen, was los ist?«, fragte er unvermittelt und nahm wieder meine Hand.
Ich mochte es, wenn wir uns berührten. Es war eine so gewohnte Geste und doch begann ich ihr mehr Wert beizumessen, als ich es früher getan hatte.
Langsam schüttelte ich den Kopf. Dass ich in ihn verliebt war, konnte ich ihm nicht sagen. Es würde alles zwischen uns kaputtmachen. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass er meine Gefühle nicht erwiderte. Die Gesetze des Feuervolkes waren sehr eindeutig.
Irgendwas würde ich aber sagen müssen, um Justus’ Sorge zu zerstreuen. Also konnte ich ihm wenigstens die anderen Dinge berichten.
Ich seufzte zum bestimmt hundertsten Mal.
»Erinnerst du dich an den Mann im Haus des Ratssekretärs. Der, der uns die Tür aufgehalten hat?«, fragte ich vorsichtig.
Justus nickte.
Ich hob leicht vom Boden ab, setzte mich in die Hängematte und zupfte Justus am Ärmel, damit er sich neben mir niederließ.
»Der, von dem Mei behauptet hat, er habe ein Auge auf dich geworfen?«, brummte er und setzte sich umständlich zu mir.
Wir lehnten uns nach hinten und ich konnte zwischen den Blättern der Bäume sogar ein paar Sterne ausmachen. Justus war ganz nah bei mir, schenkte mir Sicherheit.
»Er hat mich so seltsam angesehen«, murmelte ich und erinnerte mich an das Lächeln, das er mir vorhin zugeworfen hatte. Mir wurde übel, wenn ich daran dachte.
»Sag mir bitte nicht, dass du dich in ihn verguckt hast«, sagte Justus plötzlich streng und ich schrak bei seinem harten Tonfall zusammen. Was war denn das?
»Nein!« Ich boxte ihm gegen das Knie. »Er war an dem Abend beim Fest und hat mich beobachtet.« Mir fuhr ein unangenehmer Schauder über den Rücken. »Und heute war er wieder da.«
»Was? Kann das Zufall sein?« Justus schien kurz zu überlegen. »Hast du ihn die letzten Abende auch gesehen?«
Ich schüttelte den Kopf, zuckte aber gleichzeitig ratlos mit den Schultern. »Ich bin nach dem Feuerspektakel gleich schlafen gegangen.« Es gefiel mir nicht, das zuzugeben, denn es könnte zu weiteren Fragen führen.
Doch Justus blieb einfach still und starrte in die Dunkelheit.
»Er macht mir Angst«, gab ich zu und drückte mich enger an ihn. »Sein Blick und dieses seltsame Lächeln. Es fühlt sich komisch an. Als ob er irgendwas über mich wüsste.« Erst nachdem ich es ausgesprochen hatte, wurde mir bewusst, was ich da eigentlich gesagt hatte.
Justus war sofort alarmiert. »Du glaubst, er weiß, wer du bist?«, fragte er scharf. Ich spürte seinen bohrenden Blick, auch wenn ich im Schatten der Bäume sein Gesicht kaum erkennen konnte, und atmete tief durch.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete ich wahrheitsgemäß und rieb mir die Augen. »Es gibt aber noch mehr.«
»Mehr was?«
»Probleme«, erklärte ich und spürte den Windhauch, der uns umschwebte. Jetzt, wo ich einmal angefangen hatte zu erzählen, fiel es mir auch viel leichter. »Es geht um den Wind.«
Justus sagte nichts, wartete darauf, dass ich weitersprach. Der Wind kam zu mir, wie als Bestätigung, dass er nicht schon wieder verschwunden war.
»Es ist, als ob er in letzter Zeit ab und zu krank wäre. Er …« Ich stockte wieder und bedachte meine Worte noch einmal. »Er verschwindet für eine Weile, und jedes Mal, wenn ich ihn dann suche, finde ich ihn bei dem Windspiel, das du mir gekauft hast.« Kurz hatte ich überlegen müssen, wie ich es ihm beschreiben sollte, ohne ihm zu sagen, dass der Wind mir nicht antwortete, wenn ich ihn rief.
»Und das passiert, seit du das Windspiel hast?« Justus bewegte sich und die Hängematte geriet ins Schaukeln. Verhalten zischend hielt er sich am Rand fest. Er mochte es nicht, wenn die Seile schwangen. Dabei waren wir vielleicht gerade mal einen Meter vom Boden entfernt.
»Ja, schon dreimal, zuletzt vorhin beim Fest. Er dreht sich dann immer in den gleichen Schleifen um diese silbernen Stäbe.« Ich machte die Bewegung mit den Fingern nach, um zu zeigen, was ich meinte.
Er schwieg.
»Justus?«, fragte ich, nur um sicherzugehen, dass er nicht eingeschlafen war.
»Mach das bitte noch mal«, bat er mich plötzlich und klang, als wäre ihm etwas eingefallen. Vorsichtig setzte er sich auf und zog mich ebenfalls hoch.
Ich beeilte mich, die Geste zu wiederholen. Drei in sich geschwungene Kreise.
Justus erzeugte eine kleine Feuerkugel auf seiner Handfläche und hielt sie zwischen uns. Erst folgte sein Blick meinem Finger, dann sah er mich an.
»Du bist nicht mehr so blass«, sagte er und lächelte.
Ich spürte die Röte in mein Gesicht steigen, wusste aber nicht recht, warum es mir peinlich war. Mir ging es viel besser, nachdem wir etwas geredet hatten. Und seine Wärme tat das ihre dazu.
»Und was ist jetzt mit den Kreisen? Oder findest du es nur hübsch, wie sich meine Hand durch die Luft bewegt?«, fragte ich schnippisch, um meine Unsicherheit zu überspielen.
Er lachte kurz auf und löschte die Flamme. »Nein. Aber ich habe so was schon mal gesehen. Das Feuer verhält sich manchmal auch seltsam; und es summt dabei.«
Das Lied. »Ja, der Wind fängt an zu singen!«
»Dann wird es so sein«, murmelte Justus und lehnte sich wieder in die Hängematte. Langsam, damit sie nicht anfing zu schaukeln. »Hast du mal von den Artefakten des Feuers gehört?«, erkundigte er sich und ich verneinte.
Justus räusperte sich und fuhr sich mit den Händen durchs kurze Haar. »Die Artefakte des Feuers sind eine Reihe an Edelsteinen. Oft werden sie in Schmuckstücke eingearbeitet und von den Würdenträgern getragen. In den Steinen werden überschüssige Feuerkräfte gespeichert.«
»Wie können Feuerkräfte überschüssig sein?«, unterbrach ich ihn und machte große Augen.
»Leg dich hin. Ich erkläre es dir. Du darfst aber nicht einschlafen«, mahnte er mich und ich lehnte mich an ihn.
»Keine Sorge«, flüsterte ich und spürte trotz all der Sorgen, die mich belasteten, die Schmetterlinge in meinem Bauch.
»Die Feuermagie ist eine Kraft, die sich gleichmäßig auf uns alle im Volk verteilt. Doch jeder von uns entwickelt diese Macht für sich weiter, lebt mit ihr und bereichert sie.
Würde ich beispielsweise sterben, würde die Kraft, die ich als Sechzehnjähriger erhalten habe, zurück an alle anderen gehen. Aber alles, was ich selbst dazu beigetragen habe, bleibt zwar für ein paar Generationen in der Feuermagie erhalten, kann von den anderen aber nicht genutzt werden. Es sind überschüssige Feuerkräfte.
Damit sie aber nicht verloren gehen, werden sie alle fünfundzwanzig Jahre bei einem großen Fest vom Oberhaupt des Feuervolkes in einen Edelstein gebannt. Und nebenbei ein neues Oberhaupt erwählt.« Er sah mich an, versicherte sich, dass ich verstand.
Ich nickte zögerlich und versuchte mir nicht vorzustellen, dass Justus sterben könnte.
»Gut, dann kommt jetzt die relevante Information«, kündigte er an und ich lachte leise.
»War das bisher nicht relevant?«, fragte ich und er drehte sich zu mir.
»Nicht so sehr. Mir ist nur aufgefallen, dass ich dir wirklich selten von uns erzähle. Ich glaube immer, du müsstest das alles schon wissen.«
Sein Gesicht war meinem ganz nah und ich musste mich daran erinnern, ihm zuzuhören.
»Also. Legt man eines der Artefakte ins Feuer oder kommt ihm damit nahe, beginnen die Flammen in Schleifen um die Edelsteine zu ziehen und die Steine summen dazu ein geheimes Lied der Macht.«
Ein geheimes Lied der Macht, echote es in meinen Gedanken. Ich war seit zwölf Jahren mit ihnen unterwegs, hatte bereits elf Winter in ihrer Stadt verbracht und keiner hatte je auch nur eine Silbe davon erwähnt.
Na ja, warum hätte ich, als Außenseiterin, es auch wissen sollen? Es war eines der Geheimnisse des Feuervolkes, und allein schon, dass sie mich in die Feuerstadt ließen, war eine sehr großmütige Geste.
Aber was bedeutete das alles jetzt für mich?
Ich hatte bisher nur selten nach Parallelen zwischen den Völkern gesucht. Die Art, wie ich mit dem Wind umging und sie mit dem Feuer, war so grundverschieden, dass ich immer geglaubt hatte, es müsse in allen anderen Bereichen ebenso sein.
Sie hatten keinen persönlichen Bezug zu ihrem Element, wie ich ihn zu meinem hatte, und behandelten ihre Kräfte wie Werkzeuge, die sie zu Hilfe nahmen und dann wieder löschten. Bei mir war der Wind ein Teil meiner Seele, bestimmte meine Wünsche und Sehnsüchte. Ich beherrschte ihn nicht einfach, sondern arbeitete mit ihm zusammen wie mit einem Freund.
Doch das Kreisen des Windes um das Windspiel war wirklich eigenartig und auch das Singen gab mir einen guten Grund, es mit den Artefakten des Feuers zu vergleichen.
War es ein Artefakt des Windes?
Der Wind war so still gewesen, dass ich für einen Augenblick befürchtete, er wäre schon wieder verschwunden. Doch als ich ihm meine Aufmerksamkeit schenkte, tanzte er sofort um die Hängematte herum.
Ist das wahr?, fragte ich ihn. Ist das Windspiel ein Artefakt?
Zum Schutz und zur Ermutigung, gab er zurück. Die Windartefakte, so besonders, so geachtet und trotzdem hat es alles nichts genützt.
Es war kein klares Ja, aber es reichte als Bestätigung.
Der Wind stob davon und rauschte kraftvoll durch die Baumkronen über uns. Junge Bäume und lange Äste ächzten, jammerten. Es klang, als würde der Wind weinen und sein verlorenes Volk betrauern.
Ich konnte ihn gut verstehen, denn auch ich vermisste es, zu einer Familie zu gehören, Teil eines Volkes zu sein.
»Ein Windartefakt, was?«, sagte ich müde zu Justus. Meine Augenlider waren mittlerweile schwer und mein Geist wirr. Es musste sehr spät sein.
Er rieb sich die Augen und nickte. »Wenn es so ist, Cate, und es tatsächlich ein Artefakt ist, so wie es das bei uns gibt, dann sollten sich dir zwei Fragen stellen«, sagte er und schob sich vorsichtig aus der Hängematte. »Erstens, ob es noch mehr von ihnen gibt und wie du sie so schnell wie möglich in deinen Besitz bringst. Und zweitens …« Er stockte und zündete mit der einen Hand eine winzige tanzende Feuerkugel an, um mir in die Augen sehen zu können. Müde, aber todernst kamen die nächsten Worte über seine Lippen. »… musst du dir bewusstwerden, dass du im Moment allein die gesamte Kraft deines Volkes besitzt. Nur weil alle weg sind, ist sie ja nicht verloren. Sie sammelt sich. Und zwar in dir. Wie mächtig bist du also wirklich?«
Ich schluckte gegen meinen trockenen Hals an. So viele Gedanken, so viel, über das ich nachdenken musste.
In dieser Nacht blieb mir der Schlaf trotz Müdigkeit fern.
7

Der Morgen graute und mein Kopf fühlte sich an wie Grütze. Ich hatte die ganze Nacht gegrübelt und jetzt, wo feiner Dunst vom Boden aufstieg, hatte ich das Gefühl, noch weniger zu wissen als zuvor.
Was sollte ich mit diesen neuen Informationen anfangen?
Ich hatte versucht, mit dem Wind darüber zu sprechen, er gab mir auf meine Fragen jedoch keine sinnvollen Antworten. Und sobald ich konkret nachhakte, verstummte er.
War er wirklich krank? Oder war ich es vielleicht?
Mir war sogar schon der Gedanke gekommen, dass es an meiner Verliebtheit liegen könnte. Allerdings hielt ich das doch für abwegig.
Am wahrscheinlichsten erschien mir, dass das Windspiel die Ursache war oder auch meine Unfähigkeit, es zu verwenden.
Ich wälzte mich auf die andere Seite. Meine Hängematte schwankte dabei leicht. Meine Gefühle spiegelnd zog der Wind träge durch die Baumkronen über mir.
Justus hatte die ganze Nacht selig geschlafen. Anfangs hatte er leise geschnarcht, sich dann auf den Bauch gedreht und seitdem nicht mehr viel bewegt.
»Weil es gebraten besser schmeckt«, hatte er vor ungefähr zwei Stunden im Schlaf gemurmelt und sich an der Stirn gekratzt.
Vorsichtig linste ich über den Rand meiner Hängematte und betrachtete sein schlafendes Profil. Mit den strubbligen Haaren und dem entspannten Gesicht wirkte er viel jünger. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, während ich ihn musterte. Seine weich geschwungenen Lippen waren leicht geöffnet und er atmete gleichmäßig.
Mein Kopf war so furchtbar übermüdet, dass ich mich nicht vor meinen eigenen Gedanken retten konnte. Wie sich seine Lippen wohl anfühlten? Wie es war, ihn zu küssen?
Unbewusst fuhr ich mir mit der Zunge über den Mund. Ob er wohl aufwachte, wenn ich es versuchte?
Erschrocken zog ich den Kopf zurück und der Schreck half mir, wieder klarer zu sehen.
Ich konnte ihn unmöglich küssen! Was dachte ich da eigentlich?
In meinen Wangen brannte die Röte und ich legte die Fingerspitzen daran, um sie zu kühlen.
Als hätte ich nicht schon genug Probleme.
Lautlos erhob ich mich aus der Hängematte und schwebte den Baumwipfeln entgegen.
Am Horizont ging die Sonne auf.
Obwohl mein Kopf und mein Körper sich immer noch matt und müde anfühlten, hielt ich mich bisher eigentlich ganz gut. Nur Mei sprach mich auf meine dunklen Augenringe an. Falls Justus sie bemerkte, sagte er zumindest nichts dazu. Nur hin und wieder warf er mir besorgte Blicke zu.
Es war gerade Mittag und wir hielten zum Essen an einem Waldrand.
Ich vergrub meine nackten Zehen im weichen Boden, hing meinen Gedanken nach, starrte in meine Suppe und knabberte an einem Brotfladen, den Garan mir aufgezwungen hatte. Gestern war er noch ein Kind gewesen und heute backte er Brot wie ein Meister.
»Was ist los, Bree? Ist dir nicht gut?«, erkundigte sich Ayo vorsichtig bei ihrer Freundin. Die beiden saßen hinter mir im Gras, eine Schale mit Eintopf und Brot in der Hand. Neugierig drehte ich mich zu ihnen.
Bree starrte mit weit geöffneten Augen in ihre Suppe, dann wandte sie den Kopf ruckartig gen Süden. Achtlos glitt ihr das Essen aus der Hand, als sie sich erhob.
Ayo versuchte die Suppenschale noch aufzufangen, war aber zu langsam. Die Flüssigkeit ergoss sich über ihre Finger und lief ins Gras, die Schale blieb überraschenderweise heil. Zum Glück war Ayo unempfindlich gegen Hitze.
Inzwischen beobachteten alle Bree, die ein paar Schritte ging, den Blick wie in eine andere Welt gerichtet. Sie sah etwas, was uns anderen verborgen blieb, und wir warteten gespannt darauf, dass sie etwas sagte.
Dante war ebenfalls aufgestanden und hatte sich schützend hinter sie gestellt. Es kam nicht selten vor, dass sie sich überanstrengte und dann einfach ohnmächtig umfiel, wenn sie versuchte, zu weit zu sehen.
Ich dachte kurz daran, den Wind zu fragen, der bis eben noch mit dem Dampf meiner Suppe gespielt hatte und nun aufgeregt um meinen Kopf flog.
Er wartete nur darauf, mir mitzuteilen, was er wusste.
Doch da machte Bree endlich den Mund auf. »Da ist eine Kutsche. Keine Meile von hier.«
»Kommt sie auf uns zu?«, fragte Marc ein wenig übereifrig. Offensichtlich hatte er das Gefühl, etwas wiedergutmachen zu müssen, nachdem der letzte Besuch von Fremden für ihn nicht so gut verlaufen war.
Bree blinzelte verstört und sah ihn an. Erst jetzt schien sie wieder völlig da zu sein. »Nein, aber sie wird angegriffen von einem halben Dutzend. Sie war ziemlich stark bewacht. Acht Mann! Vier sind bereits tot. Im Innern der Kutsche sitzt eine Frau.« Sie sah von einem zum anderen, als wäre sie nicht sicher, was sie mit ihrer eigenen Information anfangen sollte.
Was war zu tun?
Auch die Wagenleute blickten sich gegenseitig fragend an.
Normalerweise hielt sich das Feuervolk aus sämtlichen Auseinandersetzungen der gewöhnlichen Menschen raus, um keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Mir fiel es jedoch schwer, einfach hier zu sitzen und es geschehen zu lassen. Sollte dort im Wald tatsächlich jemand angegriffen werden, konnte ich persönlich es verantworten, durch meine Untätigkeit seinen Tod mit zu verschulden?
Auch in Brees Gesicht spiegelten sich diese Bedenken, selbst wenn ich das von einer so kaltschnäuzigen Person wie ihr nicht gedacht hätte. Ihr Blick schnellte wieder in die Richtung, in der sich offensichtlich die Kutsche befand. »Jetzt sind es fünf«, flüsterte sie, doch wir hatten sie alle gehört.
Es rührte sich noch immer niemand. Bree ballte sie Hände zu Fäusten und mir brach der Schweiß aus.
Der Wind wurde energischer und ich schenkte ihm widerwillig meine Aufmerksamkeit.
Sie ist die Tochter des Fürsten von Mari!, wisperte er aufgeregt und zog fest an meinen Haaren.
Aua. Wer?, fragte ich ihn.
Die Frau in der Kutsche. Sie wird von albahrischen Soldaten überfallen.
Ich wusste kaum, wie mir geschah, doch ich erschrak so sehr, dass ich plötzlich kerzengerade dastand.
»Was ist los, Cate?«, wollte Mei wissen und sah erstaunt zu mir auf.
Jetzt oder nie, Cate, sagte ich zu mir selbst und wusste, dass ich es bereuen könnte, jetzt den Mund aufzumachen. Doch das letzte Mal hatte mich das schlechte Gewissen schon umgetrieben. Und diesmal standen sogar akut Menschenleben auf dem Spiel.
»Die Frau in der Kutsche ist die Tochter des Fürsten von Mari«, stieß ich aus und nun starrten alle mich an.
Mit zusammengepressten Lippen wartete ich auf die erste unangenehme Frage, doch sie kam nicht. Glücklicherweise war der Angriff an sich wichtiger als mein plötzliches Wissen über die Herkunft des Opfers.
Ihre Blicke wanderten geschlossen zu Kai, von dem sie eine Entscheidung erwarteten. Der große Mann stemmte die Hände in die Hüften und wandte sich an seine Frau. »Was sagst du?«
Die Spannung war kaum noch auszuhalten, machte mich so hibbelig, dass ich kurz davor war, den Wind auszuschicken, um Tanja zu schupsen, damit sie endlich etwas sagte.
»Ihr solltet handeln«, entschied sie und Kai nickte.
»Ich denke auch«, erwiderte er und ich atmete erleichtert auf.
Marc und die anderen Männer stellten sofort ihre Essensschalen zur Seite. Justus eilte zu seinem Wagen, holte seinen Jagdbogen und die Pfeile und reichte Marc seine Wurfdolche.
Auch die anderen bewaffneten sich mit dem, was sie hatten, Bree wies ihnen die Richtung und schon waren sie im Dickicht des Waldes verschwunden.
Mir und den Zurückgebliebenen blieb nichts als zu warten. Quälend langsam verging die Zeit. Bree stand noch immer abwesend da, ihre Sinne wohl auf das Geschehen eine Meile entfernt konzentriert.
Ich schickte den Wind los, um ihnen zu helfen. Er trieb sie voran, wehte die Äste der Bäume aus dem Weg und ich ließ ihn Justus sogar einmal schubsen, damit er nicht vom Weg abkam.
»Sie sind angekommen«, teilte Bree uns mit. Dann blinzelte sie überrascht und lächelte. Das war ein gutes Zeichen.
Als die Männer zurückkehrten, sahen sie sehr erschöpft aus. Es war eben nicht ohne, zuerst eine Meile zu rennen und anschließend ein halbes Dutzend Soldaten in die Flucht zu schlagen, wie mir der Wind erzählte.
Marc führte ein Pferd an den Zügeln, auf dem eine wunderschöne Frau kauerte. Sogar mit verstrubbelten Haaren und erschöpfter Miene wirkte sie immer noch so anmutig wie eine Prinzessin.
Ich beäugte sie aus der Ferne und fragte mich, wieso Frauen, die sowieso schon reich waren, zudem derart bezaubernd aussehen mussten. Das war doch unfair!
Doch in ihrer Lage wäre ich wiederum auch nicht gern. Denn die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fürstentümern machte selbst vor unschuldigen Mädchen nicht halt, wenn ihre Entführung jemandem zum Nutzen sein konnte.
Von ihren Wachen hatte keiner den Angriff überlebt. Wie sie sich wohl fühlte?
Marc reichte die Zügel an Mei weiter und half der Frau vom bloßen Rücken des Tieres herunter. Er lächelte sie aufmunternd an und erntete dafür einen warnenden Blick von seinem Vater, der mehr sagte als tausend Worte.
Niemand wusste so recht, was zu tun war, bis Tanja zu der Fürstentochter trat, um ihr einen Sitzplatz und eine Schale Wasser anzubieten.
Da kam wieder Leben in die Gruppe. Alle umringten das schöne Mädchen und stellten Fragen: Wer sie war? Woher sie kam? Warum sie angegriffen wurde? Und so weiter.
Sie hieß Elyssabed von Mari, Prinzessin von Berill, und war gerade auf dem Weg von der Sommerresidenz der Familie zurück in die Hauptstadt gewesen. Sie taute während des Gespräches etwas auf und erzählte uns schließlich alle Einzelheiten des Überfalls und wie schrecklich aufwühlend es für sie gewesen war.
Die Frauen und Kinder hingen an ihren Lippen, als sie die Ereignisse mit blumigen Worten schilderte.
Ich fand sie zu theatralisch. Doch vielleicht würden die anderen darüber ja vergessen, dass ich vorhin etwas gewusst hatte, was ich nicht hätte wissen können.
Ich seufzte, erhob mich, um nicht weiter zuhören zu müssen, und ging zu Justus, der mit Kai und Fin diskutierte.
»Wir können sie schlecht einfach hier aussetzen«, sagte Fin gerade und machte mit den Händen eine hilflose Geste.
»Mitnehmen können wir sie aber auch nicht!«, entgegnete Justus energisch.
Sie bemerkten nicht, dass ich zu ihnen trat. Also drehte ich mich wieder zu der Tochter des Fürsten und musterte sie von Weitem.
Das lange goldblonde Haar, das so typisch für die Südregion war, hatte man kunstvoll um ihren Kopf geflochten und es schimmerte im Licht der Mittagssonne. Die Seide ihres Kleides war in mehreren Rottönen gefärbt und mit Glassteinen bestickt. An der einen Seite war der Rock aufgerissen, was wahrscheinlich beim Kampf passiert war, und entblößte ein Stück ihres hellen Schenkels. Anscheinend war ihr das noch gar nicht aufgefallen oder sie zeigte ihr Bein mit Absicht her.
»Wir können sie zur nächsten Stadt bringen. Dort gibt es immer Soldaten und eine Kutsche dürfte auch nicht so schwer zu organisieren sein«, mischte ich mich ins Gespräch der anderen ein und drehte ihnen das Gesicht wieder zu.
Sie sahen überrascht aus. Diese Idee war ihnen wohl noch nicht gekommen.
»Was ist mit ihrer Kutsche eigentlich passiert?«
»Eines der Räder ist gebrochen«, antwortete Justus. Sein Blick wirkte erstaunt und noch etwas lag darin, was ich nicht einordnen konnte.
Meine Ohren wurden heiß.
»In dieser Gegend gibt es nur Dörfer. Die nächste Stadt dürfte drei Tagesreisen entfernt sein.« Kai nickte. Ihm schien der Vorschlag zu gefallen und er lächelte erleichtert.
»In unserem Tempo also dann sechs Tage. Das wäre zumindest mal ein Kompromiss«, stimmte Fin zu.
»Ihr wollt trotzdem Feuerspektakel veranstalten? Warum fahren wir die Strecke nicht am Stück? Dann sind wir die Fürstentochter schneller wieder los«, protestierte Justus und seine Augenbrauen zogen sich zu einem finsteren Blick zusammen.
Kai war dagegen. Das Spektakel ausfallen zu lassen würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Vor allem hier in den Grenzlanden war es besser, jeden Ärger zu vermeiden.
Besonders, wenn man die Tochter des Fürsten von Mari bei sich hatte.
»Ich habe mich mit den Dörflern unterhalten. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fürsten spitzen sich zu. Selbst im eigenen Land ist man nicht mehr sicher. Überall sind Spione unterwegs.« Kai hatte die Stimme gesenkt und sah sehr besorgt aus.
Mir kam sofort der Mann mit den blonden Locken und den tiefblauen Augen in den Sinn, der mir erst gestern wieder begegnet war. Vielleicht war es kein Zufall, dass er in den Grenzlanden herumschlich. Und er musste auch nicht zwangsläufig hinter mir her sein. Vielleicht war er einer dieser Spione.
Kai verließ den Kreis und die anderen machten ihm Platz, als er vor die Fürstentochter trat, die ihm irritiert entgegensah.
Nur sehr knapp und auch nicht besonders vornehm verbeugte er sich vor ihr. »Mylady, wir bieten Euch an, Euch bis zur nächsten Stadt zu geleiten. Dort könnt Ihr Euch eine Kutsche nehmen und Eure Reise fortsetzen.«
Das Mädchen sah ihn mit großen Augen an. Sie war gerade dabei gewesen, mit aufgeregter Stimme zu schildern, wie sehr sie das Auftauchen ihrer Retter überrascht hatte. Doch jetzt wurde ihr Gesicht verschlossen und spitz. Sie drückte Tanja die Wasserschale in die Hand und erhob sich, trotz des zerrissenen Kleides, äußerst elegant von der kleinen Holzbank.
»Ach, ihr bietet mir das an? Aber könnt ihr denn für meine Sicherheit garantieren?« Herausfordernd reckte sie das Kinn und ich fragte mich, was sie mit solch einer Erkundigung bezweckte.
»Mylady, in der jetzigen Situation habt Ihr eigentlich keine andere Wahl, als darauf zu vertrauen.« Kais Augen blitzten und ich verstand. Die Fürstentochter hatte geradewegs seinen Stolz angegriffen. Sie forderte ihn heraus. Doch ob sie das absichtlich tat, wusste ich nicht. »Natürlich müsstet Ihr Euch unauffälliger kleiden. Aber wer würde eine Fürstentochter schon bei einer Handvoll Wagenleute suchen? Ich bin davon überzeugt, dass Ihr in unserer Gesellschaft weitaus bessere Chancen habt, Euer Ziel zu erreichen, als wenn Ihr mit Eurer geschmückten Kutsche reist. Das hat sich ja bereits gezeigt.« Abschätzig blickte Kai auf sie herab, doch das Lächeln, das sich auf Elyssabeds Gesicht ausbreitete, ließ ihn unsicher werden. List, Arroganz und das Wissen, immer alles zu bekommen, was sie sich wünschte, lag auf ihren Zügen.
»Das ist wahr. Und ziemlich schlau«, bestätigte sie und mir schwante nichts Gutes. »Daher verlange ich, dass ihr mich die ganze Strecke von hier bis zu der Stadt meines Vaters mitnehmt. Es wäre ja nicht auszuhalten, sich ein zweites Mal in so eine Gefahr zu bringen.«
Kai war für einen Moment sprachlos. Damit hatte er wohl nicht gerechnet.
»Das ist nicht möglich!«, ging Justus dazwischen. Sein Gesicht war jetzt wirklich finster und ich hatte einen Augenblick Angst um die Fürstentochter.
Sie ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Die Ablehnung stachelte sie noch mehr an. »Wenn ihr mir das verweigern solltet, werde ich dafür sorgen, dass euch in Zukunft die Durchfahrt durch dieses Land verweigert wird«, warf sie ihm an den Kopf und stützte die schlanken Arme in die Taille. »So einen Feind wollt ihr doch nicht, oder?«, fügte sie hinzu und lachte so glockenhell, als hätte sie einen belanglosen Scherz gemacht.
Uns allen hingegen war nicht zum Lachen zumute, denn das konnten wir uns tatsächlich nicht leisten.
»Wir könnten Euch auch einfach im nächsten Graben verscharren«, zischte Justus gefährlich, trat einen Schritt auf sie zu und ballte die Hände zu Fäusten. Die Muskeln an seinen Oberarmen spannten sich unter dem Hemd und ich machte schon einen Schritt auf ihn zu, da ging sein Vater dazwischen.
Denn obwohl das auch ihm nicht gefallen konnte, war er schlau genug, sich nicht gegen so eine mächtige Frau zu stellen.
»Wir werden darüber nachdenken«, knickte er widerwillig ein.
Justus’ Kiefer schien Steine zu zermahlen vor Wut.
»Tut das«, entgegnete die Fürstentochter spitz und wandte sich an Tanja. »Besorgt mir unauffällige Kleider und zeigt mir, wo ich mich umkleiden kann«, befahl sie, als würde sie eine Dienstmagd scheuchen.
Tanja sah sie nur entgeistert an, schockiert von so viel Frechheit und ungeschminkter Arroganz. Dann wanderte ihr Blick zu Kai, der seine Frau mit einem stillen Nicken bat, der Aufforderung nachzukommen.
Es dauerte länger als gewohnt, bis wir weiterfahren konnten. Die Fürstentochter, die wir ab sofort mit Lyssa ansprechen sollten, damit sie keine unnötige Aufmerksamkeit erregte, ließ sich in unseren Wagen führen. Sie wählte das schönste Kleid, das Hanna in ihrer Truhe hatte, weil diese am ehesten ihrer Figur entsprach. Hanna sagte nichts, doch ich konnte ihr ansehen, wie sie schluckte, als sie ihren Schatz hergab, den sie seit Monaten mit kunstvollen Stickereien verzierte.
Die Flechtkunst auf ihrem Kopf löste sie selbst, nachdem Ayo ihr zweimal unabsichtlich an den Haaren zog, und verlangte dann nach bunten Bändern, wie die anderen Frauen sie in den Haaren trugen. Tanja sträubte sich und erklärte ihr, dass es eine Tradition der Wagenleute war. Die Farben zeigten die Zugehörigkeit einer Frau zu einem Clan und Tanja konnte es nicht mit ihrer Ehre vereinbaren, ihr eines der Bänder auszuhändigen.
Ich konnte dem nur zustimmen. Nicht weil meine Ehre hierbei eine Rolle spielte, sondern weil ich die Bänder auch nie hatte tragen dürfen. Und wenn ich schon nicht zu ihnen gehören durfte, dann eine eingebildete Fürstentochter erst recht nicht.
Elyssabed meckerte natürlich, empfand es als Frechheit, ihr etwas vorzuenthalten, und berührte mit spitzen Fingern alles, was sich in ihrer Reichweite im kleinen Innenraum des Wagens befand.
Als sie die Hand nach meinem Windspiel ausstreckte, das über meinem Bett hing, ging ich dazwischen und holte einen braunen Leinenstreifen aus einem Beutel am Fußende meines Bettes. Die Fürstentochter nahm es pikiert hin, obwohl sie sichtlich verärgert darüber war.
Doch nachdem sie mich eingehend gemustert hatte und feststellte, dass ich ebenfalls keine Bänder trug, ließ sie sich beruhigen.
Mit einem einfach geflochtenen Zopf, der ihr bis an die Taille reichte, setzte sie sich wie selbstverständlich auf den Kutschbock neben Hanna und strich sich viel zu elegant die Falten aus dem Rock ihres Kleides.
Und obwohl sie uns allen den letzten Nerv raubte, sah sie noch immer hinreißend aus.
Da Bree unbedingt mit Ayo und Mei bei der Fürstentochter sitzen wollte, räumte ich den Platz. Gerade als ich mich daranmachte, mir einen anderen zu suchen, zeigte Elyssabed auf mich. »Warum trägt sie keine Bänder in den Haaren?«, fragte sie ganz unverblümt und legte den Kopf zur Seite wie eine Katze.
Mir ging ein Stich durchs Herz und ich wandte das Gesicht zu Boden, damit sie nicht sah, wie ich vor Scham errötete.
»Weil sie nicht zu uns gehört«, antwortet Bree kühl, setzte sich aufrechter hin und schob ihren roten Zopf nach hinten, der wie immer mit grünen Bändern verziert war.
»Sagt, wie viele seidene Kleider habt Ihr in Eurem Besitz?«, erkundigte sie sich und zeigte mir damit einmal mehr, für wie unwichtig sie mich hielt.
Mir standen die Tränen in den Augen, als ich mich vom Wagen entfernte. Ich schob es auf meine Übermüdung, da ich sonst eigentlich nicht so schnell weinte. Zumindest bildete ich mir das gern ein.